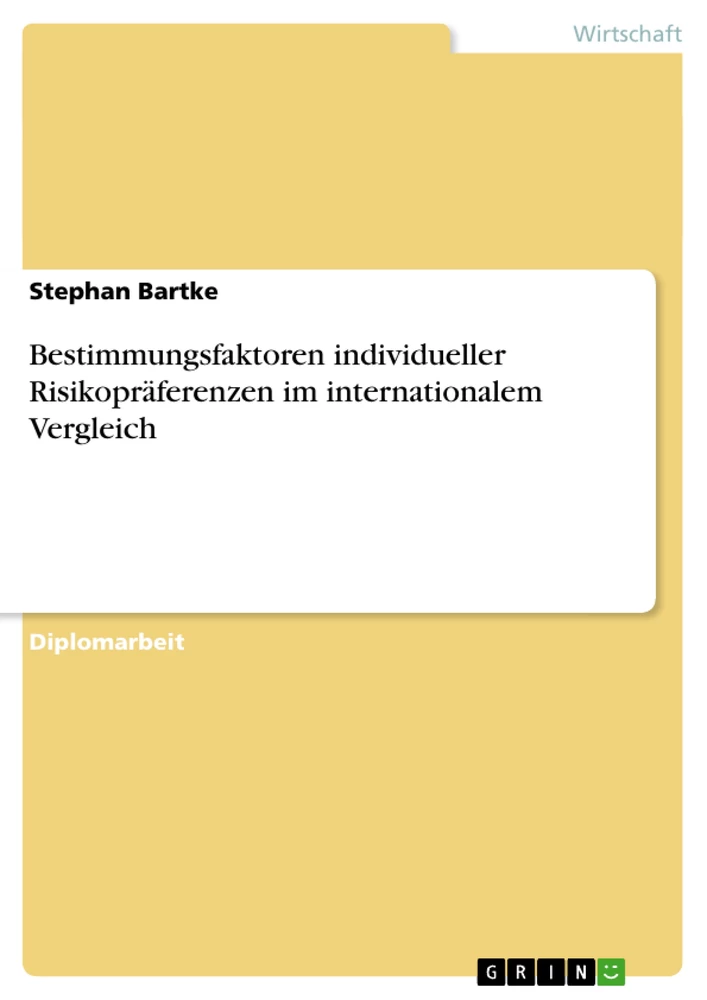Warum sind einige Menschen risikofreudiger als andere? Welche Ursprünge kennzeichnen die individuelle Risikobereitschaft? Sind die Deutschen wirklich ein risikoscheues Volk?
Der Autor befasst sich mit dem Aufdecken der Determinanten individueller Risikopräferenzen. Als Ausgangspunkt werden die Grundlagen der ökonomischen Entscheidungstheorie unter Unsicherheit rekapituliert und ein Überblick geboten über deren Vertiefungen, die geeignet sind unser risikobeeinflusstes Verhalten zu erklären.
Das Hauptaugenmerk dieser mit "sehr gut (1,0)" bewerteten Diplomarbeit bildet die Suche nach den Einflussfaktoren der menschlichen Risikobereitschaft. Die wahrscheinlichen Wirkungsweisen einer Vielzahl sozio-ökonomischer Faktoren werden auf der Grundlage einer umfangreichen Literaturbetrachtung ökonomischer aber auch psychologischer und neurobiologischer Studien – ergänzt um originäre Überlegungen zu den kausalen Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen – thematisiert. Diese Analyse erlaubt das Ableiten von expliziten Hypothesen, welche empirisch mit deskriptiven und induktiven statistischen Methoden getestet wurden auf der Datenbasis von ca. 22.000 befragten Personen des Sozio-Oekonomischen Panels SOEP, geführt beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) Berlin. Insbesondere nutzt der Autor eine innovative Methodik zur Analyse des potentiellen Einflusses der Nationalität auf die Risikobereitschaft, indem Emigranten nach Deutschland gezielt betrachtet werden.
Alle theoretisch abgeleiteten Hypothesen konnten durch die statistische Auswertung bestätigt werden. Die Ergebnisse zeigen:
(1) Die Bereitschaft Risiken einzugehen, ist in der Bevölkerung heterogen verteilt
(2) Risikoaversion ist eine überwiegende Einstellung
(3) Frauen sind risikoscheuer als Männer
(4) die Risikowilligkeit sinkt mit zunehmendem Alter
(5) größere Personen sind risikobereiter als kleinere
(6) höher gebildete Menschen sind gewillter Risiken einzugehen
(7) Personen mit höheren Einkommen sind risikofreudiger
(8) Menschen religiösen Glaubens sind risikoscheuer als Atheisten
(9) Konservative Religionen befördern Risikoaversion
(10) Nationalität ist kein bestimmender Faktor der individuellen Risikobereitschaft – sie zeigt sich als Amalgam zugrunde liegender Faktoren, die daher gegliedert betrachtet werden sollten
(11) trotz der vielen Zusammenhänge können sozio-ökonomische Faktoren nicht mehr als ein Drittel der Unterschiede in den zwischenmenschlichen Risikoeinstellungen erklären.
Inhaltsverzeichnis
- A Einleitung
- Einführung
- Zielsetzung
- Gang der Betrachtung
- B Theoretische Analyse
- Entscheidungstheoretische Grundlagen
- Präferenzordnung, Nutzen und Entscheidungen unter Sicherheit
- Entscheidungen unter Risiko
- Unsicherheit i.e.S. – Entscheidungen unter Ungewissheit
- Erwartungsnutzentheorie
- Bernoulli-Prinzip
- von Neumann/Morgenstern/Savage-Axiome
- Risikopräferenzen
- Risikomaße
- Erweiterungen der klassischen Erwartungsnutzentheorie
- Stabilität von Präferenzen
- Stabilität versus Kontextabhängigkeit
- Stated versus revealed Preferences und deren Beeinflussung
- Repräsentativität
- Informationsverfügbarkeit
- Beeinflussung durch Problemstellung
- Affekte
- Bestimmungsfaktoren individueller Risikopräferenzen
- Grundlegende Arbeiten
- Diskussion einzelner Determinanten
- Geschlecht
- Alter
- Körpergröße
- Bildung
- Einkommen/Vermögen
- Religion
- Nationalität
- Weitere Aspekte
- Problematik der Endogenität
- Zwischenfazit und Hypothesenzusammenfassung
- Entscheidungstheoretische Grundlagen
- C Empirische Validierung
- Datengrundlage
- Problematik internationaler Vergleichbarkeit
- Das SOEP
- Untersuchungsmodell
- Das Risikomaß
- Variablendefinitionen
- Untersuchungsmethode
- Empirische Ergebnisse
- Deskriptive Analyse
- Korrelationsanalyse
- Regressionsanalyse
- Zwischenfazit und Hypothesenbewertung
- Datengrundlage
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Bestimmungsfaktoren individueller Risikopräferenzen im internationalen Vergleich. Ziel ist es, verschiedene Faktoren zu identifizieren, die die Risikobereitschaft von Individuen beeinflussen, und diese empirisch zu überprüfen. Die Arbeit verbindet dabei ökonomische, psychologische und neurobiologische Ansätze.
- Theoretische Fundierung der Risikopräferenz
- Einfluss soziodemografischer Faktoren auf die Risikobereitschaft
- Empirische Analyse der Risikopräferenzen anhand des SOEP-Datensatzes
- Der Einfluss von Nationalität auf die Risikobereitschaft
- Bewertung der Ergebnisse und Limitationen der Studie
Zusammenfassung der Kapitel
A Einleitung: Dieses einleitende Kapitel führt in die Thematik der individuellen Risikopräferenzen ein, erläutert die Zielsetzung der Arbeit und skizziert den methodischen Aufbau. Es wird die Relevanz des Themas im Kontext der ökonomischen Entscheidungstheorie hervorgehoben und ein Überblick über den weiteren Verlauf der Arbeit gegeben. Die Einleitung stellt den Rahmen für die nachfolgende theoretische und empirische Analyse dar, indem sie die Forschungsfrage prägnant formuliert und die gewählte Methodik begründet.
B Theoretische Analyse: Kapitel B bietet eine detaillierte Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen der Risikopräferenz. Es beginnt mit der klassischen Erwartungsnutzentheorie und ihren Axiomen und erweitert diese um neuere Ansätze, welche die Komplexität der menschlichen Entscheidungsfindung unter Unsicherheit berücksichtigen. Im Mittelpunkt stehen die verschiedenen Determinanten individueller Risikopräferenzen, die eingehend diskutiert und auf ihre Bedeutung im Kontext der Arbeit eingegangen werden. Der Kapitel gipfelt in der Formulierung von Hypothesen, die in der empirischen Analyse überprüft werden sollen. Besondere Beachtung findet die Problematik der Endogenität und mögliche Kausalitätsketten.
C Empirische Validierung: Kapitel C beschreibt die empirische Untersuchung der in Kapitel B aufgestellten Hypothesen. Es wird der verwendete Datensatz (SOEP) detailliert vorgestellt, und die methodischen Vorgehensweisen der deskriptiven, korrelativen und regressionsanalytischen Untersuchungen werden erläutert. Die Ergebnisse werden präsentiert und hinsichtlich der Gültigkeit der Hypothesen bewertet. Es wird auf die Herausforderungen bei internationalen Vergleichen von Risikopräferenzen eingegangen und die Limitationen der Studie diskutiert.
Schlüsselwörter
Risikopräferenzen, Entscheidungstheorie, Erwartungsnutzentheorie, SOEP, soziodemografische Faktoren, Nationalität, empirische Analyse, Regression, Risikobereitschaft, Heterogenität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Bestimmungsfaktoren individueller Risikopräferenzen im internationalen Vergleich
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Bestimmungsfaktoren individueller Risikopräferenzen im internationalen Vergleich. Ziel ist die Identifizierung und empirische Überprüfung verschiedener Faktoren, die die Risikobereitschaft von Individuen beeinflussen. Dabei werden ökonomische, psychologische und neurobiologische Ansätze kombiniert.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst eine theoretische Fundierung der Risikopräferenz, den Einfluss soziodemografischer Faktoren auf die Risikobereitschaft, eine empirische Analyse anhand des SOEP-Datensatzes, die Untersuchung des Einflusses der Nationalität auf die Risikobereitschaft sowie eine Bewertung der Ergebnisse und Limitationen der Studie.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in drei Hauptteile: Einleitung (Einführung, Zielsetzung, Gang der Betrachtung), Theoretische Analyse (Entscheidungstheoretische Grundlagen, Bestimmungsfaktoren individueller Risikopräferenzen, Zwischenfazit und Hypothesenzusammenfassung) und Empirische Validierung (Datengrundlage, Untersuchungsmodell, Empirische Ergebnisse, Zwischenfazit und Hypothesenbewertung).
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die theoretische Analyse basiert auf der klassischen Erwartungsnutzentheorie und ihren Axiomen (Bernoulli-Prinzip, von Neumann/Morgenstern/Savage-Axiome, Risikopräferenzen, Risikomaße), erweitert um neuere Ansätze, die die Komplexität menschlicher Entscheidungsfindung unter Unsicherheit berücksichtigen. Es wird die Stabilität von Präferenzen (Stabilität versus Kontextabhängigkeit, Stated versus revealed Preferences) und deren Beeinflussung (Repräsentativität, Informationsverfügbarkeit, Beeinflussung durch Problemstellung, Affekte) diskutiert.
Welche soziodemografischen Faktoren werden untersucht?
Die Arbeit untersucht den Einfluss von Geschlecht, Alter, Körpergröße, Bildung, Einkommen/Vermögen, Religion und Nationalität auf die individuelle Risikopräferenz.
Welcher Datensatz wird verwendet?
Die empirische Analyse basiert auf dem SOEP (Sozio-oekonomisches Panel) Datensatz. Die Problematik der internationalen Vergleichbarkeit wird dabei explizit thematisiert.
Welche Methoden werden in der empirischen Analyse eingesetzt?
Die empirische Analyse verwendet deskriptive, korrelative und regressionsanalytische Methoden.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Risikopräferenzen, Entscheidungstheorie, Erwartungsnutzentheorie, SOEP, soziodemografische Faktoren, Nationalität, empirische Analyse, Regression, Risikobereitschaft, Heterogenität.
Wie werden die Ergebnisse bewertet?
Die Ergebnisse werden im Hinblick auf die Gültigkeit der aufgestellten Hypothesen bewertet. Die Limitationen der Studie, insbesondere im Hinblick auf die Herausforderungen bei internationalen Vergleichen, werden ebenfalls diskutiert.
Welche Problematik wird bezüglich der Endogenität angesprochen?
Die Arbeit thematisiert die Problematik der Endogenität bei der Untersuchung der Determinanten individueller Risikopräferenzen und mögliche Kausalitätsketten.
- Quote paper
- Dipl.-Volkswirt Stephan Bartke (Author), 2006, Bestimmungsfaktoren individueller Risikopräferenzen im internationalem Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/69791