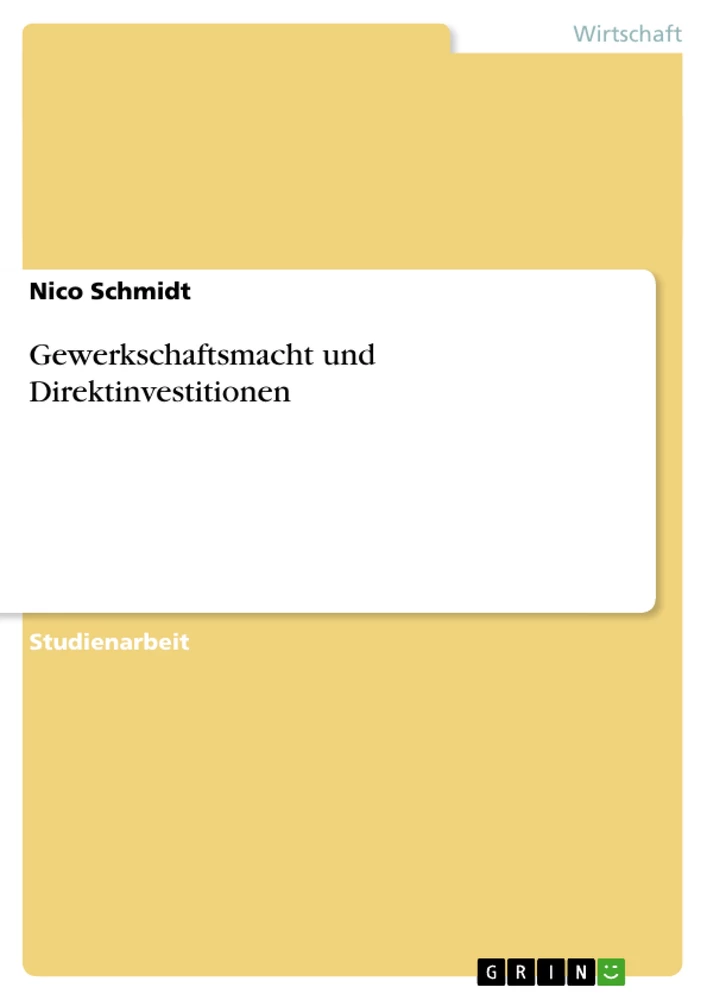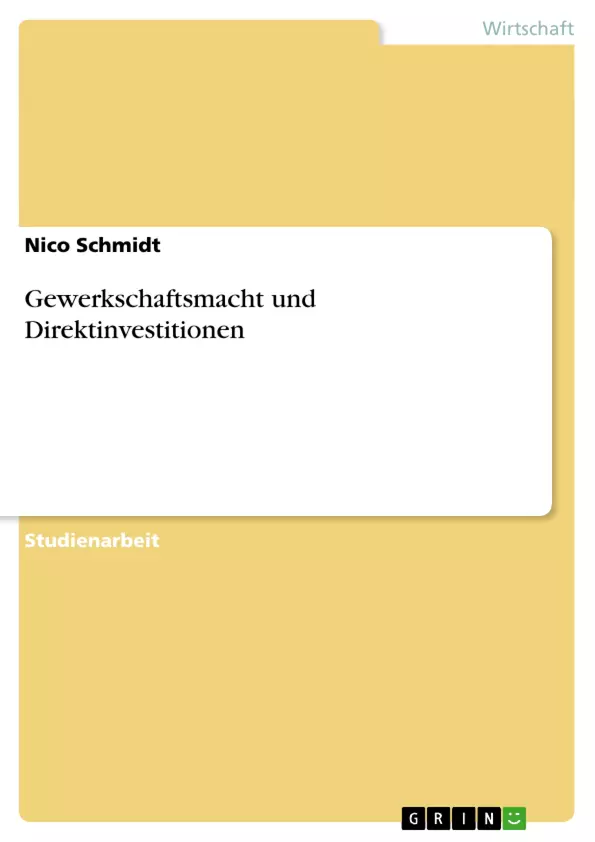Ob General Motors, Daimler-Chrysler oder Volkswagen - eines haben die führenden Autobauer gemeinsam: Sie stecken in der Krise. Überkapazitäten, die aufgrund der geringen Nachfrage entstehen und ein extremer Gewinnrückgang im ersten Halbjahr 2004 sind der Grund für die drastisch gekürzten Gewinnprognosen von VW. Aufgrund der steigenden Arbeitsproduktivität in der Branche wirkt diese Entwicklung paradox, aber bei genauerer Analyse der Situation scheinen die Schuldigen für die Entwicklung schnell gefunden: Die Gewerkschaften sorgen im Rahmen der Tarifverhandlungen für Löhne über dem Wettbewerbslohn, zu hohe Beschäftigung und sind es außerdem, die den international tätigen Unternehmen im Weg stehen, wenn es darum geht, die Kosten für den Produktionsfaktor Arbeit zu senken und überflüssige Arbeitskräfte zu entlassen.
VW-Finanzchef Hans Dieter Pötsch erklärte erst kürzlich, dass die anstehenden Tarifverhandlungen zwischen VW und der IG-Metall eine extrem negative Auswirkung auf die Arbeitsplatzsituation in Deutschland haben könnten. Nachdem der Verhandlungsführer der IG-Metall Hartmut Meine seinerseits eine „knallharte Tarifrunde“ ankündigte, wurde Pötschs Drohung dann konkreter: Er erklärte, dass bei Nicht-Akzeptanz der 2-jährigen Lohnnullrunde mehr als 30.000 Arbeitsplätze in Deutschland auf dem Spiel stehen. Um diese Aussagen zu verstehen, muss zuerst der Ablauf von Tarifverhandlungen zwischen Unternehmen und Gewerkschaften genauer betrachtet werden. Eine Unterscheidung zwischen Märkten ohne Direktinvestitionen (Kapitel mit wechselseitigen4.1),
Direktinvestitionen (Kapitel4.2)und einseitigen (asymmetrischen) Direktinvestitionen (Kapitel4.3)ist dabei zweckmäßig, da multinationale Unternehmen eine stärkere Verhandlungsposition gegenüber den Gewerkschaften haben als nationale Unternehmen und somit unterschiedliche Verhandlungsergebnisse entstehen. Die mathematische Beweisführung erfolgt im mathematischen Anhang anhand der Berechnungen zum Modell aus Kapitel 4.2.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Nash-Verhandlungen und Nash-Gleichgewicht
- 3. Annahmen der Modelle
- 4.1 Modell ohne Direktinvestitionen in gewerkschaftlich organisierten Arbeitsmärkten
- 4.2 Modell mit wechselseitigen Direktinvestitionen in gewerkschaftlich organisierten Arbeitsmärkten
- 4.3 Modell mit asymmetrischen Direktinvestitionen in gewerkschaftlich organisierten Arbeitsmärkten
- 5. Untersuchung der Gleichgewichte
- 6. Kritik
- 7. Schlussfolgerungen
- 8. Mathematischer Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Verhandlungsprozess zwischen Unternehmen und Gewerkschaften im Kontext von Tarifverhandlungen, insbesondere in der Automobilindustrie. Dabei wird der Fokus auf die Rolle von Direktinvestitionen gelegt und die Auswirkungen auf die Verhandlungsmacht und die Ergebnisse der Verhandlungen analysiert.
- Die mathematischen Grundlagen des Nash-Gleichgewichts und seiner Anwendung in Tarifverhandlungen
- Der Einfluss von Direktinvestitionen auf die Verhandlungsmacht von Unternehmen und Gewerkschaften
- Die Auswirkungen von verschiedenen Szenarien mit Direktinvestitionen (keine, wechselseitig, einseitig) auf die Lohn- und Beschäftigungsentwicklung
- Die Analyse von Verhandlungslösungen in verschiedenen Modellvarianten
- Die Bedeutung von Drohungen und Strategien im Verhandlungsprozess
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 bietet eine Einleitung in das Thema der Tarifverhandlungen in der Automobilindustrie und stellt den aktuellen Kontext der Krise in der Branche dar. Kapitel 2 erläutert das Konzept des Nash-Gleichgewichts als theoretisches Modell für den Verhandlungsprozess. Kapitel 3 beschreibt die zentralen Annahmen des Modells und stellt verschiedene Szenarien mit Direktinvestitionen vor. Kapitel 4.1 analysiert das Modell ohne Direktinvestitionen, während Kapitel 4.2 und 4.3 die Auswirkungen von wechselseitigen und einseitigen Direktinvestitionen auf die Verhandlungsergebnisse beleuchten.
Schlüsselwörter
Tarifverhandlungen, Nash-Gleichgewicht, Direktinvestitionen, Gewerkschaften, Unternehmen, Verhandlungsmacht, Lohnentwicklung, Beschäftigung, Automobilindustrie, Spieltheorie, Drohungen, Strategien, Modellvarianten.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflussen Direktinvestitionen die Macht von Gewerkschaften?
Multinationale Unternehmen können mit der Verlagerung von Produktionsstätten drohen, was ihre Verhandlungsposition gegenüber nationalen Gewerkschaften stärkt.
Was ist das Nash-Gleichgewicht in Tarifverhandlungen?
Es beschreibt eine Spielsituation, in der kein Verhandlungspartner seine Position durch einseitige Änderung verbessern kann, was oft zu einem Kompromiss bei Lohn und Beschäftigung führt.
Warum drohte VW mit dem Abbau von 30.000 Arbeitsplätzen?
Im Rahmen der Tarifrunde 2004 nutzte das Management die schlechte Ertragslage und die Option der Auslandsverlagerung als Druckmittel gegen die Forderungen der IG Metall.
Was ist der Unterschied zwischen wechselseitigen und asymmetrischen Direktinvestitionen?
Wechselseitig bedeutet, Unternehmen investieren gegenseitig in die Märkte des anderen. Asymmetrisch heißt, ein Unternehmen investiert einseitig im Ausland, was die Verhandlungsmacht ungleich verteilt.
Können Gewerkschaften Lohnnullrunden verhindern?
Das hängt von ihrer Mobilisierungskraft und der Glaubwürdigkeit der Unternehmensdrohungen ab. In Krisenzeiten akzeptieren sie oft Nullrunden im Austausch für Beschäftigungsgarantien.
- Citar trabajo
- Nico Schmidt (Autor), 2003, Gewerkschaftsmacht und Direktinvestitionen , Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/69801