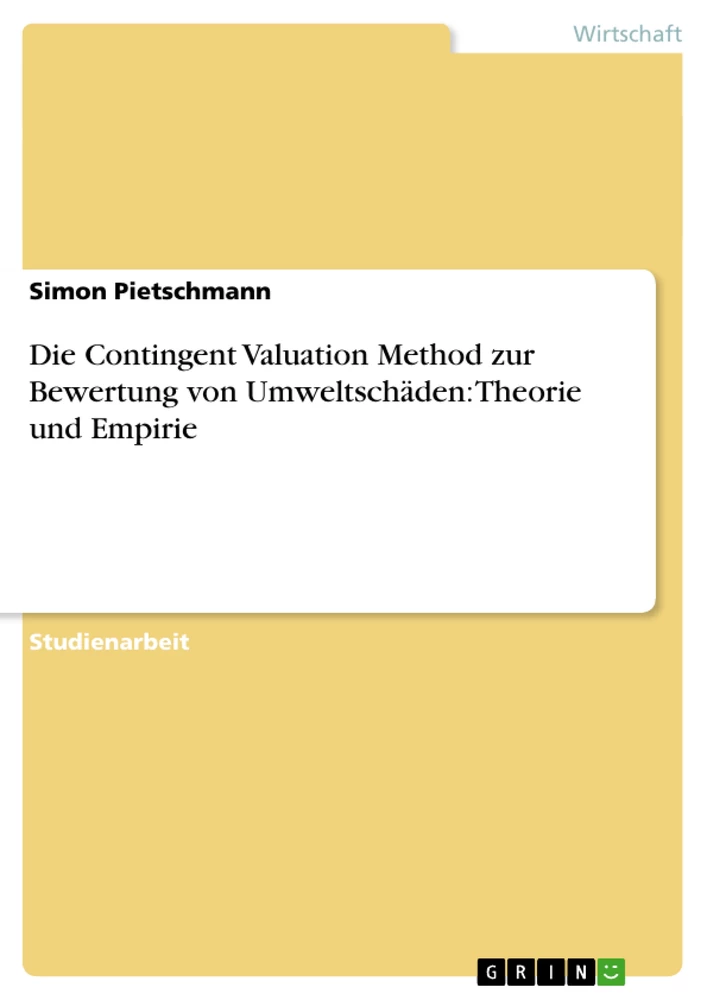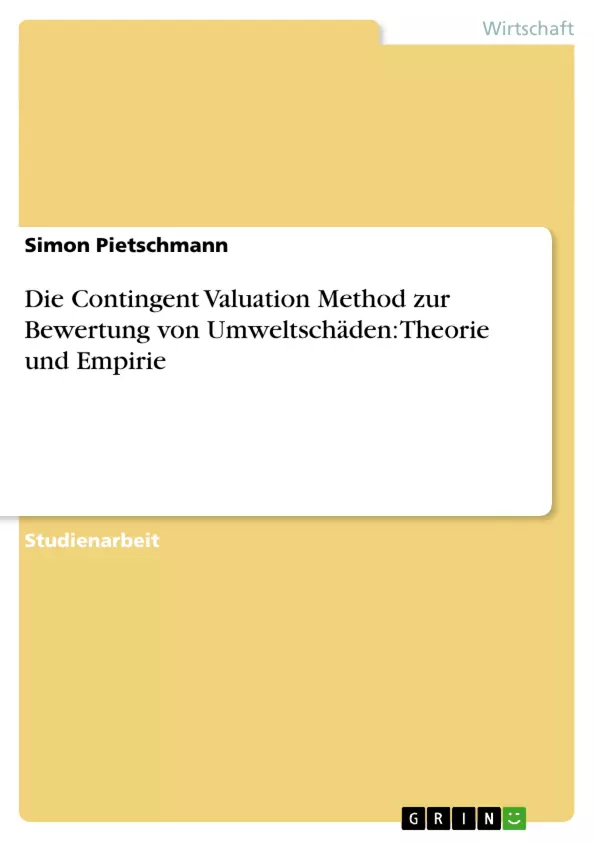Umweltkatastrophen, wie z.B. der Chemie-Unfall vor der chinesischen Millionenstadt Harbin 2005 oder der Exxon Valdez Tankerunfall von 1989, verdeutlichen im besonderen Maße eine anhaltende Übernutzung bzw. Zerstörung von Umweltressourcen. Diese lässt sich vielfach auf eine Ursache zurückzuführen: Umweltgüter stellen zwar für viele Menschen einen Wert dar, aber keinen Preis. Damit fehlt auf der einen Seite ein effizienter Lenkungsmechanismus im Umgang mit zunehmend knapper werdenden natürlichen Ressourcen, andererseits ein Maßstab für die Bewertung von Umweltschäden z.B. vor Gericht. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie der Wert der Umwelt bzw. materielle Schäden (Produktions-, Einkommens-und Vermögenseinbußen) und immaterielle Schäden (ästhetische Einbußen, abnehmendes Wohlbefinden) monetarisiert werden können. Im Folgenden soll mit der Contingent Valuation Method (CVM) ein Kurzüberblick über die gebräuchlichste und gleichzeitig auch flexibelste unter denjenigen Methoden gegeben werden, welche zur volkswirtschaftlichen Bewertung des Nutzens von Umweltgütern mit Öffentlichkeitscharakter eingesetzt werden. Im Fokus stehen dabei die historische Entwicklung, Aufbau und Struktur sowie Stärken und Schwächen der CVM. Zunächst sollen allerdings wesentliche wohlfahrtstheoretische Grundlagen skizziert werden.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- WOHLFAHRTSTHEORETISCHE GRUNDLAGEN
- CONTINGENT VALUATION METHOD
- Idee und historische Entwicklung
- Aufbau und Struktur
- Stärken und Schwächen
- FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit beleuchtet die Contingent Valuation Method (CVM) als Methode zur Bewertung von Umweltschäden. Ziel ist es, einen Überblick über die CVM zu geben und ihre Stärken und Schwächen aufzuzeigen. Dazu wird die historische Entwicklung, der Aufbau und die Struktur der CVM erläutert. Die Arbeit befasst sich zudem mit den wohlfahrtstheoretischen Grundlagen der CVM.
- Bewertung von Umweltschäden
- Contingent Valuation Method (CVM)
- Wohlfahrtstheoretische Grundlagen
- Nutzen von Umweltgütern
- Ökonomische Bewertung von Umweltveränderungen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Umweltbewertung ein und erläutert die Bedeutung der CVM als Instrument zur Bewertung von Umweltgütern mit Öffentlichkeitscharakter. Sie stellt den Aufbau und die Zielsetzung der Arbeit dar.
- Wohlfahrtstheoretische Grundlagen: Dieses Kapitel behandelt die theoretischen Grundlagen der Bewertung von Umweltschäden. Es werden verschiedene Wertkomponenten von Umweltgütern (Gebrauchswerte und Nichtgebrauchswerte) diskutiert und die Kompensationsmaße der Kompensierenden Variation (CV) und der Äquivalenten Variation (EV) vorgestellt.
- Contingent Valuation Method: Dieses Kapitel widmet sich der CVM als zentrale Methode zur Bewertung von Umweltschäden. Es werden die Idee und historische Entwicklung der CVM erläutert, sowie Aufbau und Struktur der Methode. Weiterhin werden die Stärken und Schwächen der CVM im Detail betrachtet.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Seminararbeit sind: Contingent Valuation Method (CVM), Umweltschäden, Wohlfahrtstheorie, Nutzen von Umweltgütern, Ökonomische Bewertung, Kompensierende Variation (CV), Äquivalente Variation (EV), ökonomischer Gesamtwert (Total Economic Value).
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Contingent Valuation Method (CVM)?
Die CVM ist eine ökonomische Methode zur Bewertung von Umweltgütern ohne Marktpreis. Dabei werden Menschen direkt nach ihrer Zahlungsbereitschaft für den Erhalt oder ihre Entschädigungsbereitschaft für den Verlust eines Umweltguts gefragt.
Warum müssen Umweltschäden monetarisiert werden?
Da Umweltgüter oft keinen Preis haben, fehlt ein Lenkungsmechanismus für ihren Schutz. Die Monetarisierung schafft einen Maßstab für Gerichte bei Schadensersatzforderungen und hilft bei der effizienten Nutzung knapper Ressourcen.
Was ist der Unterschied zwischen Gebrauchs- und Nichtgebrauchswerten?
Gebrauchswerte entstehen durch die direkte Nutzung (z.B. Holz aus dem Wald), während Nichtgebrauchswerte den Wert beschreiben, den Menschen einem Gut beimessen, ohne es selbst zu nutzen (z.B. Existenzwert einer bedrohten Tierart).
Was sind die Stärken der CVM?
Sie ist die flexibelste Methode, da sie als einzige auch Nichtgebrauchswerte (immaterielle Schäden wie ästhetische Einbußen) erfassen kann und für fast alle öffentlichen Umweltgüter anwendbar ist.
Welche Schwächen hat die Contingent Valuation Method?
Kritisiert werden oft hypothetische Verzerrungen (Probanden geben andere Werte an als sie tatsächlich zahlen würden) sowie die Komplexität der Befragungsdesigns, die zu ungenauen Ergebnissen führen können.
- Citar trabajo
- Simon Pietschmann (Autor), 2006, Die Contingent Valuation Method zur Bewertung von Umweltschäden: Theorie und Empirie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/69804