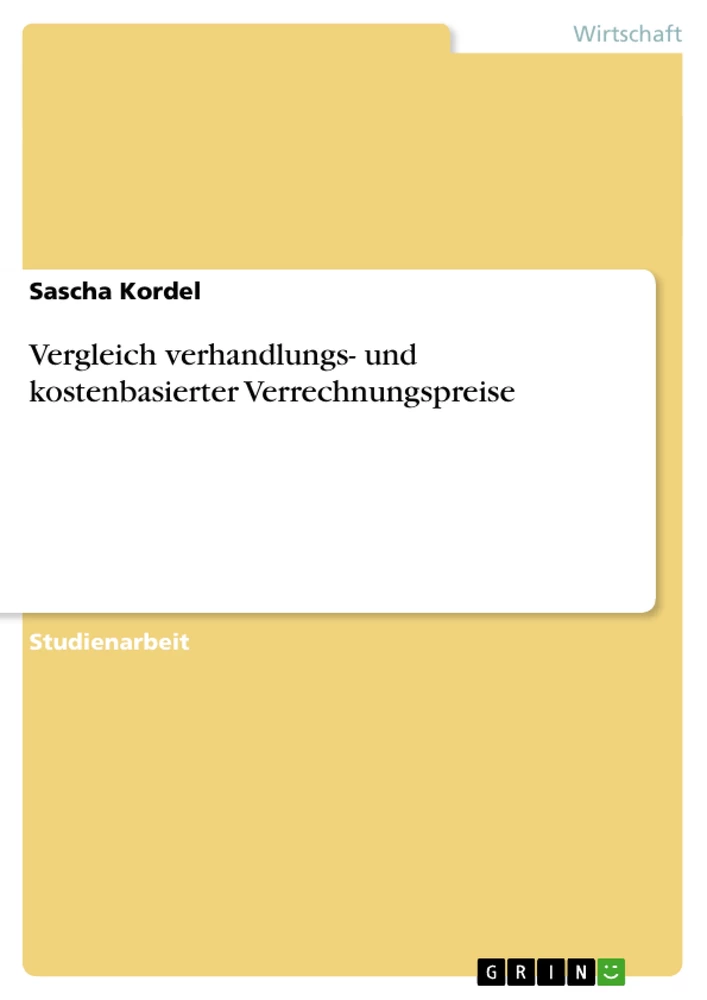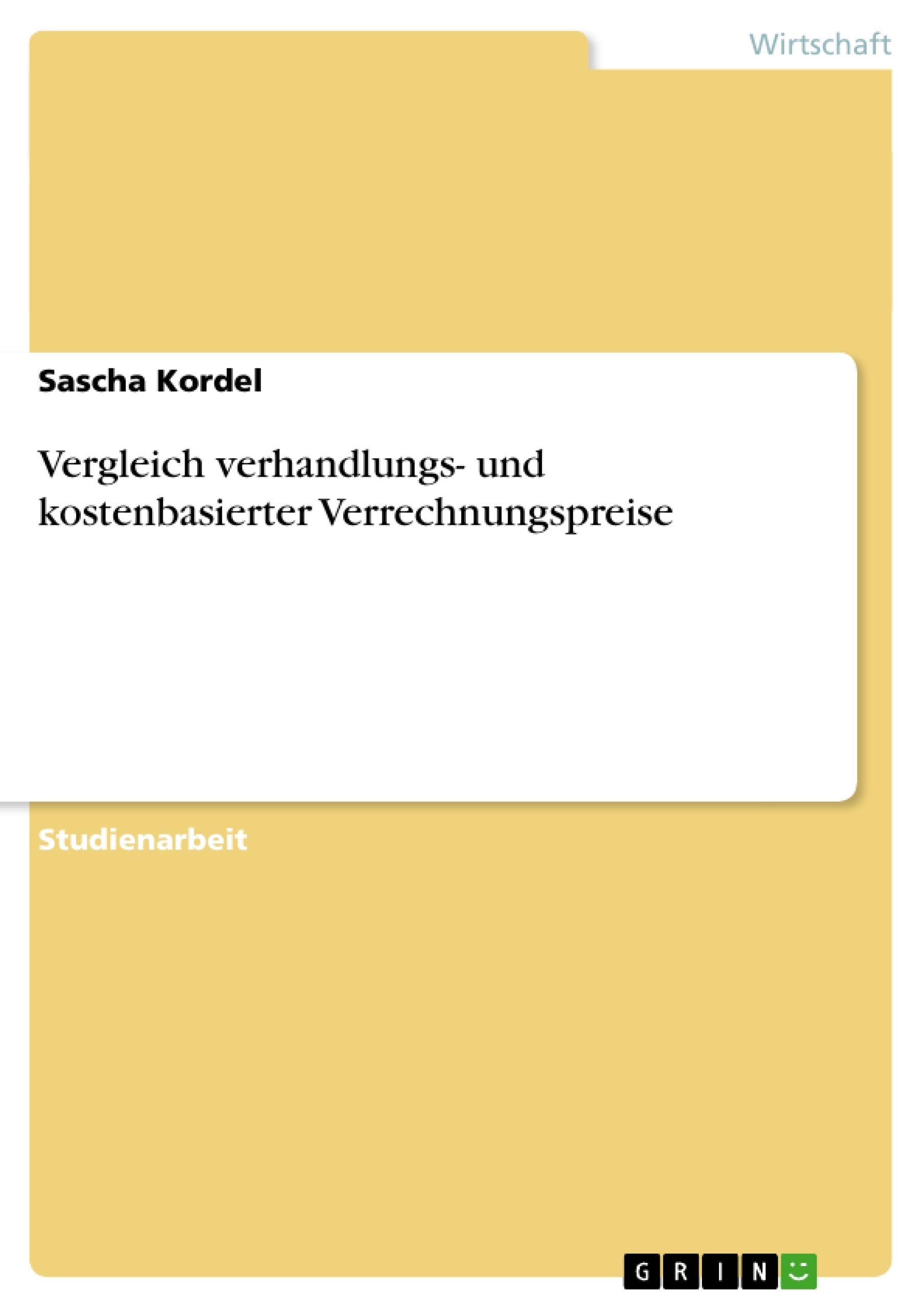Eines der wichtigsten Instrumente der dezentralen Unternehmenssteuerung stellen Verrechnungspreise dar. Sie werden für Produkte oder Leistungen gebildet, die zwischen verschiedenen Teilbereichen eines Unternehmens ge-handelt werden.
In der vorliegenden Arbeit wird insbesondere Bezug auf die Untersuchung der Autoren Tim Baldenius, Stefan Reichelstein und Savita A. Sahay von 1999 genommen. Sie analysierten kostenbasierte und verhandelte Verrechnungspreismechanismen im Hinblick auf ihre Leistungsfähigkeit. Dabei muss beachtet werden, dass jeder Mechanismus Effizienzverluste mit sich bringt. Diese resultieren z.B. aus dem Informationsvorsprung hinsichtlich der tatsächlich anfallenden Kosten, zeit- und kostenintensiver Verhandlungen oder Unterinvestitionsproblemen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Modell
- Verhandelte Verrechnungspreise
- Kostenbasierte Verrechnungspreise
- Vergleich der Verrechnungspreismechanismen
- Investition der Verkaufsabteilung
- Investition der Einkaufsabteilung
- Investitionen in beiden Abteilungen
- Erweiterungen
- Asymmetrische Informationsverteilung
- Investition der Verkaufsabteilung
- Investition der Einkaufsabteilung
- Zusammenfassung
- Beschränkung bei kostenbasierten Verrechnungspreisen
- Zweiteilige Verrechnungspreise
- Asymmetrische Informationsverteilung
- Resultat
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Vergleich verhandlungsbasierter und kostenbasierter Verrechnungspreismechanismen im Kontext dezentraler Unternehmenssteuerung. Die Studie analysiert die Leistungsfähigkeit dieser Mechanismen anhand eines Modells, das zwei Abteilungen mit spezifischen Investitionsmöglichkeiten und unterschiedlichen Informationsständen berücksichtigt. Ziel ist es, die Effizienzverluste zu identifizieren, die aus den jeweiligen Verrechnungsprinzipien resultieren, und die Auswirkungen auf die Investitionsentscheidungen der Abteilungen zu untersuchen.
- Analyse der Effizienzverluste, die durch verhandlungsbasierte und kostenbasierte Verrechnungspreise entstehen
- Untersuchung der Auswirkungen der Verrechnungspreismechanismen auf die Investitionsentscheidungen der Abteilungen
- Beurteilung der Leistungsfähigkeit der beiden Verrechnungsprinzipien im Hinblick auf den Netto-Unternehmenserfolg
- Einbezug von Informationsasymmetrien und Beschränkungen bei kostenbasierten Verrechnungspreisen
- Analyse des Einflusses von zweiten Verrechnungspreisen auf die Effizienz und die Investitionsanreize
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Verrechnungspreise als wichtiges Instrument der dezentralen Unternehmenssteuerung ein und erläutert die grundlegende Struktur des Modells, das in der Arbeit verwendet wird. Kapitel 1 stellt die beiden Verrechnungspreismechanismen - verhandelte und kostenbasierte - im Detail vor und erklärt die Funktionsweise sowie die jeweiligen Vor- und Nachteile. Kapitel 2 vergleicht die Leistungsfähigkeit der beiden Mechanismen anhand verschiedener Szenarien, wobei die Auswirkungen auf die Investitionsentscheidungen der Abteilungen im Vordergrund stehen. Kapitel 3 befasst sich mit Erweiterungen des Modells, insbesondere mit der Berücksichtigung von Informationsasymmetrien und Beschränkungen bei kostenbasierten Verrechnungspreisen. Schließlich beleuchtet Kapitel 4 die wichtigsten Ergebnisse der Analyse und diskutiert die Implikationen für die Praxis der dezentralen Unternehmensführung.
Schlüsselwörter
Verrechnungspreise, dezentrale Unternehmenssteuerung, verhandlungsbasierte Verrechnungspreise, kostenbasierte Verrechnungspreise, Effizienzverluste, Investitionsanreize, Informationsasymmetrie, Hold-up-Problem, zweiteilige Verrechnungspreise.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Verrechnungspreise?
Verrechnungspreise sind Preise für Produkte oder Leistungen, die intern zwischen verschiedenen Abteilungen oder Teilbereichen eines Unternehmens gehandelt werden.
Welche zwei Mechanismen werden in dieser Arbeit verglichen?
Die Arbeit vergleicht verhandlungsbasierte Verrechnungspreise mit kostenbasierten Verrechnungspreisen hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit.
Warum kommt es bei Verrechnungspreisen zu Effizienzverlusten?
Verluste resultieren oft aus Informationsasymmetrien (Wissen über tatsächliche Kosten), zeitintensiven Verhandlungen oder dem sogenannten Hold-up-Problem.
Welchen Einfluss haben Verrechnungspreise auf Investitionen?
Die Wahl des Preismechanismus beeinflusst die Investitionsanreize sowohl der Verkaufs- als auch der Einkaufsabteilung und damit den Gesamterfolg des Unternehmens.
Was ist ein zweiteiliger Verrechnungspreis?
Es handelt sich um eine Erweiterung des Modells, die analysiert wird, um Effizienz und Investitionsanreize in dezentralen Strukturen zu optimieren.
- Quote paper
- Sascha Kordel (Author), 2006, Vergleich verhandlungs- und kostenbasierter Verrechnungspreise, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/69812