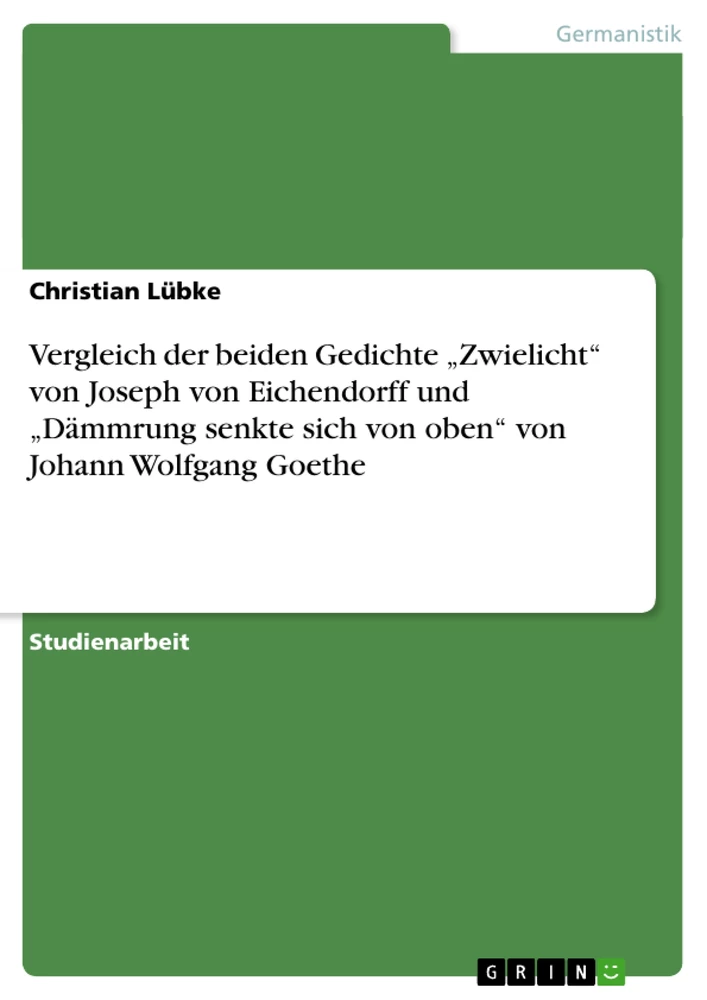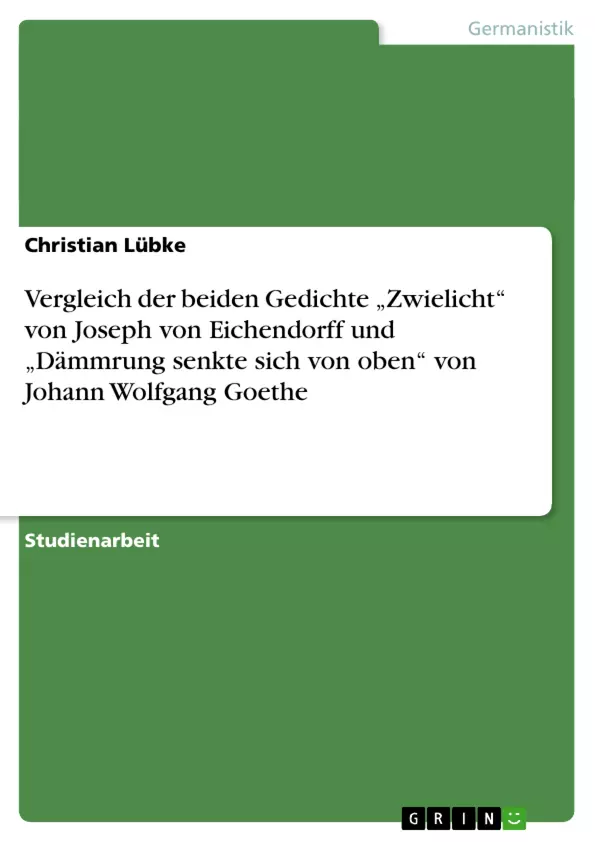Die Epoche der Romantik erstreckte sich ungefähr über den Zeitraum von 1798 bis 1835 und wurde in die Frühromantik, Hochromantik und Spätromantik eingeteilt. „Die romantische Lyrik war geprägt von einer volksliedhaften Einfachheit und einem Höchstmaß an sprachlicher Kunst sowie der von Goethe eingeleiteten Natur- und Erlebnislyrik“.
Johann Wolfgang Goethe und Joseph von Eichendorff zählen zu den bekanntesten Vertretern dieser literarischen Epoche.
Eichendorff prägte besonders die sogenannten Stimmungsgedichte der klassischromantischen Tradition, welche besonders gefühlsbetont und voller lyrischer Stimmungen sind.
„Im Vordergrund romantischer Dichtungen standen Stimmungen, Gefühle und
Erlebnisse“.
Damit verbunden waren Motive der Mythologie, welche noch in der Aufklärung
angezweifelt worden waren, der Märchen, der Träume, des Wanderns und der Nacht. Die Romantik stellte eine Reaktion der Seele gegen das Primat des Intellekts der Aufklärung und Klassik dar.
So müsste man die Weltanschauung innerhalb der Romantik beschreiben. Es lassen sich noch viele weitere Motive nennen, doch diese sind in Bezug auf die Interpretation der beiden Gedichte von Goethe und Eichendorff besonders wichtig Es beginnt mit der Interpretation des Gedichts „Zwielicht“ von Joseph von Eichendorff, welches um 1811 entstanden ist.
Danach folgt eine Betrachtung von Goethes „Dämmerung senkte sich von oben“ von
1830. Das Ende des Hauptteils vergleicht beide Gedichte miteinander und stellt die wichtigsten Unterschiede in Bezug auf die Dämmerung dar. Die Schlussbetrachtung fasst letztendlich nochmals alle Ergebnisse zusammen.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Hauptteil
- 1. Joseph von Eichendorffs „Zwielicht“
- a) Die äußere Form
- b) Interpretation des Gedichts
- (1) Die erste Strophe
- (2) Die zweite Strophe
- (3) Die dritte Strophe
- (4) Die vierte Strophe
- 2. Johann Wolfgang Goethes „Dämmrung senkte sich von oben“
- a) Die äußere Form
- b) Interpretation des Gedichts
- (1) Die erste Strophe
- (2) Die zweite Strophe
- 3. Vergleich beider Gedichte in Bezug auf die Darstellung der Dämmerung
- 1. Joseph von Eichendorffs „Zwielicht“
- C. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, einen Vergleich der Gedichte „Zwielicht“ von Joseph von Eichendorff und „Dämmrung senkte sich von oben“ von Johann Wolfgang Goethe vorzunehmen. Der Fokus liegt auf der Analyse der Darstellung der Dämmerung in beiden Gedichten und deren Einordnung in den Kontext der Romantik.
- Darstellung der Dämmerung als zentrales Bildmotiv
- Vergleich der formalen Gestaltung beider Gedichte
- Interpretation der jeweiligen poetischen Sprache und Bildsprache
- Einordnung der Gedichte in den Kontext der Romantik
- Untersuchung der jeweiligen Stimmung und Atmosphäre
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt den historischen Kontext der Romantik, in dem beide Gedichte entstanden sind. Sie benennt Goethe und Eichendorff als wichtige Vertreter dieser Epoche und hebt die Bedeutung von Stimmung, Gefühl und Erlebnis in der romantischen Lyrik hervor. Die Einleitung skizziert kurz den Aufbau der Arbeit, der sich auf die Interpretation beider Gedichte und deren Vergleich konzentriert.
B. Hauptteil: Der Hauptteil ist in drei Abschnitte untergliedert. Der erste Abschnitt analysiert Eichendorffs „Zwielicht“ hinsichtlich seiner äußeren Form (Strophenbau, Reimschema, Versmaß) und seiner inneren Struktur. Die Interpretation konzentriert sich auf die einzelnen Strophen und deren Bildsprache, um die Stimmung des Gedichts zu ergründen. Der zweite Abschnitt wendet sich Goethes „Dämmrung senkte sich von oben“ zu, indem er ebenfalls die äußere Form und die Interpretation der einzelnen Strophen im Detail betrachtet. Die Analyse beleuchtet die spezifischen sprachlichen Mittel und die von Goethe erzeugte Atmosphäre. Der dritte Abschnitt schließlich vergleicht beide Gedichte, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede in ihrer Darstellung der Dämmerung herauszuarbeiten und die jeweiligen poetischen Strategien der Autoren zu kontrastieren. Beide Interpretationen berücksichtigen die typischen Merkmale der romantischen Lyrik.
Schlüsselwörter
Romantik, Lyrik, Gedichtinterpretation, Joseph von Eichendorff, Johann Wolfgang Goethe, „Zwielicht“, „Dämmrung senkte sich von oben“, Dämmerung, Stimmung, Atmosphäre, Bildsprache, Formale Gestaltung, Vergleichende Analyse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Vergleich der Gedichte "Zwielicht" und "Dämmrung senkte sich von oben"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese akademische Arbeit vergleicht die Gedichte "Zwielicht" von Joseph von Eichendorff und "Dämmrung senkte sich von oben" von Johann Wolfgang Goethe. Der Fokus liegt auf der Analyse der Darstellung der Dämmerung in beiden Gedichten und ihrer Einordnung in den Kontext der Romantik. Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, einen Hauptteil mit detaillierten Gedichtinterpretationen und einen Schluss. Sie enthält außerdem ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter.
Welche Gedichte werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht "Zwielicht" von Joseph von Eichendorff und "Dämmrung senkte sich von oben" von Johann Wolfgang Goethe. Beide Gedichte behandeln das Thema Dämmerung und sind repräsentativ für die romantische Lyrik.
Welche Aspekte der Gedichte werden analysiert?
Die Analyse umfasst die äußere Form (Strophenbau, Reimschema, Versmaß), die Interpretation der einzelnen Strophen und deren Bildsprache, die Stimmung und Atmosphäre, die poetische Sprache, und die Einordnung der Gedichte in den Kontext der Romantik. Ein wichtiger Vergleichspunkt ist die Darstellung der Dämmerung als zentrales Bildmotiv.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Hauptteil und einen Schluss. Der Hauptteil analysiert zunächst jedes Gedicht einzeln (äußere Form und detaillierte Interpretation jeder Strophe) und vergleicht sie dann in Bezug auf ihre Darstellung der Dämmerung. Die Einleitung stellt den Kontext und die Zielsetzung dar, während der Schluss die Ergebnisse zusammenfasst.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, einen detaillierten Vergleich der beiden Gedichte hinsichtlich ihrer Darstellung der Dämmerung vorzunehmen und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede in der poetischen Strategie der beiden Autoren herauszuarbeiten. Die Einordnung der Gedichte in den Kontext der Romantik spielt dabei eine zentrale Rolle.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Romantik, Lyrik, Gedichtinterpretation, Joseph von Eichendorff, Johann Wolfgang Goethe, "Zwielicht", "Dämmrung senkte sich von oben", Dämmerung, Stimmung, Atmosphäre, Bildsprache, Formale Gestaltung, Vergleichende Analyse.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke bestimmt und dient der Analyse literarischer Themen in strukturierter und professioneller Weise. Sie ist insbesondere für Studenten der Literaturwissenschaft relevant.
- Quote paper
- Christian Lübke (Author), 2007, Vergleich der beiden Gedichte „Zwielicht“ von Joseph von Eichendorff und „Dämmrung senkte sich von oben“ von Johann Wolfgang Goethe , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/69879