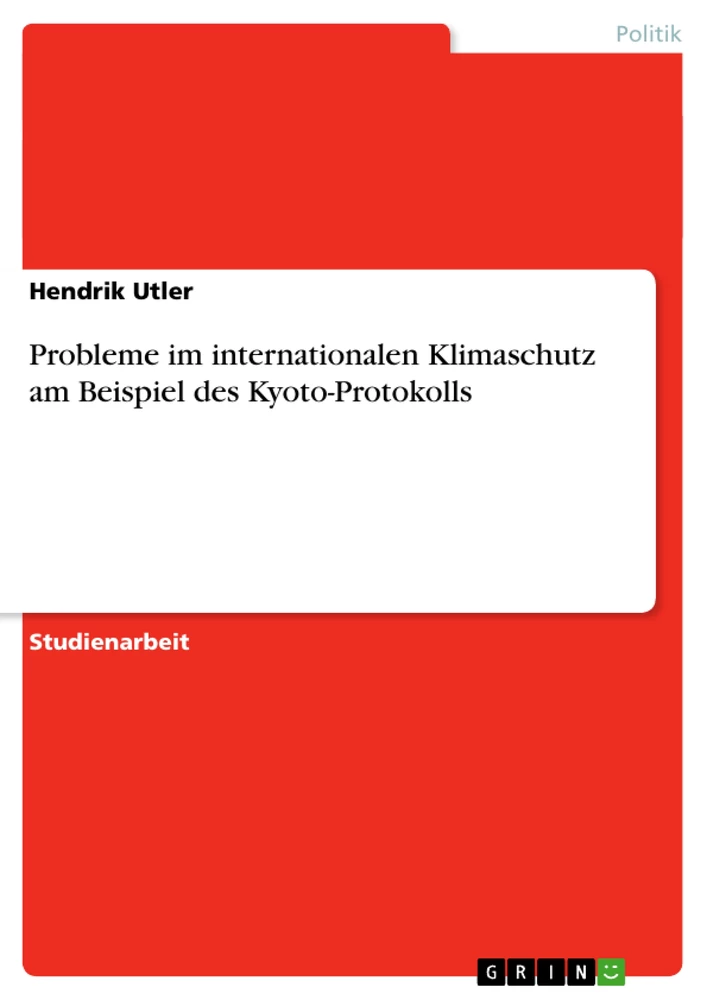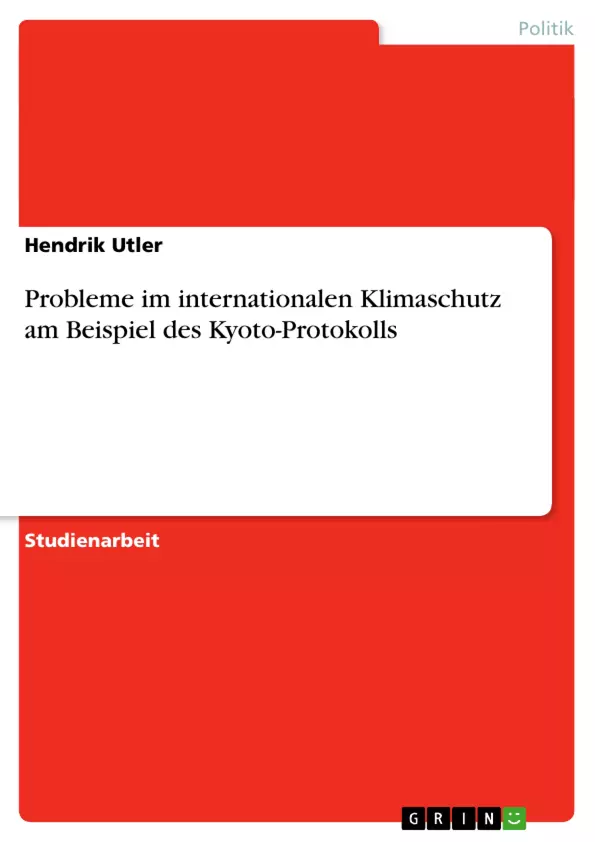This is a story about four people: Everbody, Somebody, Anybody and Nobody. There was an important job to be done and Everybody was asked to do it. Everybody was sure Somebody would do it. Anybody could have done it, but Nobody did it. Somebody got angry about that because it was Everybody’s job. Everybody thought Anybody could do it, but Nobody realized that Everybody wouldn’t do it. It ended up that Everybody blamed Somebody when actually Nobody asked Anybody. (Nach “Josef Wandeler” Zürich, zitiert nach Simonis 1992, S.171) Diese Worte spiegeln anschaulich das Dilemma wider, in dem sich der internationale Klimaschutz Anfang des 21. Jahrhunderts befindet. Die Ursachen und Folgen des anthropogenen Treibhauseffektes sind bekannt und es steht fest, dass nur eine globale Klimapolitik in der Lage ist, dem Problem des Klimawandels effektiv entgegenzutreten. Darüber, wie dies geschehen soll, tagt die Welt seit Jahren auf Weltklimakonferenzen und in Expertenrunden. Sie stellt sich damit ihrer bisher wohl größten Aufgabe und - scheitert? Obwohl Ursachen wie Folgen des Klimawandels so offensichtlich wie ermahnend sind, findet auf internationaler Ebene noch kein unumstritten effektiver Klimaschutz statt. Es scheint, als stünde die internationale Staatengemeinschaft vor einem unlösbaren Problem. Doch was ist es, das internationale Kooperation zum Klimaschutz so schwierig macht? Warum funktioniert das Kyoto-Protokoll nicht richtig? Die vorliegende Arbeit versucht, diese Frage auf der Basis der grundlegenden Problematik internationaler Kooperation zu beantworten. Als theoretischer Ausgangspunkt dient das Gefangenen-Dilemma, das in Kapitel 2 besprochen wird. Nachdem aufgezeigt wurde, worin das Dilemma besteht, folgt in Kapitel 3 eine Beschreibung von Garret Hardins Tragik der Allmende, um die Problematik im Umgang mit Kollektivgütern, wie der Erdatmosphäre zu veranschaulichen. Aus dieser Betrachtung erschließt sich das Dilemma zwischen individuell rationalem Handeln und kollektiv rationalem Handeln sowie das Problem des Trittbrettfahrens. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Gefangenen-Dilemma
- Die Tragik der Allmende
- Regime
- Das Kyoto-Protokoll
- Der Weg zum Kyoto-Protokoll
- Die Bestimmungen des Kyoto-Protokolls
- Probleme des Kyoto-Protokolls
- Interessenpluralismus
- Das Trittbrettfahrerproblem
- Problematische Weichenstellungen
- Ergebnis und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Problematik des internationalen Klimaschutzes und analysiert die Ursachen für die Schwierigkeiten bei der internationalen Kooperation in diesem Bereich, insbesondere im Hinblick auf das Kyoto-Protokoll. Die Arbeit zeigt die grundlegenden Problematiken internationaler Kooperation anhand des Gefangenen-Dilemmas und der Tragik der Allmende auf, bevor sie auf die Rolle von Regimen und das Kyoto-Protokoll als Beispiel für ein internationales Regime eingeht.
- Das Gefangenen-Dilemma und die Herausforderungen der internationalen Kooperation
- Die Tragik der Allmende und das Problem des Trittbrettfahrens
- Regime als Mechanismus zur Bewältigung von internationalen Problemen
- Das Kyoto-Protokoll als Beispiel für ein internationales Regime zum Klimaschutz
- Die Probleme bei der Umsetzung des Kyoto-Protokolls
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt das Problem des internationalen Klimaschutzes ein und verdeutlicht die Bedeutung des Themas anhand des bekannten Dilemmas „Everybody, Somebody, Anybody, Nobody“. Kapitel 2 erläutert das Gefangenen-Dilemma als theoretisches Modell für die Problematik der internationalen Kooperation. Kapitel 3 beschreibt die Tragik der Allmende von Garrett Hardin, die das Problem der Nutzung gemeinsamer Ressourcen verdeutlicht und die Herausforderungen im Umgang mit Kollektivgütern wie der Erdatmosphäre beleuchtet. Kapitel 4 stellt Regime als Instrument zur Bewältigung internationaler Probleme vor und erläutert die Regimedefinition nach Krasner sowie grundlegende Annahmen der Regimetheorie.
Kapitel 5 führt das Kyoto-Protokoll als Beispiel für ein internationales Regime und als Stellvertreter für die Bemühungen zum Klimaschutz ein. Es gibt einen Überblick über die Entstehung des Protokolls und seine wichtigsten Inhalte. Kapitel 6 befasst sich mit den Problemen bei der Umsetzung des Kyoto-Protokolls. Es analysiert den Interessenpluralismus der Staaten und untersucht, wie das Protokoll das Trittbrettfahrerproblem zu verhindern versucht. Darüber hinaus beleuchtet das Kapitel problematische Weichenstellungen des Protokolls.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den folgenden Schlüsselbegriffen und Themenbereichen: internationales Klimapolitik, Kyoto-Protokoll, Gefangenen-Dilemma, Tragik der Allmende, Regimetheorie, Interessenpluralismus, Trittbrettfahrerproblem, internationale Kooperation, Kollektivgut.
Häufig gestellte Fragen zum Kyoto-Protokoll & Klimaschutz
Warum ist internationale Kooperation beim Klimaschutz so schwierig?
Die Arbeit erklärt dies anhand des Gefangenen-Dilemmas: Individuell rationales Handeln steht oft im Widerspruch zum kollektiv rationalen Handeln.
Was versteht man unter der „Tragik der Allmende“?
Das Konzept von Garrett Hardin beschreibt die Übernutzung gemeinsamer Ressourcen (wie der Erdatmosphäre), wenn kein wirksames Management vorhanden ist.
Was ist das Trittbrettfahrerproblem im Klimaschutz?
Staaten profitieren von den Klimaschutzbemühungen anderer, ohne selbst die Kosten für Reduktionsmaßnahmen tragen zu wollen.
Welche Rolle spielen „Regime“ in der internationalen Politik?
Regime sind Mechanismen (Regeln, Normen), die Staaten helfen, Kooperationsprobleme bei Kollektivgütern wie dem Klima zu bewältigen.
Welche Probleme führten zum Scheitern des Kyoto-Protokolls?
Zentrale Probleme waren der Interessenpluralismus der Staaten, problematische Weichenstellungen und das mangelnde Verhindern von Trittbrettfahren.
- Arbeit zitieren
- Hendrik Utler (Autor:in), 2007, Probleme im internationalen Klimaschutz am Beispiel des Kyoto-Protokolls, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/69884