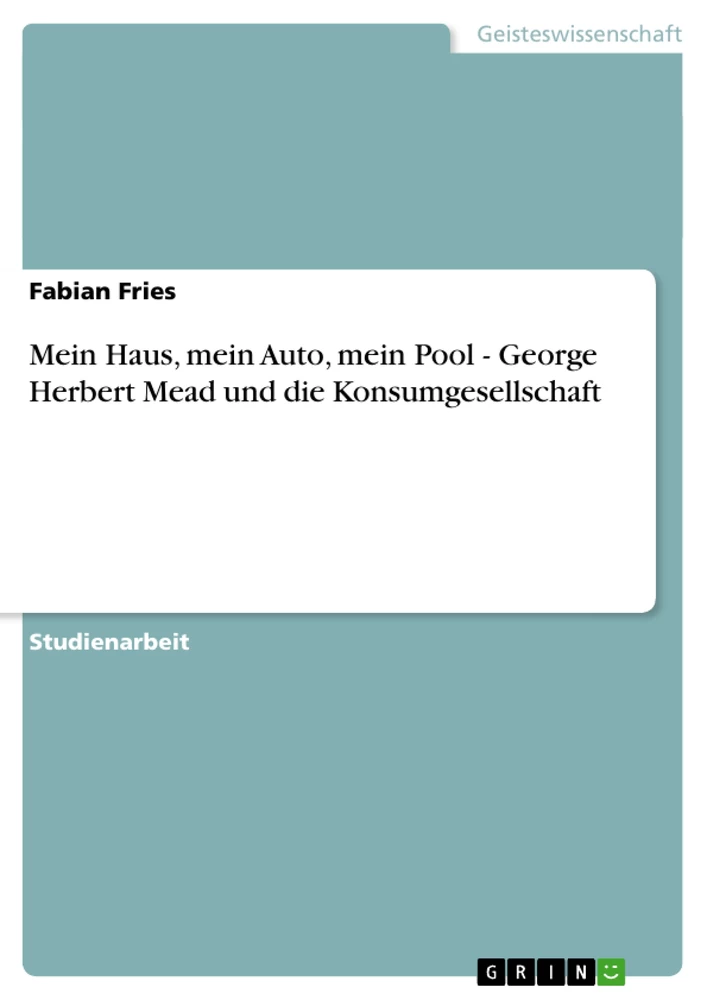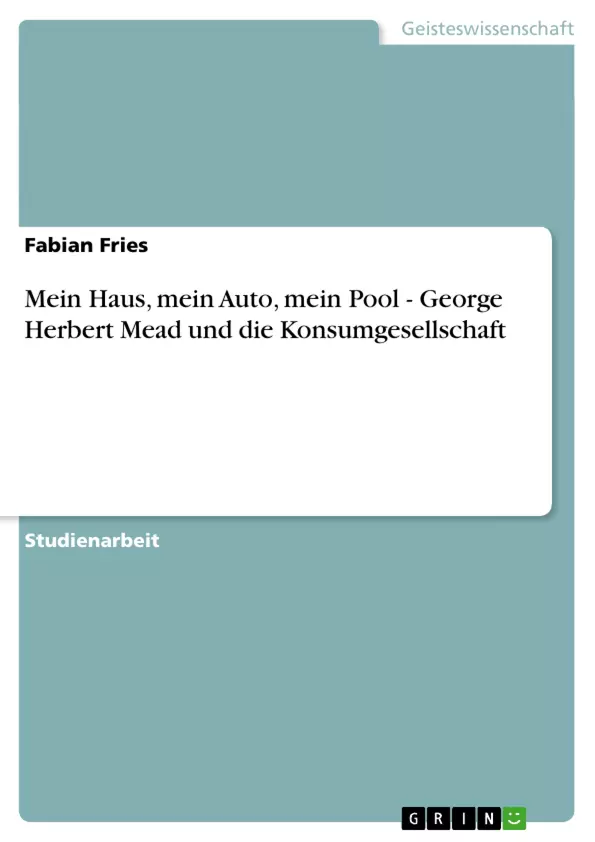Laut der darwinistischen Evolutionslehre hat alles Leben auf dieser Erde einen einzigen gemeinsamen Ursprung. Mittels Mutationen und „natürlicher Auslese“ entwickelte sich so eine Vielzahl von Lebensformen, die sich den spezifischen Anforderungen ihrer Umwelt immer wieder von Neuem anpassten.
Auch die Genese des Menschen lässt sich nach dieser Theorie bis zur prähistorischen „Ursuppe“ zurückverfolgen. Trotz aller Gemeinsamkeiten - homo sapiens „hat eine eigenartige Stellung im Tierreich“4: Als hoch entwickeltes Säugetier verfügt er über einen vergleichsweise unterentwickelten Instinktapparat. Instinkte sowie deren Weiterentwicklung sichern jedoch die Anpassung an die jeweilige Umwelt und somit letztlich das Überleben einer Spezies. Seine Instinktarmut hinderte den Menschen aber nicht daran, sich auf der gesamten Erde erfolgreich einzurichten. Folglich ist er nicht an eine „artspezifische Umwelt“ gebunden - er hat offenbar andere Techniken gefunden, um auf der Erde nicht nur zu überleben, sondern sie mehr oder minder als sein eigen zu reklamieren. Eine weiteres Unikum findet sich in der menschlichen Physiologie: Eine S-förmige Wirbelsäule sorgt u. a. dafür, dass der Körperschwerpunkt oberhalb der Füße liegt. Das befähigt den Menschen zur bipeden Fortbewegung und er muss seine Hände nicht mehr dazu benutzen, sein Körpergewicht abzustützen. Die nunmehr „freigewordenen“ Gliedmaßen können anderweitig eingesetzt werden. Darüber hinaus versetzt die funktionell weiterentwickelte Hand mit einem opponierbaren Daumen den Menschen in die Lage, Gegenstände zu greifen, Werkzeuge zu benutzen, Hausarbeiten zu tippen - kurzum: sich die Welt Untertan zu machen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: Die Sonderstellung des Menschen
- 2. Meads geistesgeschichtliche Stellung
- 3. Das Konzept symbolvermittelter Interaktion
- 4. Die Genesis der Identität
- 5. Das Markenimage volkswirtschaftlicher Güter – Prestige als intersubjektiv konstituiertes Symbol
- 6. Fazit: Die Pragmatik symbolischer Interaktion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die theoretischen Überlegungen von George Herbert Mead und deren Bedeutung für die Praxis. Dabei liegt der Fokus auf dem Konzept der symbolvermittelten Interaktion und seiner Anwendung auf die Entstehung menschlicher Identität.
- Die Sonderstellung des Menschen in der Natur
- Meads sozialpsychologische Theorie der Selbstreflexivität
- Das Konzept der symbolvermittelten Interaktion als Funktionsprinzip menschlichen Verhaltens
- Die Genesis menschlicher Identität im Prozess der Sozialisation
- Die Relevanz von Meads Theorie für das Verständnis der Konsumgesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Sonderstellung des Menschen: Dieses Kapitel beleuchtet die einzigartige Stellung des Menschen in der Tierwelt, die durch seine Instinktarmut, seine Fähigkeit zur bipeden Fortbewegung und seine Fähigkeit zur Kulturkreation geprägt ist.
- Kapitel 2: Meads geistesgeschichtliche Stellung: Dieses Kapitel skizziert die wissenschaftlichen Strömungen, aus denen Mead seine Theorie der menschlichen Evolution synthetisiert hat.
- Kapitel 3: Das Konzept symbolvermittelter Interaktion: Dieses Kapitel erklärt das Konzept der symbolvermittelten Interaktion, die Mead als genuin menschlichen Typus des Sozialverhaltens betrachtet.
- Kapitel 4: Die Genesis der Identität: Dieses Kapitel untersucht, wie Mead anhand eines zweiphasigen Modells kindlichen Spiels die allmähliche Herausbildung der Persönlichkeitsinstanzen „I“ und „Me“ erklärt.
- Kapitel 5: Das Markenimage volkswirtschaftlicher Güter – Prestige als intersubjektiv konstituiertes Symbol: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung des Konsums in der modernen Gesellschaft und wie Prestige als Symbolwert für Güter in Prozessen sozialer Interaktion konstituiert wird.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen der soziologischen Theorie, insbesondere mit George Herbert Meads Konzept des symbolischen Interaktionismus. Wichtige Begriffe sind: Selbstreflexivität, symbolvermittelte Interaktion, Sozialisation, Identität, Konsum, Prestige, Markenimage.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht George Herbert Mead unter symbolvermittelter Interaktion?
Dies ist ein Funktionsprinzip menschlichen Verhaltens, bei dem Handlungen durch Symbole (wie Sprache oder Gesten) vermittelt werden, was eine gemeinsame Sinnstiftung ermöglicht.
Wie entstehen laut Mead "I" und "Me"?
Die Identität entwickelt sich in zwei Phasen: Das "Me" repräsentiert die verinnerlichten gesellschaftlichen Erwartungen, während das "I" die spontane, impulsive Antwort des Individuums darauf ist.
Welche Rolle spielt der Konsum in Meads Theorie?
Die Arbeit wendet Meads Konzept auf die Konsumgesellschaft an und zeigt, wie Marken und Güter als intersubjektiv konstituierte Symbole für Prestige und Identität dienen.
Warum hat der Mensch eine Sonderstellung im Tierreich?
Mead und der Autor verweisen auf die Instinktarmut des Menschen, die durch Kultur, Sprache und die Fähigkeit zur Werkzeugbenutzung (begünstigt durch den aufrechten Gang) kompensiert wird.
Was bedeutet Sozialisation bei Mead?
Sozialisation ist der Prozess, in dem das Kind durch Rollenspiele ("Play" und "Game") lernt, die Perspektive anderer einzunehmen und so ein stabiles Selbstbild entwickelt.
- Quote paper
- Fabian Fries (Author), 2005, Mein Haus, mein Auto, mein Pool - George Herbert Mead und die Konsumgesellschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/69894