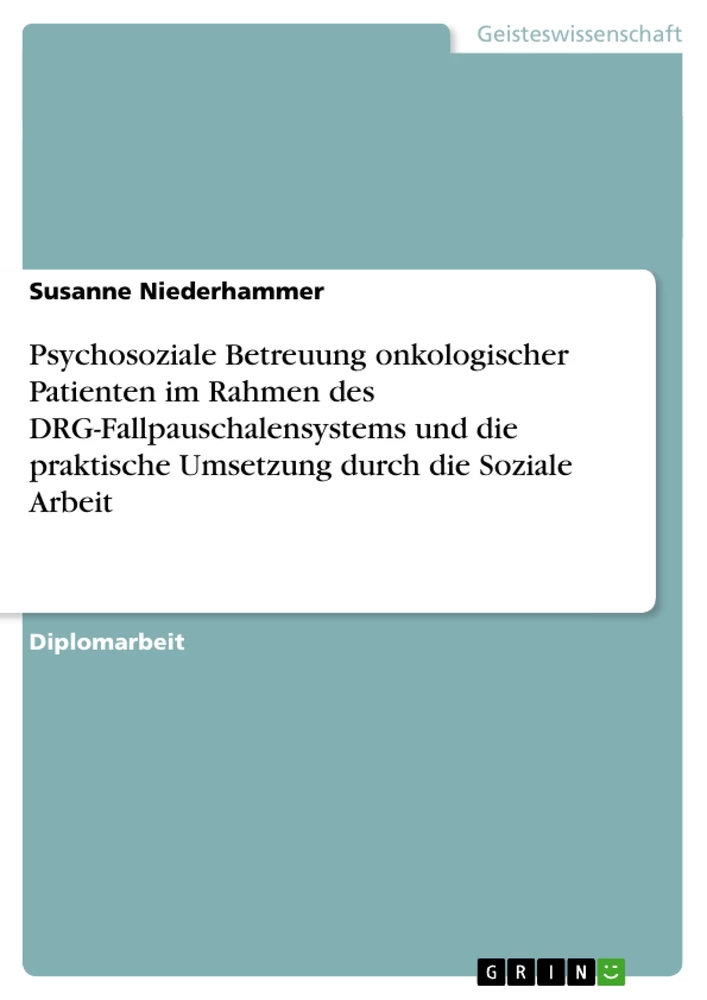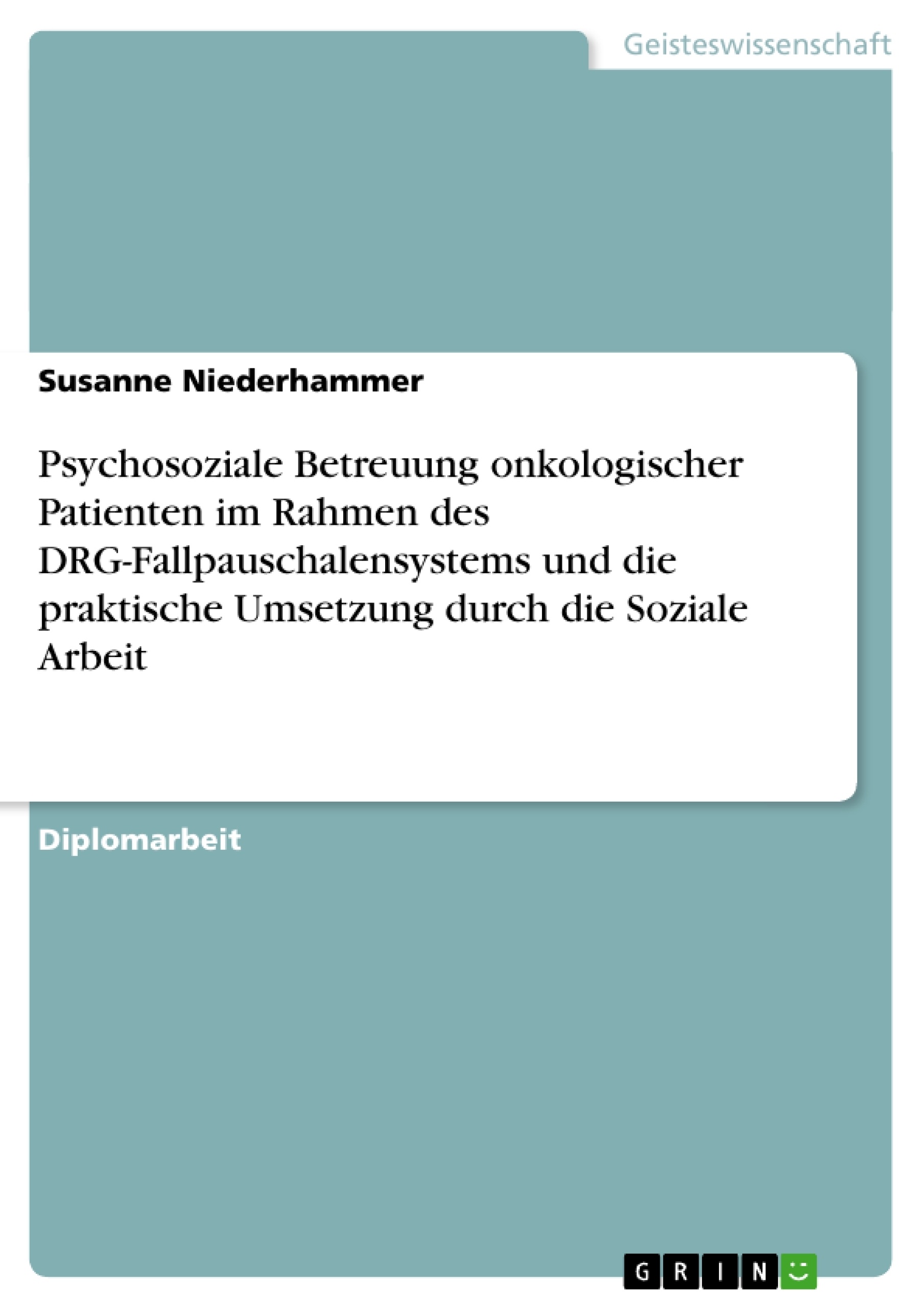Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der psychosozialen Versorgung krebskranker Patienten im Akutkrankenhaus. Diese hat sich unter den, 2004 endgültig eingeführten, DRG-Bedingungen erneut verkompliziert. Deshalb soll der Einfluss, den das DRG-Abrechnungssystem auf die Umsetzung psychosozialer Betreuung hat, in dieser Arbeit mit berücksichtigt werden.
Krebs ist nach wie vor die zweithäufigste Todesursache in Deutschland. Das statistische Bundesamt veröffentlichte für das Jahr 2004 eine Zahl von 214 863 Menschen, die an bösartigen Neubildungen verstorben sind. (Statistisches Bundesamt 2006) Gleichzeitig spricht man von über 340 000 Menschen, die in Deutschland jährlich an Krebs erkranken. (vgl. Weis 2006, S.242) Demnach müssen für die Behandlung dieser Erkrankungen beachtliche Summen ausgegeben werden, die sich laut statistischem Bundesamt im Jahr 2004 auf 210 Euro pro Einwohner im Jahr belaufen haben. Obwohl sich von diesen Tatsachen die Vermutung ableiten ließe, dass der Wissens-stand in der Bevölkerung bezüglich der Krebserkrankung hoch sein, und der Umgang mit der Krankheit gewissermaßen routiniert ablaufen müsse, scheint dies bis heute nicht der Fall. Krebs wird auch heute häufig als Metapher für Tod und Siechtum ver-standen. Gleichsam fühlt sich beinahe jeder in der Bevölkerung von dieser Krankheit angesprochen, weil sie wenig abstrakt scheint und der Großteil einen persönlichen Bezug, über sich selbst, Verwandte oder Bekannte, herstellen kann. Die medizinische Wissenschaft macht kontinuierliche Fortschritte in der Diagnostik und Behandlung der Erkrankung, was die Überlebensrate für einige Tumoren in den letzten Jahren stetig verbessert hat. Gerade mit der längeren Lebenszeit, geht ein Paradigmenwechsel in der Onkologie von statten. Der Erfolg einer Krebsbehandlung wird heute nicht mehr nur an der körperlichen Genesung eines Patienten, sondern vielmehr auch am Zusammenhang mit der gewonnenen oder erhaltenen Lebensqualität gemessen. (vgl. Weis 2006, S.242) Krebsüberlebende müssen mit einer Vielzahl psychosozialer Belastungen als Folge der Erkrankung oder ihrer Behandlung umgehen können, was die Notwendigkeit einer psychosozialen Betreuung impliziert. In diesem Zusammenhang ist man geneigt, davon auszugehen, dass die psychosoziale Begleitung krebskranker Menschen in den Krankenhäusern Deutschlands gewährleistet ist. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 0 Einleitung
- 1. Psychosoziale Aspekte der Krebserkrankung
- 1.1. Psychosoziale Einflüsse auf die Entstehung von Krebs
- 1.2. Psychosoziale Belastungen der Patienten in Folge einer Krebserkrankung
- 1.2.1. Psychosoziale Belastungsfaktoren
- 1.2.2. Depression als psychiatrische Nebendiagnose in Folge einer Krebserkrankung
- 1.2.3. Belastungen im Verlauf einer Chemotherapie
- 2. Psychoonkologische Intervention als Aufgabengebiet Sozialer Arbeit
- 2.1. Definition und Zielsetzung des Aufgabenbereichs
- 2.2. Beratungsbedarf
- 2.2.1. Informationsvermittlung
- 2.2.2. Sozialrechtliche Beratung und Rehabilitation
- 2.2.2.1 Sozialrechtliche Beratung
- 2.2.2.2. Rehabilitation
- 2.3. Betreuungsbedarf
- 2.3.1. Emotionale Unterstützung
- 2.3.2. Copingstrategien
- 2.4. Behandlungsbedarf
- 2.5. Angehörigenarbeit im Rahmen der psychosozialen Intervention
- 2.6. Psychoonkologische Basisleistungen
- 2.7. Methodische Ansätze des Handlungsfeldes
- 2.7.1. Entspannungsverfahren
- 2.7.2. Gruppentherapie
- 2.7.3. Einzeltherapie
- 2.7.4. Soziale Beratung
- 2.7.5. Case Management
- 2.7.6. Krisenintervention
- 2.7.7. Kreative Therapien
- 2.8. Nachsorge als Faktor für verbesserte Lebensqualität
- 2.9. Lebensqualität als Beurteilungskriterium für Behandlungserfolg
- 3. Das DRG-Fallpauschalensystem zur Finanzierung von Krankenhausleistungen
- 3.1. Einleitung
- 3.2. Begriffliche und inhaltliche Bestimmung der Diagnosis Related Groups (DRG)
- 3.3. Geschichtliche Entwicklung des DRG-Systems
- 3.3.1. HCFA - DRGs
- 3.3.2. AP-DRGs
- 3.3.3. APR-DRGS
- 3.3.4. AR-DRG
- 3.4. Das Deutsche DRG-System: G-DRG
- 3.4.1. Einleitende Begriffs- und Inhaltsbestimmung der G-DRGs
- 3.4.2. Gesetzliche Grundlagen des G-DRG-Systems
- 3.4.3. Grundlagen des G-DRG 2006
- 3.4.4. ICD-10-GM als Grundlage für die Kodierung von Diagnosen
- 3.4.5. Der OPS als Instrument der Kodierung von Leistungen am Patienten
- 3.4.6. Die Deutschen Kodierrichtlinien: DKR
- 3.4.7. Verschlüsselung von Diagnosen und Prozeduren
- 3.4.8. Finanzierung von Krankenhausleistungen durch die G-DRGS
- 3.4.8.1. Kalkulation
- 3.4.8.2. Preisbildung
- 3.4.9. Kritik am G-DRG
- 4. Psychosoziale Betreuung im Rahmen des DRG - Abrechnungssystems
- 4.1. Auswirkung der DRG-Vergütung auf die psychosoziale Versorgung der Patienten
- 4.2. DRG-Relevanz von psychosozialer Versorgung
- 4.3. Psychosoziale Betreuung im OPS-Katalog
- 4.3.1. Psychosoziale Intervention (9-401)
- 4.3.2. Sozialrechtliche Beratung (9-401.0)
- 4.3.3. Familien-, Paar- und Erziehungsberatung (9-401.1)
- 4.3.4. Nachsorgeorganisation (9-401.2)
- 4.3.5. Supportive Therapie (9-401.3)
- 4.3.6. Künstlerische Therapie (9-401.4)
- 4.3.7. Integrierte psychosoziale Komplexbehandlung (9-401.5)
- 4.4. Leitlinien zur Kodierung und Dokumentation psychosozialer Leistungen im OPS
- 4.4.1. Kodierung als Vorraussetzung zur Erlangung von DRG-Relevanz
- 4.4.2. Dokumentation psychosozialer Leistungen
- 4.4.3. Kodierung psychosozialer Leistungen
- 4.5. Psychosoziale Versorgung als Wettbewerbsfaktor im Dienstleistungsunternehmen Krankenhaus
- 5. Die praktische Umsetzung psychosozialer Betreuung in der aktuellen Krankenhausstruktur
- 5.1. Grundlagen für die Umsetzung psychosozialer Leistungen
- 5.1.1. Gesetzliche Grundlagen
- 5.1.2. Sozialpolitische Rahmenbedingungen für die Umsetzung
- 5.1.3. Qualitätssicherung als Grundlage für Effizienz
- 5.1.4. Integration psychosozialer Leistungen in den medizinischen Behandlungsprozess
- 5.2. Berufspolitische Aktivitäten zur Erfassung psychosozialer Leistungen im DRG-System
- 5.3. Bedarfs-Screening als Vorraussetzung für praktische Psychoonkologie
- 5.3.1. Notwendigkeit der Anwendung von Screeningverfahren
- 5.3.2. Patientenzugang zu psychosozialer Betreuung
- 5.3.3. Anforderungen an Screeninginstrumente
- 5.4. Einsatz von Screeninginstrumenten in der Praxis
- 5.4.1. Hornheider Screeninginstrumente zur Erfassung der Betreuungsbedürftigkeit
- 5.4.2. Psychoonkologische Basisdokumentation
- 5.5. Integrierte psychosoziale Betreuung am Beispiel von Brustzentren
- 5.6. Stellenwert professioneller SA im Rahmen der praktischen Umsetzung
- 5.6.1. Historische Entwicklung des Aufgabenfeldes
- 5.6.2. Zuständigkeit der SA im psychosozialen Betreuungsprozess
- 5.6.3. Aktuelle Finanzierungsgrundlage der Sozialen Arbeit im Krankenhaus
- 5.6.4. Bedeutung SA im psychosozialen Betreuungsprozess
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit der psychosozialen Betreuung onkologischer Patienten im Rahmen des DRG-Fallpauschalensystems. Ziel ist es, die Herausforderungen und Möglichkeiten der praktischen Umsetzung von psychosozialer Unterstützung in der aktuellen Krankenhauslandschaft zu beleuchten und die Rolle der Sozialen Arbeit in diesem Kontext zu analysieren.
- Psychosoziale Aspekte der Krebserkrankung
- Psychoonkologische Intervention als Aufgabenbereich Sozialer Arbeit
- Das DRG-Fallpauschalensystem und seine Auswirkungen auf die psychosoziale Versorgung
- Praktische Umsetzung psychosozialer Betreuung in der Krankenhausstruktur
- Bedeutung der Sozialen Arbeit im psychosozialen Betreuungsprozess
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Beschreibt die psychosozialen Aspekte der Krebserkrankung, einschließlich der Einflüsse auf die Entstehung von Krebs und der Belastungen, denen Patienten in Folge einer Krebserkrankung ausgesetzt sind.
- Kapitel 2: Definiert den Aufgabenbereich der psychoonkologischen Intervention und beleuchtet die Bedeutung von Beratungs-, Betreuungs- und Behandlungsbedarf. Die Kapitel 2.7 und 2.8 fokussieren auf methodische Ansätze und die Bedeutung der Nachsorge.
- Kapitel 3: Erklärt das DRG-Fallpauschalensystem, seine geschichtliche Entwicklung und seine Funktionsweise.
- Kapitel 4: Untersucht die Auswirkungen des DRG-Systems auf die psychosoziale Versorgung von Patienten und analysiert die DRG-Relevanz von psychosozialer Versorgung im OPS-Katalog.
- Kapitel 5: Behandelt die praktische Umsetzung psychosozialer Betreuung in der Krankenhausstruktur, einschließlich der Berücksichtigung von gesetzlichen Grundlagen, Qualitätssicherung, Screeningverfahren und der Integration psychosozialer Leistungen in den medizinischen Behandlungsprozess.
Schlüsselwörter
Psychoonkologie, DRG-Fallpauschalensystem, psychosoziale Betreuung, onkologische Patienten, Soziale Arbeit, Krankenhausstruktur, Screeningverfahren, Behandlungsbedarf, Lebensqualität.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt die Soziale Arbeit in der Psychoonkologie?
Sie unterstützt Krebspatienten durch sozialrechtliche Beratung, emotionale Begleitung, Krisenintervention und die Organisation der Nachsorge.
Wie beeinflusst das DRG-System die psychosoziale Versorgung?
Das DRG-Abrechnungssystem erschwert die Finanzierung psychosozialer Leistungen, da diese im Krankenhaus oft nicht direkt als gewinnbringende Prozeduren kodiert werden können.
Was ist ein „Bedarfs-Screening“ bei Krebspatienten?
Es ist ein Verfahren (z.B. mit dem Hornheider Screeninginstrument), um frühzeitig festzustellen, welche Patienten eine intensive psychosoziale Betreuung benötigen.
Wie wird der Erfolg einer Krebsbehandlung heute gemessen?
Neben der körperlichen Genesung ist die gewonnene oder erhaltene Lebensqualität ein entscheidendes Beurteilungskriterium für den Behandlungserfolg.
Was sind typische psychosoziale Belastungsfaktoren bei Krebs?
Dazu gehören existenzielle Ängste, Depressionen als psychiatrische Nebendiagnose sowie Belastungen durch Chemotherapie und Veränderungen im sozialen Umfeld.
- Quote paper
- Susanne Niederhammer (Author), 2007, Psychosoziale Betreuung onkologischer Patienten im Rahmen des DRG-Fallpauschalensystems und die praktische Umsetzung durch die Soziale Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/70013