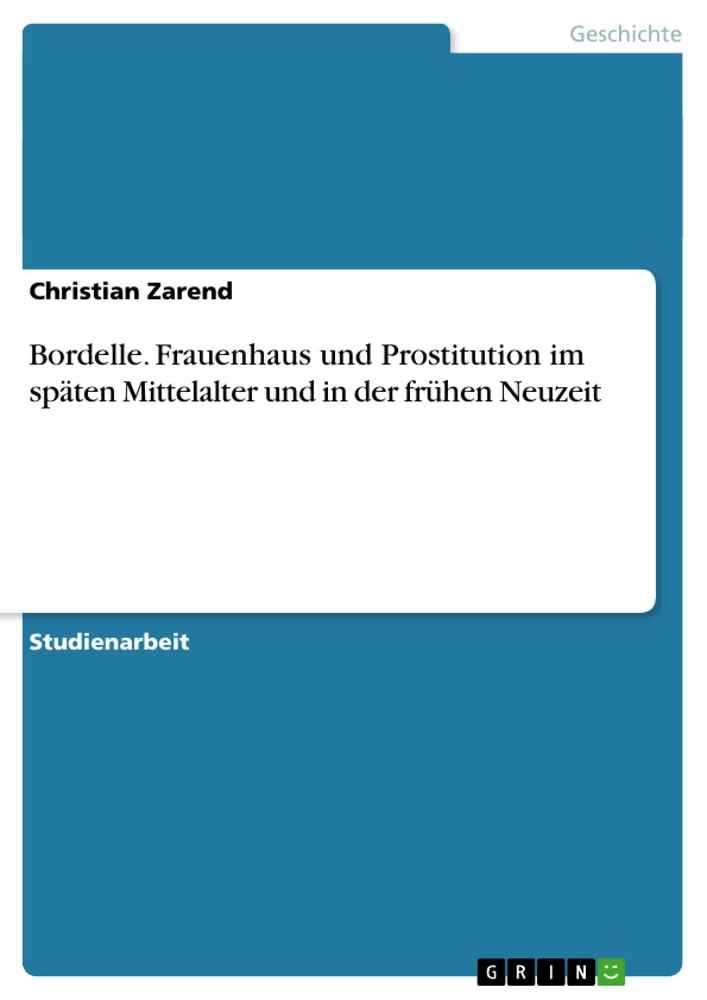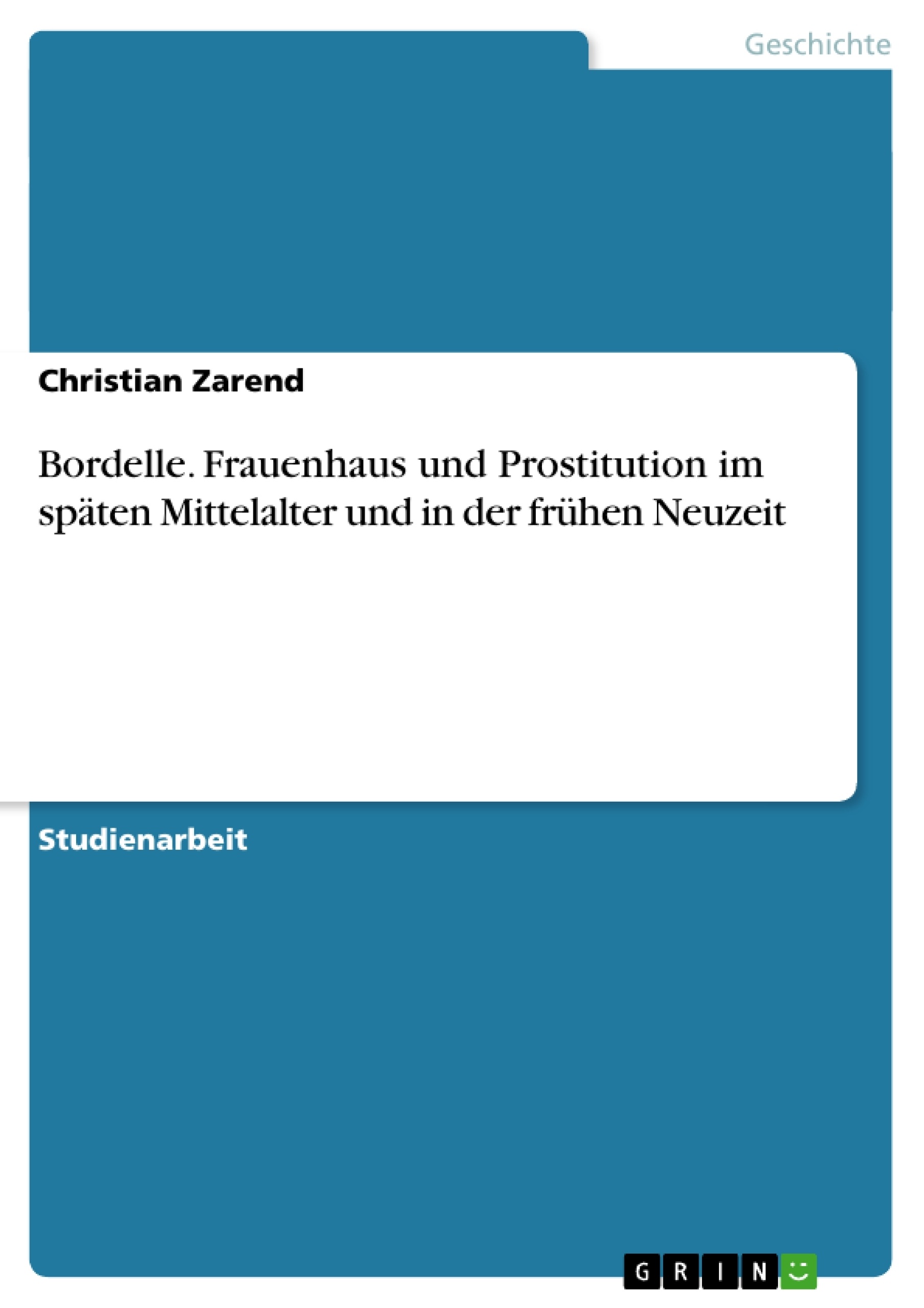Zum Erscheinungsbild jeder entwickelten Gesellschaft gehört die gewerbliche Prostitution, welche ein gewisses Maß an Urbanisierung, Mobilität und Geldwirtschaft bedingt. Das spätmittelalterliche Dirnenwesen bzw. die frühneuzeitliche Prostitution konzentriert sich demzufolge besonders in den werdenden und wachsenden Städten.
In einer strikt monogamen Gesellschaft, in der kaum mehr als dreißig Prozent der Bevölkerung die Möglichkeit hatte auf Eheschließung und Familiengründung zu hoffen, in der die Jungfräulichkeit der Braut nicht diskutierbar war, durch lange Ausbildungszeiten in vielen Berufsgruppen nur eine Spätehe realisiert werden konnte und die einen erheblichen Frauenüberschuss produzierte, in so einer gesellschaftlichen Ordnung konnte nicht auf die Ventilfunktion der Prostitution für angestaute Triebüberschüsse verzichtet werden. Besonders in einer Stadt mit vielen Fremden wäre jedes absolute Verbot illusorisch gewesen.
Demzufolge haben sich die städtischen Obrigkeiten auch sehr früh für die pragmatische Auffassung des Kirchenlehrers Augustinus begeistern können und sich diese zu eigen gemacht. Dieser Lehrer von „Sünde und Gnade“ sah in der Prostitution ein unvermeidbares Übel, was man um schlimmere Gefahr für das Seelenheil zu vermeiden, in Kauf nehmen müsse.
Um Auswüchsen des Dirnenwesens vorzubeugen wurden seitens der Obrigkeit Maßnahmen zur Kontrolle und Organisation der städtischen Prostitution ergriffen. Im Rahmen dieser Aktionen wurde ein bestimmtes Maß an Vergünstigungen oder Privilegien gewährt, womit das Dirnenwesen einen quasi „öffentlichen“, beinahe legalen Charakter bekam.
Die Bandbreite reicht hier von der Konzentration der Dirnen auf bestimmte Straßen (Strichbildung) über die Einrichtung von so genannten Frauenhäusern, auf welche später noch ausführlicher einzugehen sein wird, die in Obhutgabe eines Frauenwirts, gesundheitliche Kontrollen durch den Stadtchirurgen, aber auch die Kennzeichnung durch Kleidung.(z.B. war den Dirnen häufig das Tragen bestimmter Abzeichen vorgeschrieben oder verboten sich in bestimmte Stoffe zu kleiden, sowie einen bestimmten Schmuck anzulegen)
Kirchliche Anstalten, welche bekehrte Dirnen aufnahmen, konnten in manchen Städten mit Förderung rechnen bzw. wurden erstmalig zu diesem Zweck eingerichtet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Definition von Prostitution im Mittelalter bzw. in der Frühneuzeit
- 3. Wege in die Prostitution
- 4. Prostitution im Frauenhaus
- 4.1. Das Frauenhaus (Prostibulum)
- 4.2. Der Frauenwirt
- 4.3. Die Prostituierte im Frauenhaus
- 4.4. Schließung der Frauenhäuser
- 5. Die freie städtische Prostitution
- 6. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Prostitution im Spätmittelalter und in der Frühneuzeit. Ziel ist es, die Definition von Prostitution in dieser Epoche zu klären, die Wege in die Prostitution zu beleuchten und die Rolle der Frauenhäuser zu analysieren. Der Fokus liegt auf der sozialen und rechtlichen Situation der Prostituierten sowie den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen.
- Definition von Prostitution im Mittelalter und der Frühneuzeit
- Sozioökonomische Faktoren, die Frauen in die Prostitution trieben
- Die Organisation der Prostitution in Frauenhäusern
- Die Rolle der städtischen Obrigkeit in der Regulierung der Prostitution
- Unterschiede zwischen der Prostitution in Frauenhäusern und der freien Prostitution
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Einführung beleuchtet die gewerbliche Prostitution als Bestandteil entwickelter Gesellschaften, insbesondere in wachsenden Städten des Spätmittelalters und der Frühneuzeit. Sie skizziert den soziokulturellen Kontext, in dem die Prostitution eine Ventilfunktion für ungestillte Bedürfnisse darstellte, trotz der strikten monogamen Gesellschaftsordnung. Die pragmatische Haltung der städtischen Obrigkeiten, die die Prostitution als unvermeidliches Übel betrachteten, wird ebenso erläutert wie die von ihnen ergriffenen Maßnahmen zur Kontrolle und Organisation des Dirnenwesens, einschließlich der Einrichtung von Frauenhäusern und der Regulierung durch Kleidung und Abzeichen. Diese Maßnahmen, obwohl sie einen gewissen Schutz boten, trugen auch einen diskriminierenden Charakter.
2. Definition von Prostitution im Mittelalter bzw. in der Frühneuzeit: Dieses Kapitel analysiert die Definition von Prostitution im Mittelalter und der Frühneuzeit, basierend auf römischen Rechtsauffassungen (Ulpian, Justinianischer Codex) und kirchlichen Interpretationen (Hieronymus). Die Hauptunterscheidungsmerkmale waren die Käuflichkeit des Geschlechtsverkehrs und der rasche Partnerwechsel. Konkubinen und Dienstmädchen wurden explizit ausgeschlossen. Die Unschärfen dieser Definitionen, insbesondere hinsichtlich der Anzahl der Partner, führten zu juristischen und moraltheologischen Debatten. Es wird auch darauf hingewiesen, dass männliche oder homosexuelle Prostitution als Todsünde galt.
3. Wege in die Prostitution: Dieses Kapitel befasst sich mit den Ursachen, die Frauen im Spätmittelalter und in der Frühneuzeit in die Prostitution führten. Die Quellenlage ist zwar begrenzt, doch wird Armut als Hauptfaktor hervorgehoben. Die Kapitel beleuchtet verschiedene Beispiele aus zeitgenössischen Berichten und Chroniken, die den Zusammenhang zwischen Armut und Prostitution aufzeigen, sowie Einzelfälle, in denen Erbeverlust oder Betrug zu diesem Schritt führten. Es wird jedoch betont, dass Armut nur die Hemmschwelle senkte und nicht die alleinige Ursache war. Der Einfluss von Frauenhändlern und die Entwicklung von Gelegenheits- zu professioneller Prostitution wird ebenfalls diskutiert. Ein Beispiel von Magret Neugruber illustriert den Prozess, wie sie durch Armut und den Druck eines Mannes in die Prostitution geriet.
4. Prostitution im Frauenhaus: Dieses Kapitel widmet sich der Prostitution innerhalb von Frauenhäusern (Prostibula). Es beschreibt die Struktur der Frauenhäuser, die Rolle des Frauenwirts, die Lebensumstände der dort arbeitenden Frauen, und den schlussendlichen Niedergang dieser Institutionen. Die Zusammenfassung integriert die jeweiligen Unterkapitel, um ein vollständiges Bild des Lebens in den Frauenhäusern und der dort ausgeübten Prostitution zu vermitteln. Die Schließung der Frauenhäuser und die darauffolgenden Veränderungen in der Organisation der Prostitution bilden einen zentralen Aspekt der Zusammenfassung.
5. Die freie städtische Prostitution: Diese Zusammenfassung des Kapitels beschreibt die freie städtische Prostitution, ihre Organisation und die Lebensbedingungen der betroffenen Frauen außerhalb der kontrollierten Umgebung der Frauenhäuser. Der Fokus liegt auf der Synthese des Kapitels, ohne die einzelnen Unterkapitel (die im Originaltext existieren könnten, aber hier nicht in der Zusammenfassung vorkommen) einzeln zu wiederholen. Es soll ein umfassendes Bild der freien Prostitution in städtischen Umgebungen entstehen, welche die spezifischen Herausforderungen und Unterschiede zur Prostitution innerhalb von Frauenhäusern beleuchtet. Die Zusammenfassung verknüpft dies mit den vorherigen Kapiteln, um den gesamten Kontext zu verdeutlichen.
Schlüsselwörter
Prostitution, Spätmittelalter, Frühneuzeit, Frauenhaus, Armut, soziale Randgruppen, städtische Gesellschaft, Recht, Moral, kirchliche Normen, Frauenhandel, soziale Kontrolle.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Prostitution im Spätmittelalter und in der Frühneuzeit
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Prostitution im Spätmittelalter und in der Frühneuzeit. Sie beleuchtet die Definition von Prostitution in dieser Epoche, die Wege in die Prostitution, die Rolle der Frauenhäuser, die soziale und rechtliche Situation der Prostituierten sowie die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Definition von Prostitution im Mittelalter und der Frühneuzeit; sozioökonomische Faktoren, die Frauen in die Prostitution trieben; die Organisation der Prostitution in Frauenhäusern; die Rolle der städtischen Obrigkeit in der Regulierung der Prostitution; und die Unterschiede zwischen der Prostitution in Frauenhäusern und der freien Prostitution.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Eine Einführung, ein Kapitel zur Definition von Prostitution, ein Kapitel zu den Wegen in die Prostitution, ein Kapitel zur Prostitution im Frauenhaus (inkl. Unterkapitel zum Frauenhaus selbst, dem Frauenwirt, den Prostituierten und der Schließung der Häuser), ein Kapitel zur freien städtischen Prostitution und ein Schluss.
Was sind die zentralen Ergebnisse des Kapitels zur Definition von Prostitution?
Das Kapitel analysiert die Definition von Prostitution anhand römischer Rechtsauffassungen und kirchlicher Interpretationen. Die Käuflichkeit des Geschlechtsverkehrs und der rasche Partnerwechsel waren entscheidende Merkmale. Konkubinen und Dienstmädchen wurden ausgeschlossen. Unschärfen in der Definition führten zu Debatten. Männliche oder homosexuelle Prostitution galt als Todsünde.
Welche Faktoren führten Frauen in die Prostitution?
Das Kapitel zu den Wegen in die Prostitution hebt Armut als Hauptfaktor hervor. Es werden Beispiele aus zeitgenössischen Quellen gezeigt, die den Zusammenhang zwischen Armut und Prostitution verdeutlichen. Erbeverlust oder Betrug werden als weitere Ursachen genannt. Der Einfluss von Frauenhändlern und die Entwicklung von Gelegenheits- zu professioneller Prostitution wird ebenfalls diskutiert.
Was wird im Kapitel über die Prostitution im Frauenhaus behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt die Struktur der Frauenhäuser, die Rolle des Frauenwirts, die Lebensumstände der Frauen und den Niedergang dieser Institutionen. Es bietet ein umfassendes Bild des Lebens in den Frauenhäusern und der dort ausgeübten Prostitution, inklusive der Schließung der Frauenhäuser und den darauffolgenden Veränderungen.
Wie wird die freie städtische Prostitution dargestellt?
Das Kapitel zur freien städtischen Prostitution beschreibt die Organisation und die Lebensbedingungen der Frauen außerhalb der Frauenhäuser. Es beleuchtet die spezifischen Herausforderungen und Unterschiede zur Prostitution innerhalb der Frauenhäuser und verknüpft dies mit den vorherigen Kapiteln.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Prostitution, Spätmittelalter, Frühneuzeit, Frauenhaus, Armut, soziale Randgruppen, städtische Gesellschaft, Recht, Moral, kirchliche Normen, Frauenhandel, soziale Kontrolle.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Frage nach den genauen Quellen kann hier nicht beantwortet werden, da die HTML-Datei nur eine Zusammenfassung der Arbeit enthält. Die detaillierten Quellenangaben müssten der vollständigen wissenschaftlichen Arbeit entnommen werden.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Zusammenfassung ist für alle Personen gedacht, die sich für die Geschichte der Prostitution im Spätmittelalter und in der Frühneuzeit interessieren. Sie ist insbesondere für akademische Zwecke gedacht, zur Analyse der Themen in strukturierter und professioneller Weise.
- Citar trabajo
- Christian Zarend (Autor), 2006, Bordelle. Frauenhaus und Prostitution im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/70135