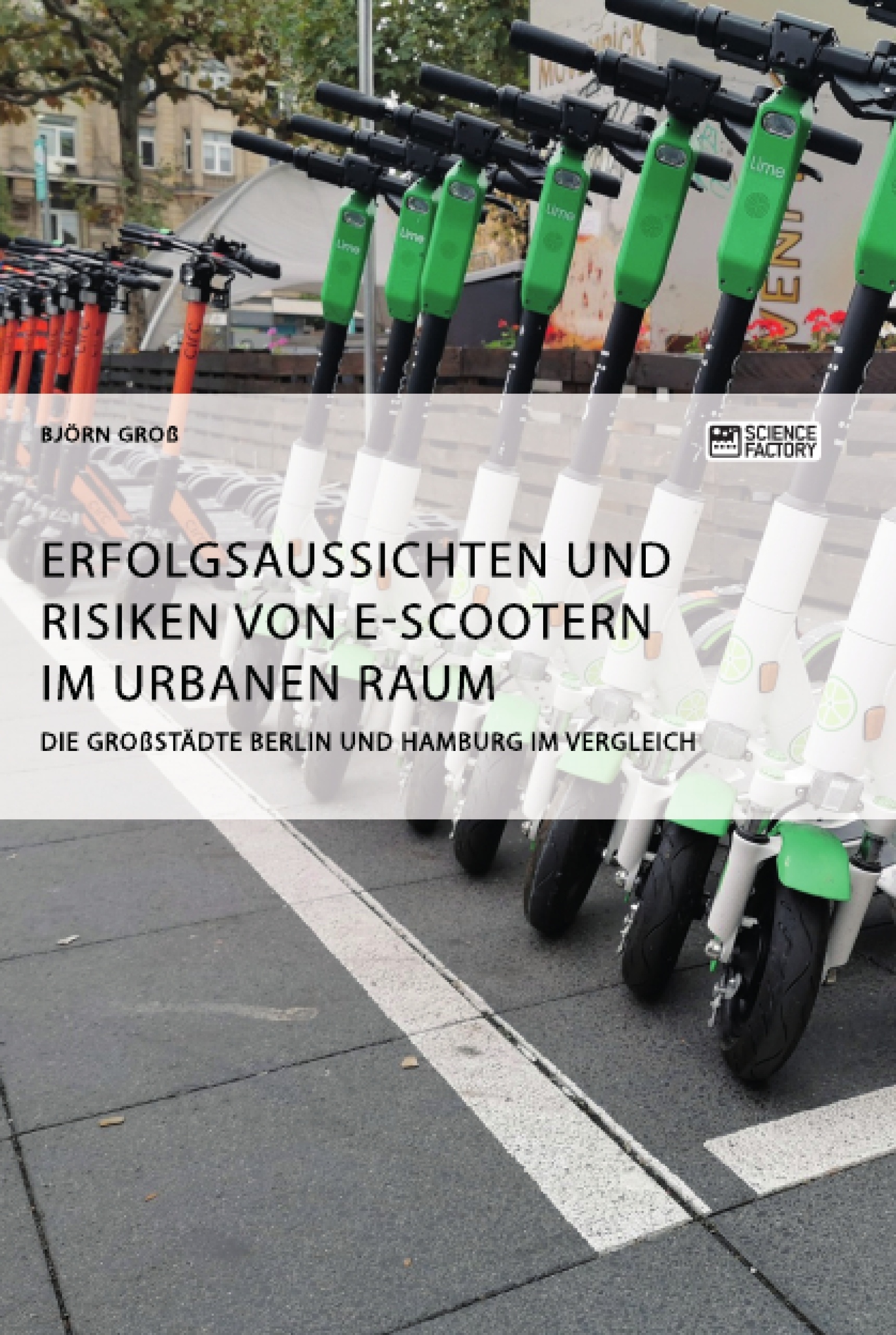Wir befinden uns in einem Umbruch der Mobilität. Mit Sicht auf die wachsende Zahl von Stadtbewohnern und deren Bedürfnisse nach räumlicher Fortbewegung kann das Auto kein Statussymbol mehr darstellen. Für zukünftige Mobilität werden daher neue Energieinfrastrukturen und Mobilitätskonzepte notwendig.
Seit dem Jahr 2019 sind auch führerscheinfreie E-Scooter für den Straßenverkehr zugelassen. Welche gesetzlichen Regelungen gelten für diese Elektrokleinstfahrzeuge? Worin unterscheiden sich die drei führenden Sharing-Anbieter? Welche Faktoren beeinflussen den Sharing-Betrieb von E-Scootern?
Björn Groß untersucht die Potentiale und Grenzen der Sharing-Angebote für E-Scooter im urbanen Raum. Er stellt insbesondere die Mobilitätskonzepte der Großstädte Berlin und Hamburg einander gegenüber und zeigt nachhaltige Umsetzungsmöglichkeit für eine optimierte Integration von E-Scootern auf.
Aus dem Inhalt:
- Nachhaltigkeit;
- Verkehrsentlastung;
- Emissionen;
- Digitale Integration;
- Mobilitätskonzept;
- Erneuerbare Energien;
- Akkutauschstationen
Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkung
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung
- 1.3 Vorgehen
- 1.4 Forschungsstand
- 2 Begriffserläuterungen, gesetzliche Regelungen und historischer Hintergrund
- 2.1 Definition Mikromobilität
- 2.2 Definition Mobilität und Mobilitätskonzept
- 2.3 Definition Verkehr und Verkehrskonzepte
- 2.4 Definition Sharing
- 2.5 Definition Nachhaltigkeit
- 2.6 Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung und Definition von E-Scooter
- 2.7 Historische Entwicklung von E-Scootern
- 2.8 Nachhaltigkeitskonzepte
- 3 Bewertung von Erfolgsaussichten und Risiken anhand der technischen Daten und der Handhabung von E-Scootern
- 3.1 Technische Daten und die Handhabung der E-Scooter
- 3.2 LIME
- 3.3 TIER
- 3.4 VOI
- 3.5 Zusammenfassung techn. Daten E-Scooter
- 4 E-Scooter-Sharing
- 4.1 Anbieter des E-Scooter-Sharing
- 4.2 Mietkonditionen und Verfahrensweisen
- 5 Fördernde Einflussfaktoren
- 5.1 Energieeffizienz
- 5.2 Emissionen Vergleich
- 5.3 Verkehrsentlastung
- 5.4 Die erste und letzte Meile
- 5.5 Stärkung bzw. Ergänzung des Öffentlichen Nahverkehrs
- 5.6 Mitnahme privater E-Scooter im ÖPNV
- 5.7 Tarifgestaltung
- 5.8 Bereitstellung
- 5.9 Digitale Integration
- 6 Hemmende Einflussfaktoren
- 6.1 Umweltaspekte
- 6.2 Belastung von Menschen, Raum und Verkehr
- 6.3 Wetterabhängigkeit
- 7 Berlin
- 7.1 Mobilitätsgesetz
- 7.2 Vereinbarung zwischen Stadt und Anbietern
- 7.3 Bündelung von Mobilitätskonzepten
- 7.4 Unfallzahlen
- 8 Hamburg
- 8.1 Vereinbarung zwischen Stadt und Anbietern
- 8.2 Unfallzahlen
- 8.3 Bündelung von Mobilitätskonzepten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Erfolgsaussichten und Risiken von E-Scootern im urbanen Raum, insbesondere in Berlin und Hamburg. Ziel ist ein Vergleich der beiden Städte hinsichtlich der Rahmenbedingungen und der Auswirkungen des E-Scooter-Sharings.
- Bewertung der technischen Aspekte von E-Scootern und deren Handhabung.
- Analyse der Anbieter von E-Scooter-Sharing und deren Geschäftsmodelle.
- Untersuchung fördernder Einflussfaktoren wie Energieeffizienz und Verkehrsentlastung.
- Bewertung hemmender Einflussfaktoren wie Umweltaspekte und Unfallzahlen.
- Vergleich der regulatorischen Rahmenbedingungen und der städtischen Strategien in Berlin und Hamburg.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der E-Scooter im urbanen Raum ein, beschreibt die Problemstellung der steigenden Mobilitätsbedürfnisse in Großstädten und benennt die Zielsetzung der Arbeit, die Vorgehensweise und den Forschungsstand. Es legt den Grundstein für die nachfolgende detaillierte Untersuchung.
2 Begriffserläuterungen, gesetzliche Regelungen und historischer Hintergrund: Hier werden zentrale Begriffe wie Mikromobilität, Sharing und Nachhaltigkeit definiert und gesetzliche Regelungen, insbesondere die Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung, erläutert. Der historische Hintergrund der E-Scooter wird beleuchtet, um das aktuelle Umfeld besser zu verstehen. Diese fundierte Begriffsklärung bildet die Basis für die weitere Analyse.
3 Bewertung von Erfolgsaussichten und Risiken anhand der technischen Daten und der Handhabung von E-Scootern: Dieses Kapitel bewertet die Erfolgsaussichten und Risiken von E-Scootern anhand ihrer technischen Daten und der Handhabung. Es analysiert verschiedene Anbieter wie LIME, TIER und VOI im Detail, vergleicht ihre technischen Spezifikationen und diskutiert die damit verbundenen Vor- und Nachteile. Die Zusammenfassung der technischen Daten liefert wichtige Erkenntnisse für die spätere Bewertung der Gesamtbilanz.
4 E-Scooter-Sharing: Dieser Abschnitt befasst sich mit dem E-Scooter-Sharing-Markt. Es werden die verschiedenen Anbieter, ihre Mietkonditionen und die damit verbundenen Prozesse genauer unter die Lupe genommen. Dies ist relevant für das Verständnis der wirtschaftlichen Aspekte des E-Scooter-Einsatzes.
5 Fördernde Einflussfaktoren: In diesem Kapitel werden die positiven Auswirkungen von E-Scootern auf die städtische Mobilität untersucht. Es werden Aspekte wie Energieeffizienz, Emissionsreduzierung, Verkehrsentlastung und die Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs detailliert analysiert. Der Fokus liegt auf den positiven Beiträgen der E-Scooter zur städtischen Entwicklung.
6 Hemmende Einflussfaktoren: Dieses Kapitel beleuchtet die negativen Aspekte des E-Scooter-Einsatzes. Es werden Umweltprobleme, die Belastung des öffentlichen Raums und die Wetterabhängigkeit kritisch betrachtet. Die Kapitel beschreiben die Herausforderungen und Probleme, die mit dem Einsatz von E-Scootern verbunden sind.
7 Berlin: Dieses Kapitel analysiert die Situation in Berlin, inklusive des Mobilitätsgesetzes, der Vereinbarungen zwischen Stadt und Anbietern und der Bündelung von Mobilitätskonzepten. Die Unfallzahlen werden ebenfalls berücksichtigt, um ein umfassendes Bild der Berliner E-Scooter-Landschaft zu zeichnen.
8 Hamburg: Ähnlich wie das Kapitel zu Berlin, wird hier die Situation in Hamburg untersucht. Die Analyse umfasst die Vereinbarungen zwischen Stadt und Anbietern, Unfallzahlen und die Bündelung von Mobilitätskonzepten. Der Vergleich mit Berlin ermöglicht eine umfassendere Bewertung der Erfolgsaussichten und Risiken.
Schlüsselwörter
E-Scooter, Mikromobilität, Sharing, Nachhaltigkeit, Verkehr, Mobilität, Berlin, Hamburg, Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung, Unfallzahlen, Energieeffizienz, Emissionen, Verkehrsentlastung, öffentlicher Nahverkehr.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Erfolgsaussichten und Risiken von E-Scootern im urbanen Raum - Ein Vergleich Berlin und Hamburg
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Erfolgsaussichten und Risiken von E-Scootern im urbanen Raum, insbesondere in Berlin und Hamburg. Der Fokus liegt auf einem Vergleich der beiden Städte hinsichtlich der Rahmenbedingungen und Auswirkungen des E-Scooter-Sharings.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit deckt ein breites Spektrum an Themen ab, darunter die technischen Aspekte von E-Scootern, die Analyse verschiedener Anbieter und deren Geschäftsmodelle, fördernde Einflussfaktoren wie Energieeffizienz und Verkehrsentlastung, hemmende Einflussfaktoren wie Umweltaspekte und Unfallzahlen, sowie ein Vergleich der regulatorischen Rahmenbedingungen und städtischen Strategien in Berlin und Hamburg.
Welche Aspekte der E-Scooter werden technisch bewertet?
Die Arbeit bewertet die technischen Daten und die Handhabung von E-Scootern verschiedener Anbieter (LIME, TIER, VOI) und fasst deren Vor- und Nachteile zusammen. Dies beinhaltet die Analyse von technischen Spezifikationen und deren Auswirkungen auf die Praxistauglichkeit.
Wie werden die Anbieter von E-Scooter-Sharing behandelt?
Die Arbeit analysiert die verschiedenen Anbieter von E-Scooter-Sharing, ihre Mietkonditionen und die damit verbundenen Prozesse. Dies trägt zum Verständnis der wirtschaftlichen Aspekte des E-Scooter-Einsatzes bei.
Welche fördernden Einflussfaktoren werden betrachtet?
Fördernde Einflussfaktoren umfassen Energieeffizienz, Emissionsreduzierung, Verkehrsentlastung, die Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs, die Nutzung als "erste und letzte Meile", die Mitnahme im ÖPNV, die Tarifgestaltung, die Verfügbarkeit und die digitale Integration.
Welche hemmenden Einflussfaktoren werden diskutiert?
Hemmende Einflussfaktoren beinhalten Umweltaspekte (z.B. Entsorgung der Akkus), die Belastung von Menschen, Raum und Verkehr (z.B. wildes Parken), und die Wetterabhängigkeit.
Wie werden Berlin und Hamburg im Vergleich dargestellt?
Die Arbeit vergleicht die Situation in Berlin und Hamburg hinsichtlich des Mobilitätsgesetzes, der Vereinbarungen zwischen Stadt und Anbietern, der Bündelung von Mobilitätskonzepten und der Unfallzahlen. Dieser Vergleich ermöglicht eine umfassendere Bewertung der Erfolgsaussichten und Risiken.
Welche gesetzlichen Regelungen werden behandelt?
Die Arbeit erläutert die Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung und deren Relevanz für E-Scooter. Weitere gesetzliche Regelungen und deren Auswirkungen auf den E-Scooter-Markt werden ebenfalls diskutiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: E-Scooter, Mikromobilität, Sharing, Nachhaltigkeit, Verkehr, Mobilität, Berlin, Hamburg, Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung, Unfallzahlen, Energieeffizienz, Emissionen, Verkehrsentlastung, öffentlicher Nahverkehr.
Wo finde ich eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Die Arbeit bietet eine detaillierte Zusammenfassung jedes Kapitels, von der Einleitung bis zum Vergleich der Situation in Berlin und Hamburg. Diese Zusammenfassungen bieten einen Überblick über die jeweiligen Inhalte und deren Bedeutung für die Gesamtstudie.
- Quote paper
- Björn Groß (Author), 2021, Erfolgsaussichten und Risiken von E-Scootern im urbanen Raum. Die Großstädte Berlin und Hamburg im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/703208