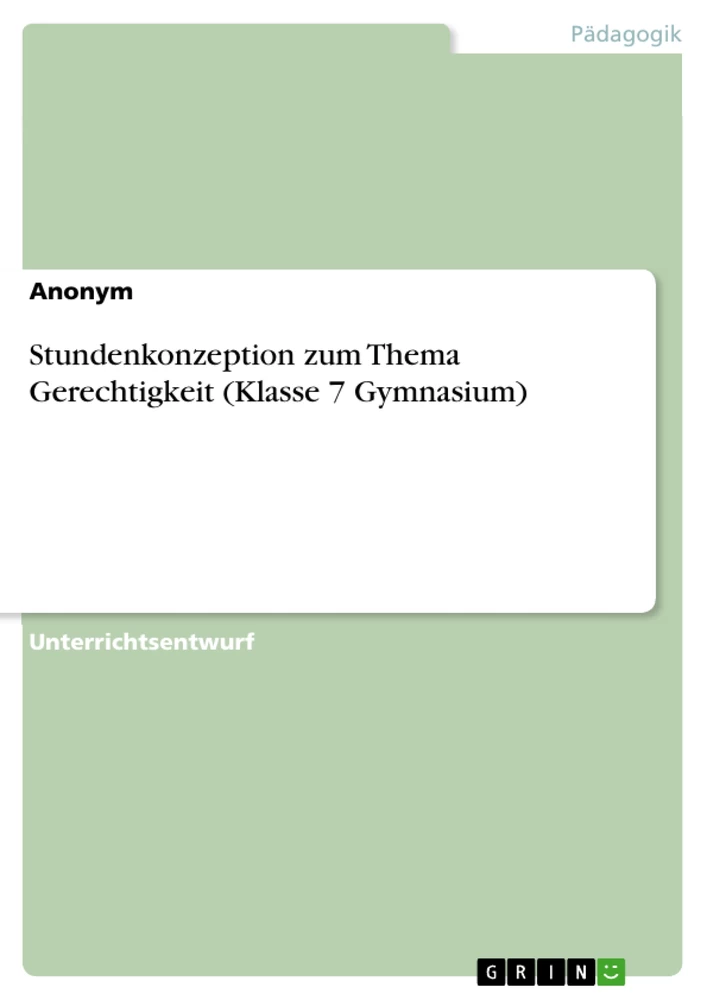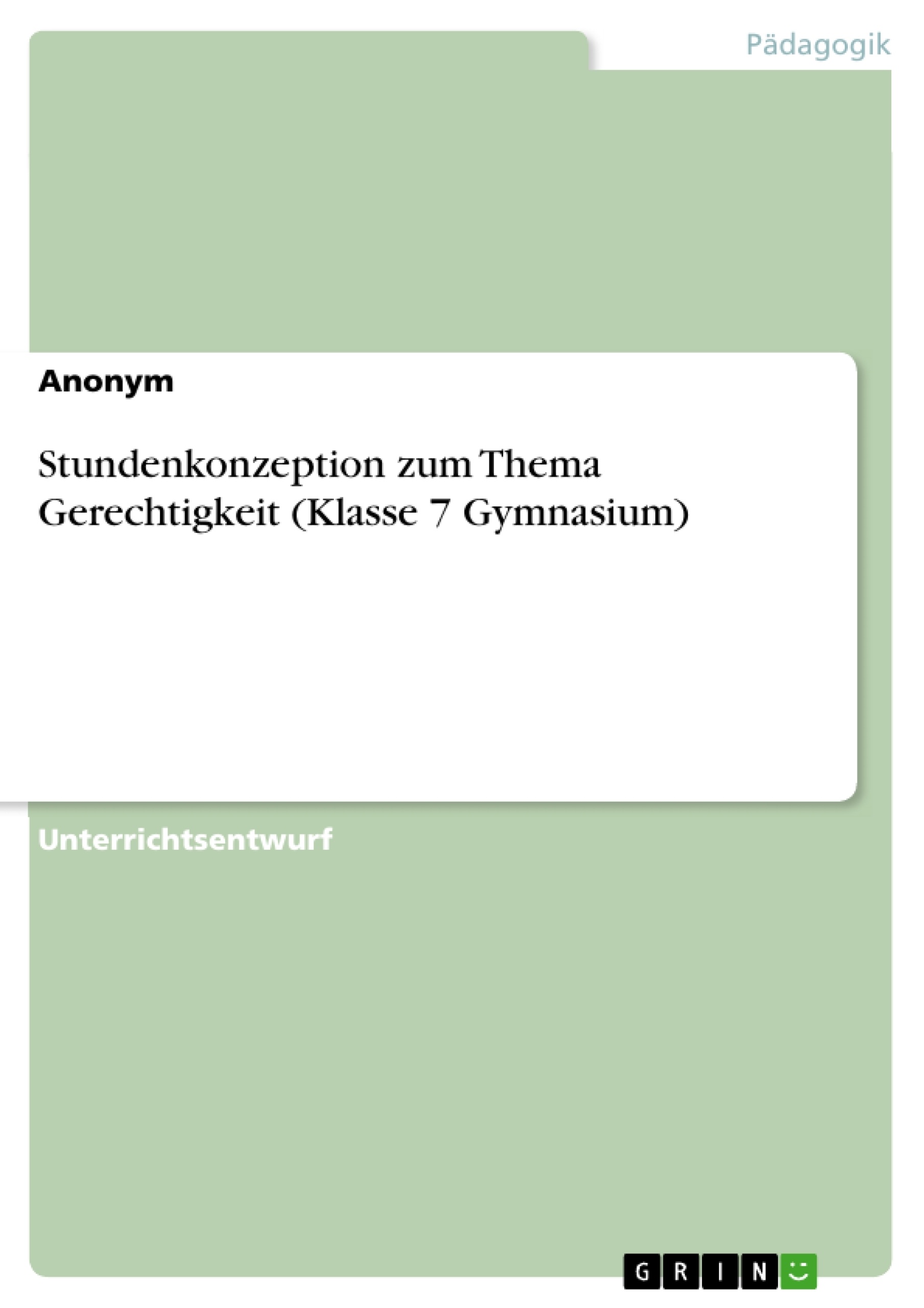Diese Stundenkonzeption führt das Thema „Gerechtigkeit“ ein und ist damit die erste Stunde der Reihe. Damit wir in Zukunft adäquat über Gerechtigkeit sprechen können, werden zunächst verschiedene gerechte und ungerechte Alltagssituationen betrachtet. Anhand dieser sollen dann drei Kriterien von Gerechtigkeit erarbeitet werden. Es ist wichtig zu erwähnen, dass diese Kriterien nicht die einzigen sind, sondern eine von mir getroffene Auswahl, mit der man in alltäglichen Situationen am besten umgehen kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Thema der Unterrichtsreihe und Bezug zum Lehrplan
- 2. Tabellarische Übersicht über die Reihe
- 3. Thema der Unterrichtsstunde und Verortung innerhalb der Reihe
- 4. Lernziele und Kompetenzen der konzipierten Unterrichtsstunde
- 5. Ablaufplan der Unterrichtsstunde
- 6. Reflexion der Unterrichtsstunde
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit konzipiert eine Unterrichtsstunde zum Thema „Gerechtigkeit“ für die Klassenstufe 7 (Gymnasium). Ziel ist es, die Schülerinnen und Schüler dazu zu befähigen, Kriterien von Gerechtigkeit zu benennen und zu bewerten. Die Arbeit verortet die Stunde innerhalb einer umfassenderen Unterrichtsreihe zu moralischem Handeln, Werten und Normen, mit dem Schwerpunkt auf Gerechtigkeit und Courage.
- Entwicklung von Kriterien für Gerechtigkeit
- Anwendung von Gerechtigkeitskriterien auf Alltagssituationen
- Reflexion des Begriffs Gerechtigkeit im Kontext von Gleichheit
- Einführung in den Begriff Zivilcourage
- Verknüpfung von Gerechtigkeit und Zivilcourage
Zusammenfassung der Kapitel
1. Thema der Unterrichtsreihe und Bezug zum Lehrplan: Dieses Kapitel beschreibt das übergeordnete Thema der Unterrichtsreihe ("Sollen: Moralisches Handeln – Werte und Normen") und dessen Bezug zum Lehrplan. Es wird die Relevanz des Themas "Gerechtigkeit" im Kontext interkultureller Wertvorstellungen hervorgehoben und die Auswahl relevanter Kompetenzen aus dem Lehrplan begründet, welche die Schüler befähigen sollen, Perspektiven einzunehmen, Handlungsmuster zu analysieren und Argumente zu formulieren. Die enge Verknüpfung zwischen Gerechtigkeit und Courage wird als roter Faden der gesamten Reihe vorgestellt.
2. Tabellarische Übersicht über die Reihe: Dieses Kapitel präsentiert eine tabellarische Übersicht der geplanten Unterrichtsreihe. Es werden die Ziele, Inhalte und Methoden jeder einzelnen Stunde detailliert dargestellt. Der Fokus liegt auf der schrittweisen Entwicklung des Verständnisses von Gerechtigkeit und deren Umsetzung im Kontext von Zivilcourage. Die Übersicht zeigt einen klaren didaktischen Aufbau von der Einführung des Begriffs bis zur praktischen Anwendung.
3. Thema der Unterrichtsstunde und Verortung innerhalb der Reihe: Dieses Kapitel verortet die konzipierte Unterrichtsstunde innerhalb der gesamten Reihe. Es wird die Funktion der Stunde als Einführung in das Thema "Gerechtigkeit" beschrieben. Die Auswahl spezifischer Kriterien für Gerechtigkeit wird gerechtfertigt und deren Bedeutung im Kontext alltäglicher Situationen betont. Die Beschränkung auf wenige, aber zentrale Kriterien wird als didaktische Strategie zur Erreichbarkeit der Lernziele erläutert.
4. Lernziele und Kompetenzen der konzipierten Unterrichtsstunde: Hier werden das zentrale Lernziel der Stunde ("Die SuS nennen die Kriterien von Gerechtigkeit und bewerten diese") und die dazugehörigen Kompetenzen aus dem Lehrplan präzise definiert. Die eingeschränkte Anzahl an Lernzielen und Kompetenzen wird begründet, um deren effektive Erreichbarkeit zu gewährleisten. Die Operationalisierung des Lernziels ermöglicht eine direkte Umsetzung in konkrete Übungsaufgaben.
Schlüsselwörter
Gerechtigkeit, Zivilcourage, Moral, Werte, Normen, Lehrplan, Kompetenzen, Unterrichtsplanung, Ethik, Didaktik, Alltagssituationen, Gleichheitsprinzip, Perspektivübernahme, Argumentation.
Häufig gestellte Fragen zur Unterrichtsplanung: Gerechtigkeit und Zivilcourage
Was ist das Thema der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit beschreibt die Konzeption einer Unterrichtsstunde zum Thema „Gerechtigkeit“ für die Klassenstufe 7 (Gymnasium) im Kontext einer umfassenderen Unterrichtsreihe zu moralischem Handeln, Werten und Normen. Der Fokus liegt auf der Entwicklung von Kriterien für Gerechtigkeit und deren Anwendung auf Alltagssituationen, sowie der Verknüpfung mit Zivilcourage.
Welche Themen werden in der Unterrichtsreihe behandelt?
Die Unterrichtsreihe behandelt das übergeordnete Thema „Sollen: Moralisches Handeln – Werte und Normen“, mit dem Schwerpunkt auf Gerechtigkeit und Courage. Es werden Kriterien für Gerechtigkeit entwickelt, auf Alltagssituationen angewendet und im Kontext von Gleichheit und Zivilcourage reflektiert.
Wie ist die Unterrichtsstunde in die Reihe eingeordnet?
Die konzipierte Unterrichtsstunde dient als Einführung in das Thema „Gerechtigkeit“ innerhalb der umfassenderen Reihe. Sie bereitet die Schüler auf die spätere Auseinandersetzung mit Zivilcourage vor.
Welche Lernziele werden in der Unterrichtsstunde verfolgt?
Das zentrale Lernziel ist, dass die Schüler Kriterien von Gerechtigkeit benennen und bewerten können. Die dazugehörigen Kompetenzen beziehen sich auf die Perspektivübernahme, die Analyse von Handlungsmustern und die Formulierung von Argumenten.
Welche Methoden werden in der Unterrichtsreihe eingesetzt?
Die Arbeit enthält zwar keine detaillierte Auflistung aller Methoden, aber der tabellarischen Übersicht der Reihe (Kapitel 2) ist zu entnehmen, dass verschiedene Methoden für jeden einzelnen Stunden geplant sind, um ein schrittweises Verständnis von Gerechtigkeit zu ermöglichen.
Wie ist der Bezug zum Lehrplan?
Die Arbeit beschreibt den Bezug der Unterrichtsreihe und der einzelnen Stunde zum Lehrplan. Die Auswahl relevanter Kompetenzen wird begründet und die Relevanz des Themas "Gerechtigkeit" im Kontext interkultureller Wertvorstellungen hervorgehoben.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Gerechtigkeit, Zivilcourage, Moral, Werte, Normen, Lehrplan, Kompetenzen, Unterrichtsplanung, Ethik, Didaktik, Alltagssituationen, Gleichheitsprinzip, Perspektivübernahme und Argumentation.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu: Thema der Unterrichtsreihe und Bezug zum Lehrplan, tabellarische Übersicht über die Reihe, Thema der Unterrichtsstunde und Verortung innerhalb der Reihe, Lernziele und Kompetenzen der konzipierten Unterrichtsstunde, Ablaufplan der Unterrichtsstunde und Reflexion der Unterrichtsstunde.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine ausführliche Zusammenfassung der einzelnen Kapitel, die die wichtigsten Inhalte und Ziele jedes Kapitels beschreibt.
Für welche Jahrgangsstufe ist die Unterrichtsstunde konzipiert?
Die Unterrichtsstunde ist für die Klassenstufe 7 (Gymnasium) konzipiert.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Stundenkonzeption zum Thema Gerechtigkeit (Klasse 7 Gymnasium), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/703320