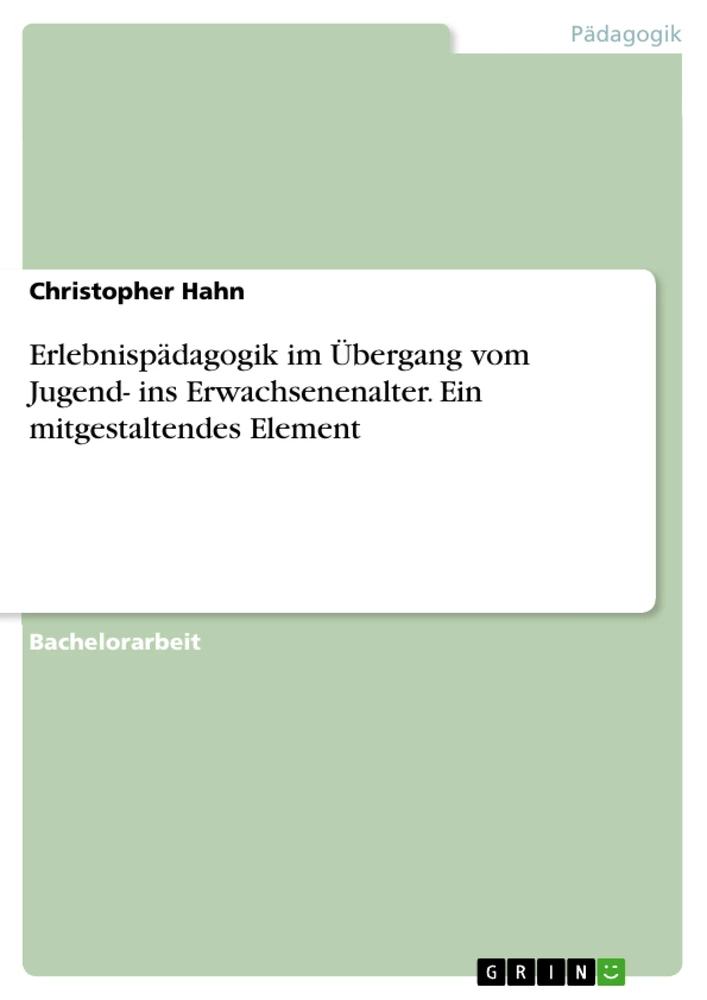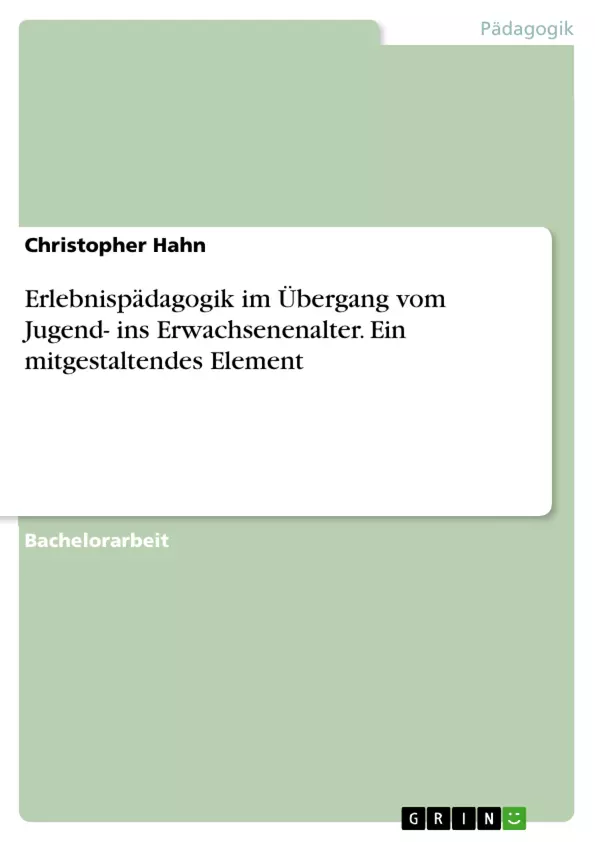Die Arbeit befasst sich mit der gezielten Vermittlung von Kompetenzen, die für das gesunde Erwachsenwerden erforderlich sind. Sich dieser Thematik anzunähern, soll Gegenstand der Arbeit sein. Die Fragestellung hierbei lautet, ob Angebote der Erlebnispädagogik den Übergang vom Jugend- ins Erwachsenenalter mitgestalten und unterstützen können.
Ziel ist es, die Herausforderung des Erwachsenwerdens mit dem Kompetenzprofil erlebnispädagogischer Programme in Verbindung zu bringen und somit neue Erkenntnisse und Möglichkeiten für die Arbeit mit Jugendlichen im Prozess des Erwachsenwerdens herauszuarbeiten. Zu diesem Zweck soll zunächst detaillierter auf das Jugend- und Erwachsenenalter eingegangen werden, um ein besseres Verständnis für diese Lebensabschnitte zu erlangen.
Dies soll im Anschluss dabei helfen, zum einen die Gefahren, zum anderen die spezifischen gesellschaftlichen und individuellen Anforderungen des Übergangs zwischen diesen Lebensphasen herauszuarbeiten. Darauf folgt die Betrachtung der Erlebnispädagogik als pädagogische Methode. Neben der historischen Entwicklung wird hier der Fokus auf der Frage liegen, welche Lernziele und Kompetenzen erlebnispädagogische Programme vermitteln können und unter welchen Bedingungen der Transfer des Erlebten in das Alltagsgeschehen der Teilnehmer1 gelingen kann.
Anschließend daran folgt als Praxisbezug das erlebnispädagogische Medium Klettern und dessen spezifisches Lernprofil. Zuletzt werden die gesellschaftlichen und individuellen Anforderungen im Übergang vom Jugend- ins Erwachsenenalter und die Lernziele der Erlebnispädagogik miteinander in Verbindung gebracht werden. An dieser Stelle soll explizit darauf hingewiesen werden, dass die gesamte Argumentation der vorliegenden Arbeit auf Erkenntnissen aus der Fachliteratur und nicht auf einer eigenständigen, wissenschaftlichen Studie beruht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vom Jugend- ins Erwachsenenalter
- Versuch einer Annäherung
- Jugendalter
- Erwachsenenalter
- Emerging Adulthood
- Anforderungen im Übergang
- Initiationsriten
- Gefahren unspezifischer Übergänge
- Charakterkompetenzen als gesellschaftliche Anforderungen
- Identitätsentwicklung als individuelle Herausforderungen
- Erlebnispädagogik
- Versuch einer Definition
- Historische Entwicklung
- Lernziele und Kompetenzen
- Wie können diese Lernziele vermittelt werden?
- Vom Erlebten zum Erlernten
- Praxisbezug am Beispiel Klettern
- Klettern als pädagogisches Medium
- Welche Kompetenzen kann das Klettern vermitteln?
- Erlebnispädagogik und der Übergang vom Jugend- ins Erwachsenenalter
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelor-Thesis untersucht, ob Angebote der Erlebnispädagogik den Übergang vom Jugend- ins Erwachsenenalter mitgestalten und unterstützen können. Ziel ist es, die Herausforderungen des Erwachsenwerdens mit dem Kompetenzprofil erlebnispädagogischer Programme in Verbindung zu bringen und neue Erkenntnisse und Möglichkeiten für die Arbeit mit Jugendlichen im Prozess des Erwachsenwerdens herauszuarbeiten.
- Jugend- und Erwachsenenalter als komplexe Lebensphasen
- Anforderungen und Herausforderungen im Übergang
- Erlebnispädagogik als pädagogische Methode zur Kompetenzentwicklung
- Praxisbezug: Klettern als erlebnispädagogisches Medium
- Verbindung zwischen Erlebnispädagogik und dem Übergang vom Jugend- ins Erwachsenenalter
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor: Können Angebote der Erlebnispädagogik den Übergang vom Jugend- ins Erwachsenenalter mitgestalten und unterstützen? Die Relevanz der Thematik wird anhand der Herausforderungen des Erwachsenwerdens in der heutigen Zeit verdeutlicht.
- Vom Jugend- ins Erwachsenenalter: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Definitionen und Entwicklungen der Lebensphasen Jugend und Erwachsenenalter sowie dem Konzept des "Emerging Adulthood". Es werden die Anforderungen und Herausforderungen im Übergang vom Jugend- ins Erwachsenenalter betrachtet, insbesondere die Rolle von Initiationsriten, die Gefahren unspezifischer Übergänge und die Bedeutung von Charakterkompetenzen und Identitätsentwicklung.
- Erlebnispädagogik: Dieses Kapitel liefert eine Definition der Erlebnispädagogik, zeichnet ihre historische Entwicklung nach und beleuchtet Lernziele und Kompetenzen, die durch erlebnispädagogische Programme vermittelt werden können. Die Frage, wie der Transfer des Erlebten in das Alltagsgeschehen der Teilnehmer gelingen kann, steht ebenfalls im Fokus.
- Praxisbezug am Beispiel Klettern: In diesem Kapitel wird das erlebnispädagogische Medium Klettern als Beispiel vorgestellt. Es wird erläutert, welche spezifischen Lernprofile das Klettern bietet und welche Kompetenzen durch diese Aktivität vermittelt werden können.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Bachelor-Thesis umfassen: Jugend, Erwachsenenalter, Übergang, Erlebnispädagogik, Kompetenzentwicklung, Klettern, Identitätsentwicklung, Charakterkompetenzen, Initiationsriten, Emerging Adulthood.
Häufig gestellte Fragen
Kann Erlebnispädagogik den Übergang zum Erwachsenenalter unterstützen?
Die Arbeit untersucht, wie erlebnispädagogische Programme gezielt Kompetenzen vermitteln, die für ein gesundes Erwachsenwerden und die Identitätsentwicklung notwendig sind.
Was bedeutet der Begriff "Emerging Adulthood"?
Er beschreibt eine neue Lebensphase zwischen Jugend und vollem Erwachsenenalter, in der junge Menschen explorieren und noch keine festen sozialen Rollen eingenommen haben.
Warum sind Initiationsriten heute noch relevant?
Die Arbeit diskutiert die Gefahren unspezifischer Übergänge und wie pädagogisch begleitete Erlebnisse als moderne Form von Reifeprüfungen dienen können.
Wie fördert Klettern die Charakterkompetenz?
Klettern dient als Medium, um Verantwortung, Vertrauen, Grenzenerfahrung und Problemlösefähigkeiten in einer kontrollierten, aber herausfordernden Umgebung zu schulen.
Wie gelingt der Transfer vom Erlebnis in den Alltag?
Die Untersuchung beleuchtet Bedingungen, unter denen die im Wald oder am Fels gemachten Erfahrungen nachhaltig in das Alltagsgeschehen der Teilnehmer integriert werden können.
- Quote paper
- Christopher Hahn (Author), 2015, Erlebnispädagogik im Übergang vom Jugend- ins Erwachsenenalter. Ein mitgestaltendes Element, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/703443