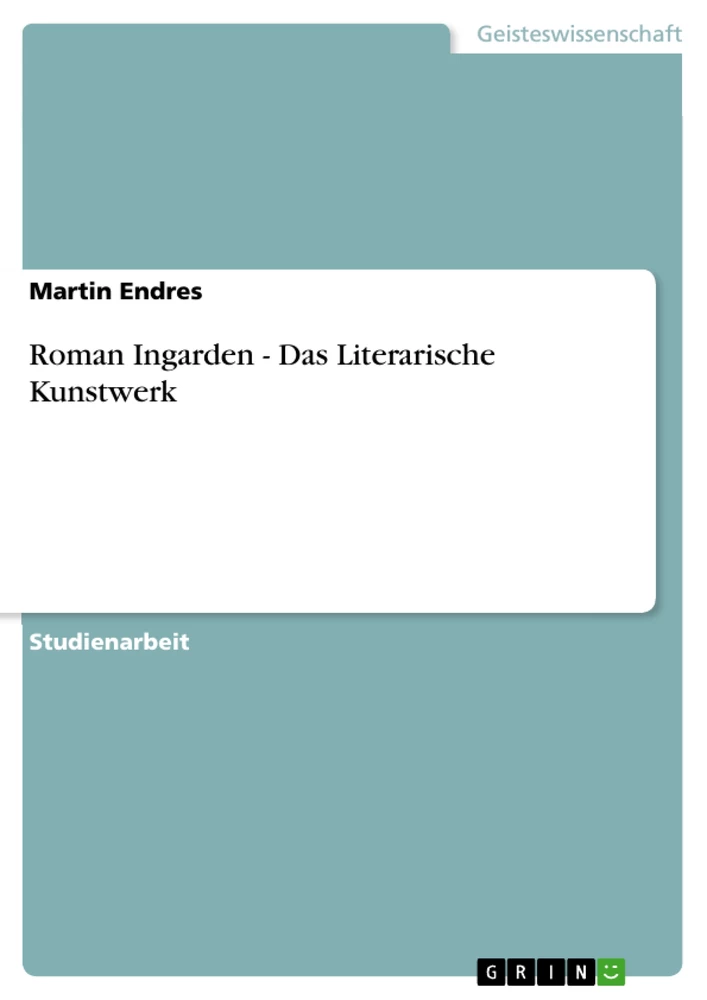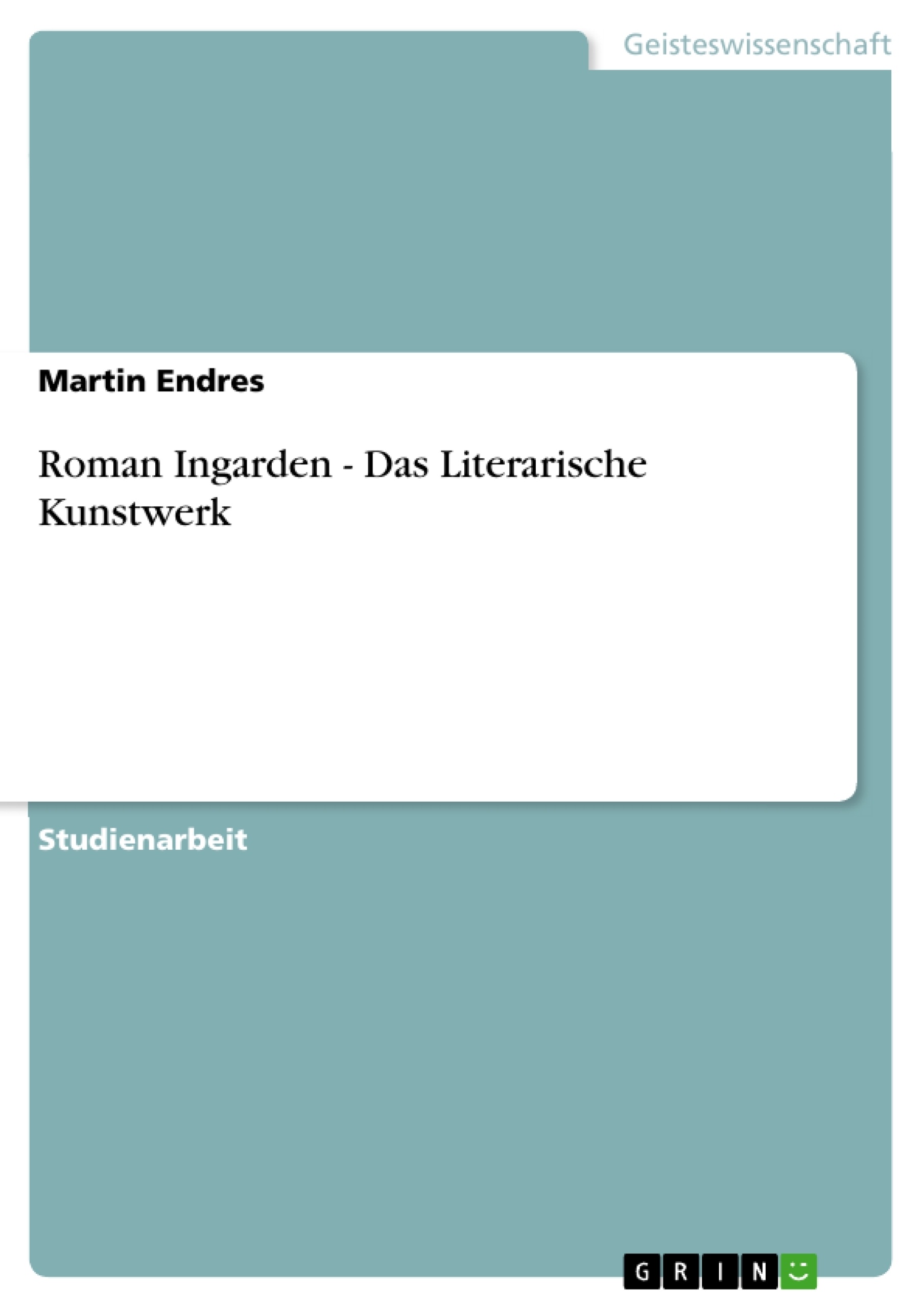2. Einleitung
Roman Ingarden betreibt in seinem 1931 veröffentlichten Werk ,,Das literarische Kunstwerk“ neben einer Ontologie im Sinne der Kunstrezeption sowohl eine rein strukturelle als auch existentiell-ontologische Untersuchung literarischer Werke, um sie darüber hinaus in Bezug auf das Idealismus-Realismus-Problem in Frage zu stellen. Parallelen zu Husserls Phänomenologie lassen sich in verschiedener Weise erkennen. Besonders tritt hier die Idee einer rein intentionalen Gegenständlichkeit hinsichtlich eines Textes bzw. einer Gruppe zusammenhängender Sätze auf. Der Ausgangspunkt, auf den Ingarden seine Überlegungen gründet, geht maßgeblich von der bereits von Edmund Husserl formulierten Frage aus, wie die aus reiner Subjektivität geschaffenen Gegenständlichkeiten, die als ideale Objekte einer idealen ´Welt´ bezeichnet werden könnten, sich in der als real anzusprechenden Kulturwelt in einem zeitlich-räumlich gebundenen Dasein manifestieren. Nach Ingarden sind derartige Gebilde aus dem Bereich der Idealitäten aus der realen Welt auszuschließen. Während Husserl in seinem Werk ,,Formale und transzendentale Logik“ alle bisher angenommenen idealen Gegenstände für intentionale Gegenstände besonderer Art hält, so vertritt Ingarden die Unterscheidung in ideale Begriffe, ideale individuelle Gegenstände, Ideen und Wesenheiten.
Roman Ingarden spricht sich in seinem Werk explizit gegen eine psychologistisch gefärbte Wesensinterpretation literarischer Kunstwerke aus und distanziert sich somit von einer Fülle von Literaturkritikern, die das Zurückführen von Literatur auf ihren Kern mit dem für sie unausweichlichen psychologischen Ursprung der Zusammenhänge und deren Auflösung in Verbindung bringen. Damit schlägt er wiederum eine Brücke zu Edmund Husserl, der fordert, daß jemand, der Phänomenologie betreibt, sich von allen ,,natürlichen Wissenschaften“ frei machen muß und nichts voraussetzen darf, was für jene laut Husserl den Beginn ihrer Untersuchungen prägt: ,,Und wieder liegt darin, daß die reine Philosophie innerhalb der gesamten Erkenntniskritik und der ,,kritischen“ Disziplinen überhaupt von der ganzen in den natürlichen Wissenschaften und in der wissenschaftlich nicht organisierten natürlichen Weisheit und Kunde geleisteten Denkarbeit absehen muß und von ihr keinerlei Gebrauch machen darf.“1
[...]
______
1 E.Husserl, ,,Die Idee der Phänomenologie“, Hamburg 1986
Inhaltsverzeichnis
- Biographisches zu Roman Ingarden
- Einleitung
- Das literarische Werk
- Die Schicht der Gegenständlichkeiten
- Die Schicht der schematisierten Ansichten
- Die Rolle der Schicht der schematisierten Ansichten im literarischen Werk
- Die Rolle der Gegenständlichkeiten
- Kritische Betrachtung der Philosophie Ingardens
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Werk „Das literarische Kunstwerk“ von Roman Ingarden und untersucht dessen Grundgedanken im Kontext der Phänomenologie. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Analyse der Gegenständlichkeiten und deren Ansichten im literarischen Werk.
- Die Beziehung zwischen Idealität und Realität in literarischen Werken
- Die Rolle der Intentionen und der Gegenstandsstruktur in der Rezeption von Literatur
- Die Unterscheidung zwischen realen und intentionalen Gegenständen
- Die Kritik an psychologistischen Interpretationen von Literatur
- Die Anwendung der Epoché als Methode zur Objektivierung des literarischen Werks
Zusammenfassung der Kapitel
Biographisches zu Roman Ingarden
Das Kapitel liefert eine kurze Biographie von Roman Ingarden, beginnend mit seiner Geburt in Krakau bis zu seinen frühen Studienjahren in Lwów und Göttingen. Es werden die prägenden Begegnungen mit Edmund Husserl, Ingardens Dissertation und seine Habilitationsschrift erwähnt.
Einleitung
Die Einleitung stellt Ingardens Werk „Das literarische Kunstwerk“ vor und beschreibt dessen Zielsetzung: eine ontologische, strukturelle und existentiell-ontologische Untersuchung literarischer Werke. Die Verbindung zu Husserls Phänomenologie wird hervorgehoben, insbesondere die Frage nach der Entstehung von idealen Objekten in der realen Kulturwelt.
Das literarische Werk
Die Schicht der Gegenständlichkeiten
Dieses Kapitel behandelt die von Ingarden postulierte „Schicht der Gegenständlichkeiten“, die im literarischen Werk dargestellt werden. Dabei geht es um die Unterscheidung zwischen Gehalt und intentionaler Gegenstandsstruktur. Ingarden argumentiert, dass die Gegenständlichkeiten im literarischen Werk nie isoliert existieren, sondern stets einen Hintergrund und eine Seinssphäre mit sich bringen.
- Arbeit zitieren
- Martin Endres (Autor:in), 2001, Roman Ingarden - Das Literarische Kunstwerk, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/704