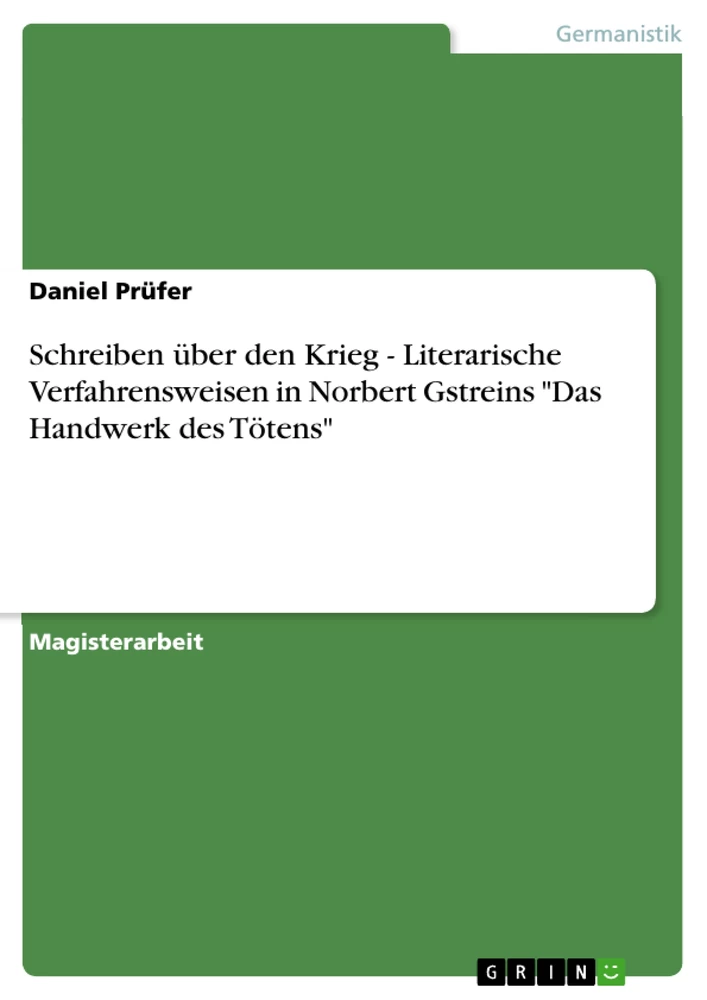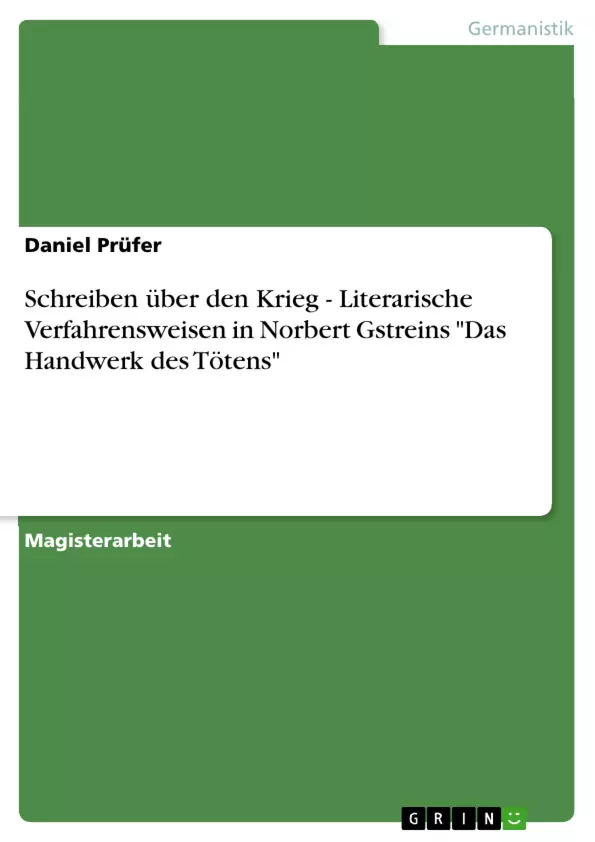DIE SCHALEK: Sie, Herr Oberleutnant, wissen Sie was, ich möcht bißl schießen. / [...] /
(Die Schalek schießt. Der Feind erwidert)
Der Offizier: Also da ham mrs!
DIE SCHALEK: Was wollen Sie haben? Das is doch interessant!
„Die Schalek“ in dem Drama Die letzten Tage der Menschheit von Karl Kraus’ ist keine literarische Figur in dem Sinne, dass sie von dem Autor frei erfunden worden ist, sondern verweist auf die Photographin, Reisejournalistin, Literatin und Kriegsberichterstatterin Alice Schalek, die im 1. Weltkrieg für das k.u.k. Kriegspressequartier tätig gewesen ist und sich somit in von Männern dominierten Bereichen behaupten konnte. Zwar sind ihre Arbeiten heute nahezu vergessen, doch bleibt ihr ein zweifelhafter Ruhm als Satireopfer in der von Karl Kraus herausgegebenen Zeitschrift Die Fackel sowie als „Die Schalek“ in Die letzten Tage der Menschheit erhalten. Kraus macht sie zum Rollenmodell des sensationslüsternen Kriegsreporters, der nicht nur neutral vom Krieg berichtet, sondern - und das ist das Entscheidende - selbst zum Handelnden wird. Doch wie ist der oben zitierte Satz aus Kraus’ Drama zu verstehen? Geht es um das tatsächliche Kämpfen mit der Waffe oder sind es die Worte und Photographien, die zur Waffe werden können? Ende der 70er Jahre hat der Direktor des Wiener Heeresgeschichtlichen Museums, Johann Allmayer-Beck, Photographien von der Emigrantin Alice Schaleck in New York entdeckt, welche bezüglich seiner Empfehlung von der Nationalbibliothek in Wien angekauft worden sind. Den Nachnamen Allmayer trägt auch die zentrale Figur in Norbert Gstreins Roman Das Handwerk des Tötens, die von einem sogenannten Warlord ermutigt wird, zu töten. Ob sie dem nachkommt, bleibt letzten Endes offen. Norbert Gstrein befasst sich in diesem 2003 veröffentlichten Roman, der Gegenstand dieser Arbeit ist, mit den Balkankriegen der 90er Jahre. Ausgezeichnet wurde Das Handwerk des Tötens noch im Erscheinungsjahr mit dem „Uwe Johnson-Preis“ und dem „Franz Nabl-Preis“.
Die Literatur hat sich bisher auf die unterschiedlichste Art und Weise dem Thema der Balkankriege angenommen. Der österreichische Autor Peter Handke hat mit seinen Büchern, die explizit den Krieg in den Teilrepubliken Jugoslawien zur Grundlage haben, die nachhaltigsten Debatten in den deutschsprachigen Feuilletons ausgelöst.
Inhaltsverzeichnis
- I. Exposition
- II. Dekonstruktion
- II. 1. Die Erzählung
- II. 1.1. Ordnung und Dauer
- II. 1.2. Frequenz
- II. 1.3. Aporien durch repetitives Erzählen
- II.2. Poetik
- II.2.1. Allegorien des Lesens
- II.2.2. Norbert Gstreins Poetologie
- II.2.3. Pauls Romankonzeption
- II.2.3.1. Recherche
- II.2.3.2. Genese eines nicht vorhandenen Romans
- II.2.3.3. Konzeption hermeneutischer Sinnstiftung
- II.2.3.4. Fiktionalisieren der Wirklichkeit
- II.2.4. Die Dekonstruktion durch den Ich-Erzähler
- II.2.4.1. Referentielle Bezüge
- II.2.4.1.1. Geschichte und Plot
- II.2.4.1.2. Tropen
- II.2.4.1.3. Film
- II.2.4.1.4. Journalismus
- II.2.4.2. Dekonstruktion des Sprechakts
- II.2.4.1. Referentielle Bezüge
- II.3. Resümee
- II. 1. Die Erzählung
- III. Intertextualität
- III.1. Widmung
- III.1.1. Gabriel Grüner
- III.1.2. Bezüge zu Gabriel Grüners Veröffentlichungen
- III.1.3. Ich bin ein Mädchen aus Sarajevo
- III.1.4. Peter Handke
- III.1.5. Juli Zeh
- III.2. Titel und Zwischentitel
- III.2.1. Das Handwerk des Tötens
- III.2.2. Stories & Shots
- III.2.3. Traumstrassen in Jugoslawien
- III.2.4. Miss Slavonski Brod
- III.2.5. Eine schöne Geschichte
- III.3. Resümee
- III.1. Widmung
- IV. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit analysiert die literarischen Verfahrensweisen in Norbert Gstreins Roman "Das Handwerk des Tötens" im Kontext der Balkankriege. Die Arbeit untersucht, wie Gstrein das Thema Krieg literarisch verarbeitet und welche Erzähltechniken er dabei einsetzt. Ein Fokus liegt auf der Dekonstruktion von Erzählstrukturen und der Intertextualität des Romans.
- Literarische Analyse der Erzähltechniken in "Das Handwerk des Tötens"
- Untersuchung der Dekonstruktion von narrativen Strukturen
- Analyse der Intertextualität und der Bezüge zu anderen literarischen Werken
- Die Darstellung des Krieges und seiner Auswirkungen
- Die Rolle des Ich-Erzählers und seine Funktion in der Dekonstruktion
Zusammenfassung der Kapitel
I. Exposition: Diese Einleitung beleuchtet den Kontext des Romans, indem sie die Figur "Die Schalek" aus Karl Kraus' Werk als Ausgangspunkt nimmt und die verschiedenen literarischen Auseinandersetzungen mit den Balkankriegen skizziert. Es wird gezeigt, wie unterschiedliche Gattungen – von Reiseberichten bis hin zu Tagebüchern – dieses Thema aufgreifen und wie diese literarischen Ansätze mit Gstreins Roman in Verbindung stehen. Die Erwähnung von Autoren wie Peter Handke, Juli Zeh und Zlata Filipović verdeutlicht die vielfältigen Perspektiven auf den Krieg und bereitet den Leser auf die Komplexität von Gstreins Werk vor. Die unterschiedlichen Herangehensweisen an die Darstellung des Konflikts werden kontrastiert, um die Eigenständigkeit von Gstreins Roman hervorzuheben.
Schlüsselwörter
Norbert Gstrein, Das Handwerk des Tötens, Balkankriege, Erzähltechnik, Dekonstruktion, Intertextualität, Literaturwissenschaft, Kriegsliteratur, Narratologie, Romanautor, Postmoderne.
Häufig gestellte Fragen zu Norbert Gstreins "Das Handwerk des Tötens"
Was ist der Inhalt dieser HTML-Datei?
Diese HTML-Datei bietet eine umfassende Übersicht über eine Magisterarbeit, die sich mit Norbert Gstreins Roman "Das Handwerk des Tötens" auseinandersetzt. Sie enthält ein detailliertes Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und die zentralen Themen der Arbeit, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Analyse der literarischen Verfahren, insbesondere der Erzähltechniken, der Dekonstruktion narrativer Strukturen und der Intertextualität des Romans im Kontext der Balkankriege.
Welche Themen werden in der Magisterarbeit behandelt?
Die Magisterarbeit analysiert die literarischen Verfahren in Gstreins Roman "Das Handwerk des Tötens" im Kontext der Balkankriege. Schwerpunkte sind die Untersuchung der Erzähltechniken, die Dekonstruktion von Erzählstrukturen, die Intertextualität des Romans, die Darstellung des Krieges und seiner Auswirkungen sowie die Rolle des Ich-Erzählers bei der Dekonstruktion. Die Arbeit beleuchtet, wie Gstrein das Thema Krieg literarisch verarbeitet und welche Techniken er dabei einsetzt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in vier Hauptteile gegliedert: Eine Exposition, die den Kontext des Romans und die Auseinandersetzung mit den Balkankriegen in der Literatur beleuchtet; einen Teil zur Dekonstruktion, der die Erzählstruktur, die Poetik Gstreins und die Rolle des Ich-Erzählers analysiert; einen Abschnitt zur Intertextualität, der Bezüge zu anderen Werken und Autoren untersucht (u.a. Gabriel Grüner, Peter Handke, Juli Zeh); und abschließend ein Resümee.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Norbert Gstrein, Das Handwerk des Tötens, Balkankriege, Erzähltechnik, Dekonstruktion, Intertextualität, Literaturwissenschaft, Kriegsliteratur, Narratologie, Romanautor, Postmoderne.
Welche Autoren und Werke werden in der Arbeit erwähnt?
Die Arbeit erwähnt neben Norbert Gstrein und seinem Roman "Das Handwerk des Tötens" auch Karl Kraus ("Die Schalek"), Gabriel Grüner, Peter Handke, Juli Zeh und Zlata Filipović. Es wird der Bezug zu deren Werken und deren unterschiedlichen Perspektiven auf den Krieg und die Balkankriege hergestellt.
Was ist der Fokus der Dekonstruktionsanalyse?
Die Dekonstruktionsanalyse konzentriert sich auf die Erzählstruktur des Romans, die Poetik Norbert Gstreins, und besonders auf die Rolle des Ich-Erzählers und dessen Funktion in der Dekonstruktion. Es werden Aspekte wie Ordnung und Dauer, Frequenz, repetitive Erzählweisen, allegorische Elemente des Lesens und die referentiellen Bezüge des Erzählers (Geschichte und Plot, Tropen, Film, Journalismus) untersucht.
Wie wird die Intertextualität in der Arbeit behandelt?
Die Intertextualität wird anhand der Widmung, des Titels und der Zwischentitel des Romans untersucht. Es werden die Bezüge zu den Werken und dem Leben der erwähnten Autoren (insbesondere Gabriel Grüner, Peter Handke und Juli Zeh) analysiert, um die vielschichtigen Bedeutungszusammenhänge des Romans aufzuzeigen.
- Quote paper
- Magister Artium Daniel Prüfer (Author), 2004, Schreiben über den Krieg - Literarische Verfahrensweisen in Norbert Gstreins "Das Handwerk des Tötens", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/70589