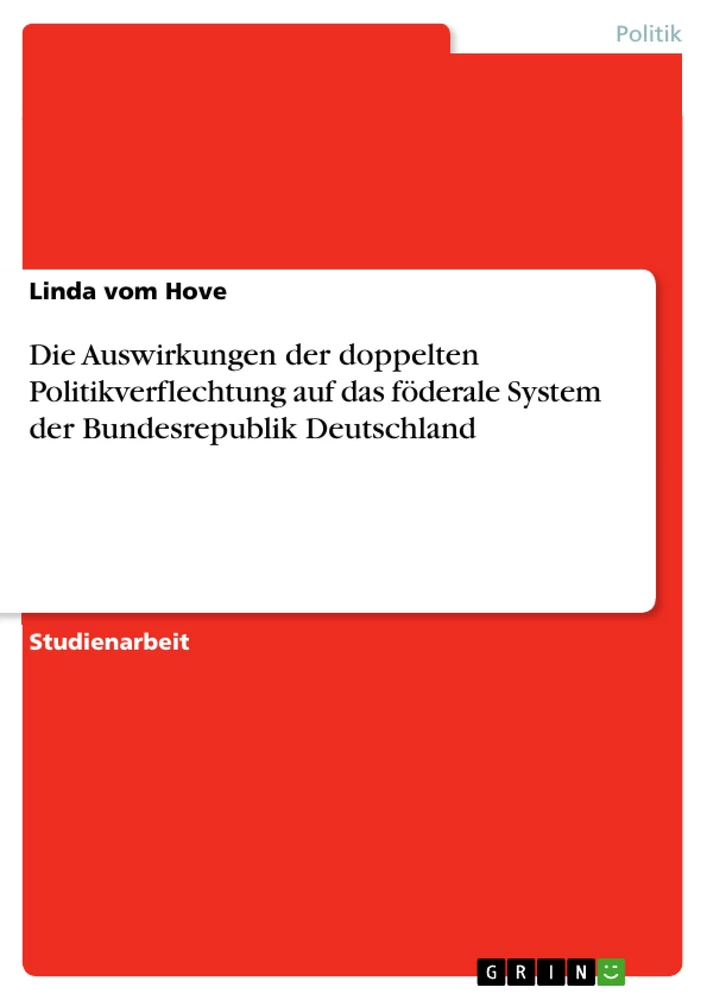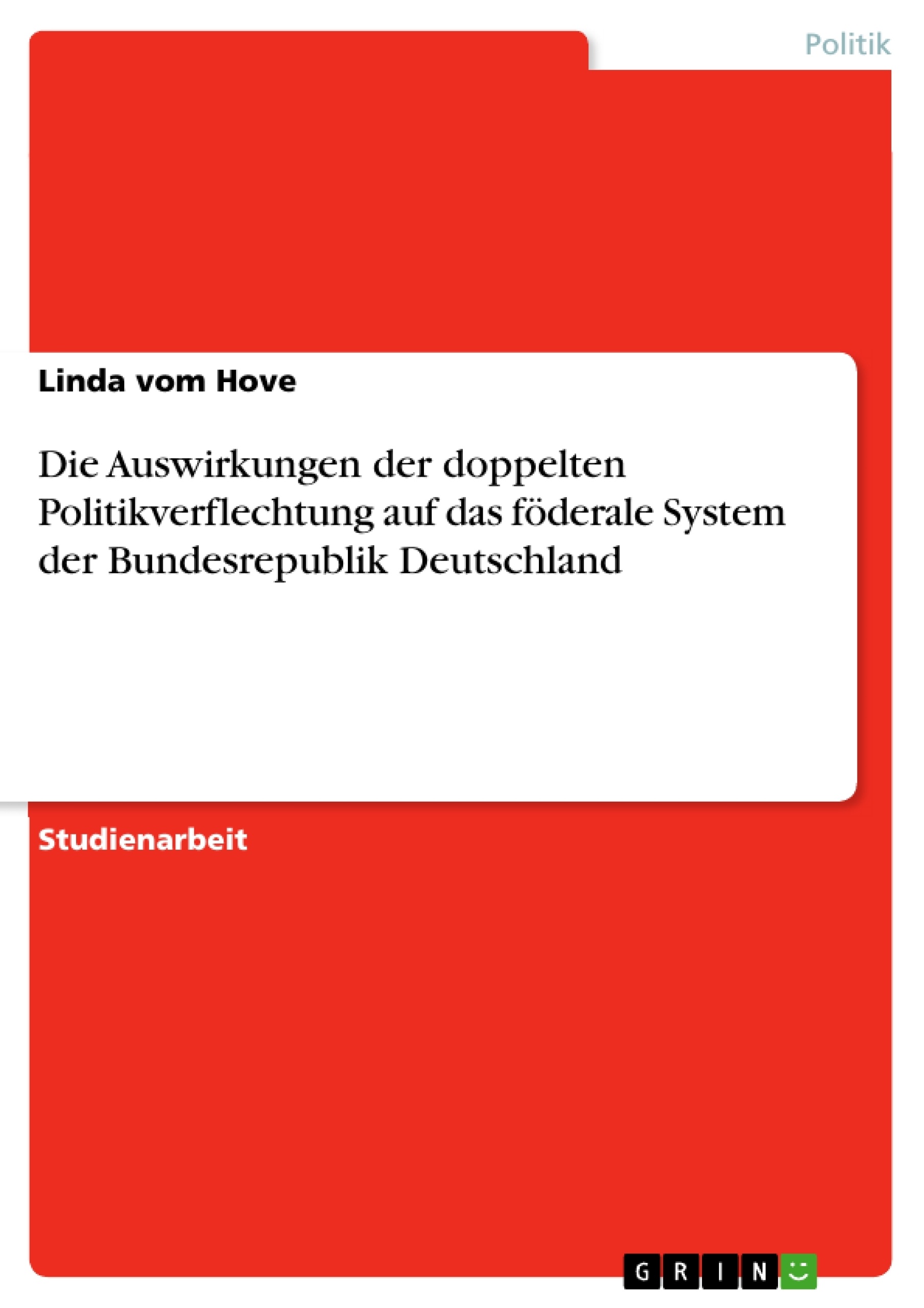Seit Formulierung der Politikverflechtungstheorie von Fritz Scharpf ist nunmehr ein Vierteljahrhundert vergangen und die Theorie leistet nach wie vor einen Beitrag zum Verständnis des Problemlösungsverhaltens des deutschen Föderalismus. „Politikverflechtung, definiert als institutionalisierte Mitwirkung nachgeordneter Gebietskörperschaften an der Willensbildung auf der übergeordneten Entscheidungsebene“(Scharpf 1994: 7), ist immer noch eines der wesentlichen Merkmale des deutschen politischen Systems. Die Politikverflechtung hat sich im Laufe der Jahre sogar immer mehr verstärkt, denn Bund wie Länder haben versucht ihren Verlust an eigenständigen Kompetenzen durch die Mitwirkung auf der jeweils anderen politischen Systemebene zu kompensieren. Mit der Ausweitung der Theorie auf die europäische Ebene als doppelte Politikverflechtung gewann die Theorie in den 80er Jahren erneut an Aktualität. Der deutsche Bundesstaat stand und steht nämlich nun vor der Herausforderung die innerstaatliche Kompetenzverteilung in der Bundesrepublik zu bewahren und gleichzeitig den Erfordernissen der Europäischen Union gerecht zu werden. Dieser Herausforderung wurde mit weiteren Verflechtungsarten begegnet: Die Länder haben nach und nach mittels verschiedenster Strategien ihren Einfluss auf die europäische Ebene immer mehr verstärken können, so dass sie heute über den Bundesrat, den Ausschuss der Regionen, ihre Länderbüros in Brüssel und horizontale Kooperation mit anderen Regionen ihren Interessen Geltung verschaffen. In dieser Hausarbeit soll jedoch nicht versucht werden zu klären, ob die deutschen Länder im Europäisierungsprozess Kompetenzen gewonnen oder verloren haben, denn dies bedürfte einer Politikfeldanalyse. Vielmehr soll deutlich gemacht werden, inwiefern diese neuartigen Verflechtungsformen, die doppelte Politikverflechtung, sich auf die Entscheidungsprozesse, Institutionen und Politikinhalte in der Bundesrepublik auswirken. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Analyserahmen
- Die Politikverflechtungstheorie von Scharpf und die der doppelten Politikverflechtung in Theorie und Praxis
- Die Politikverflechtungstheorie
- Formen der Politikverflechtung in der Bundesrepublik
- Die doppelte Politikverflechtung
- Die Mitwirkung der Länder auf europäischer Ebene. Modifizierung des nationalen politischen Systems
- Verstärkung des Exekutivföderalismus
- Eine „hinkende Dreier-Beziehung“?
- Ist die Staatlichkeit der Länder in Gefahr?
- Verflechtung oder Entflechtung?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit den Auswirkungen der doppelten Politikverflechtung auf das föderale System der Bundesrepublik Deutschland. Im Zentrum stehen dabei die Veränderungen, die durch die Mitwirkung der Länder auf europäischer Ebene auf die innerstaatliche Kompetenzverteilung und die Entscheidungsprozesse in Deutschland entstehen.
- Die Rezeption und Erklärungskraft der Politikverflechtungstheorie im Kontext der doppelten Politikverflechtung
- Die Auswirkungen der doppelten Politikverflechtung auf die Entstehung und Qualität politischer Entscheidungen in Deutschland
- Die Auswirkungen der doppelten Politikverflechtung auf die Institutionen in Deutschland, insbesondere auf das Verhältnis zwischen Bund und Ländern
- Die Rolle der Landesparlamente im Prozess der Europäisierung
- Die Relevanz der doppelten Politikverflechtung für den Exekutivföderalismus in Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der doppelten Politikverflechtung ein und skizziert die Relevanz der Theorie für die Analyse des deutschen Föderalismus. Der Analyserahmen beschreibt die empirische und analytische Vorgehensweise der Arbeit sowie die zu überprüfenden Arbeitshypothesen. Kapitel 3 stellt die Politikverflechtungstheorie von Fritz Scharpf und deren Erweiterung auf die Europäische Union als doppelte Politikverflechtung dar. Die Kapitel 4.1 bis 4.4 befassen sich mit den Auswirkungen der doppelten Politikverflechtung auf den Exekutivföderalismus, die Beziehung zwischen Bund, Ländern und der EU sowie die Rolle der Landesparlamente im Europäisierungsprozess.
Schlüsselwörter
Politikverflechtung, doppelte Politikverflechtung, Föderalismus, Exekutivföderalismus, Europäische Union, Länder, Bund, Landesparlamente, Entscheidungsprozesse, Institutionen, Kompetenzverteilung, Europäisierung
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Fritz Scharpf unter Politikverflechtung?
Scharpf definiert Politikverflechtung als die institutionalisierte Mitwirkung nachgeordneter Gebietskörperschaften (z.B. Bundesländer) an der Willensbildung auf der übergeordneten Ebene (z.B. Bund).
Was ist die "doppelte Politikverflechtung"?
Dies beschreibt die Erweiterung der Verflechtung auf die europäische Ebene: Die Länder wirken nicht nur im Bund mit, sondern versuchen auch direkt Einfluss auf EU-Entscheidungen zu nehmen.
Wie nehmen die Bundesländer Einfluss auf die Europäische Union?
Dies geschieht über den Bundesrat, den Ausschuss der Regionen, eigene Länderbüros in Brüssel und die Zusammenarbeit mit anderen europäischen Regionen.
Was bedeutet die Verstärkung des Exekutivföderalismus?
Es beschreibt den Trend, dass Entscheidungsprozesse zunehmend zwischen den Regierungen (Exekutiven) von Bund, Ländern und EU ausgehandelt werden, während Parlamente an Einfluss verlieren.
Ist die Staatlichkeit der Bundesländer durch die EU in Gefahr?
Die Arbeit untersucht, ob die Länder durch den Kompetenzverlust an die EU an Bedeutung verlieren oder ob sie diesen Verlust durch neue Formen der Mitwirkung kompensieren können.
Welche Rolle spielen Landesparlamente im Europäisierungsprozess?
Die Landesparlamente stehen vor der Herausforderung, ihre Kontrollfunktion gegenüber den Landesregierungen zu wahren, die zunehmend auf europäischer Ebene agieren.
- Citation du texte
- Linda vom Hove (Auteur), 2006, Die Auswirkungen der doppelten Politikverflechtung auf das föderale System der Bundesrepublik Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/70622