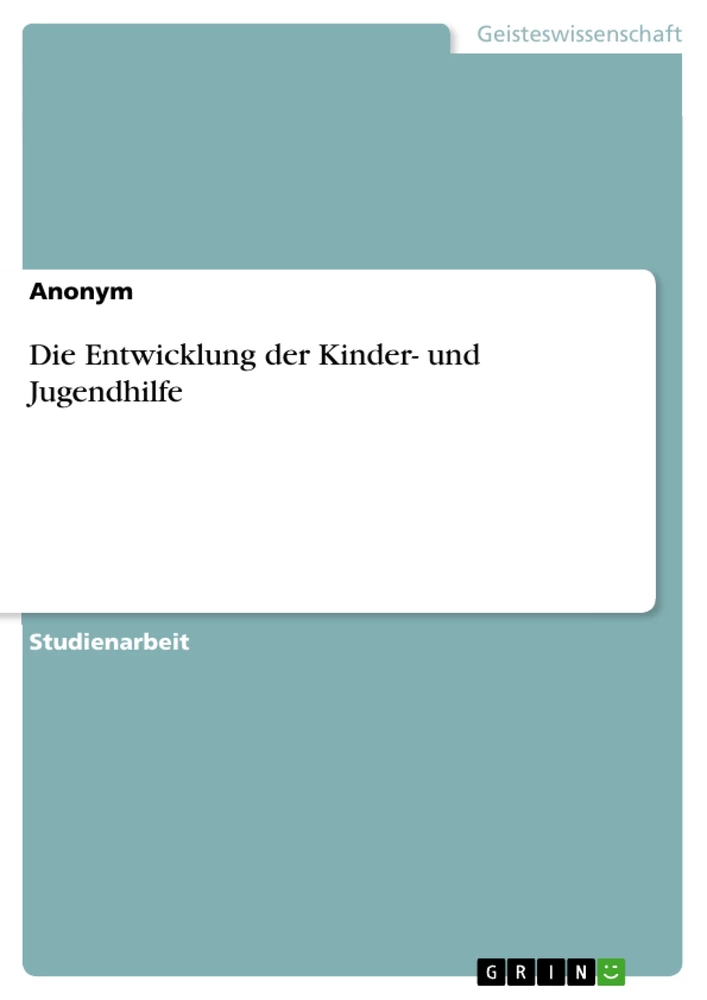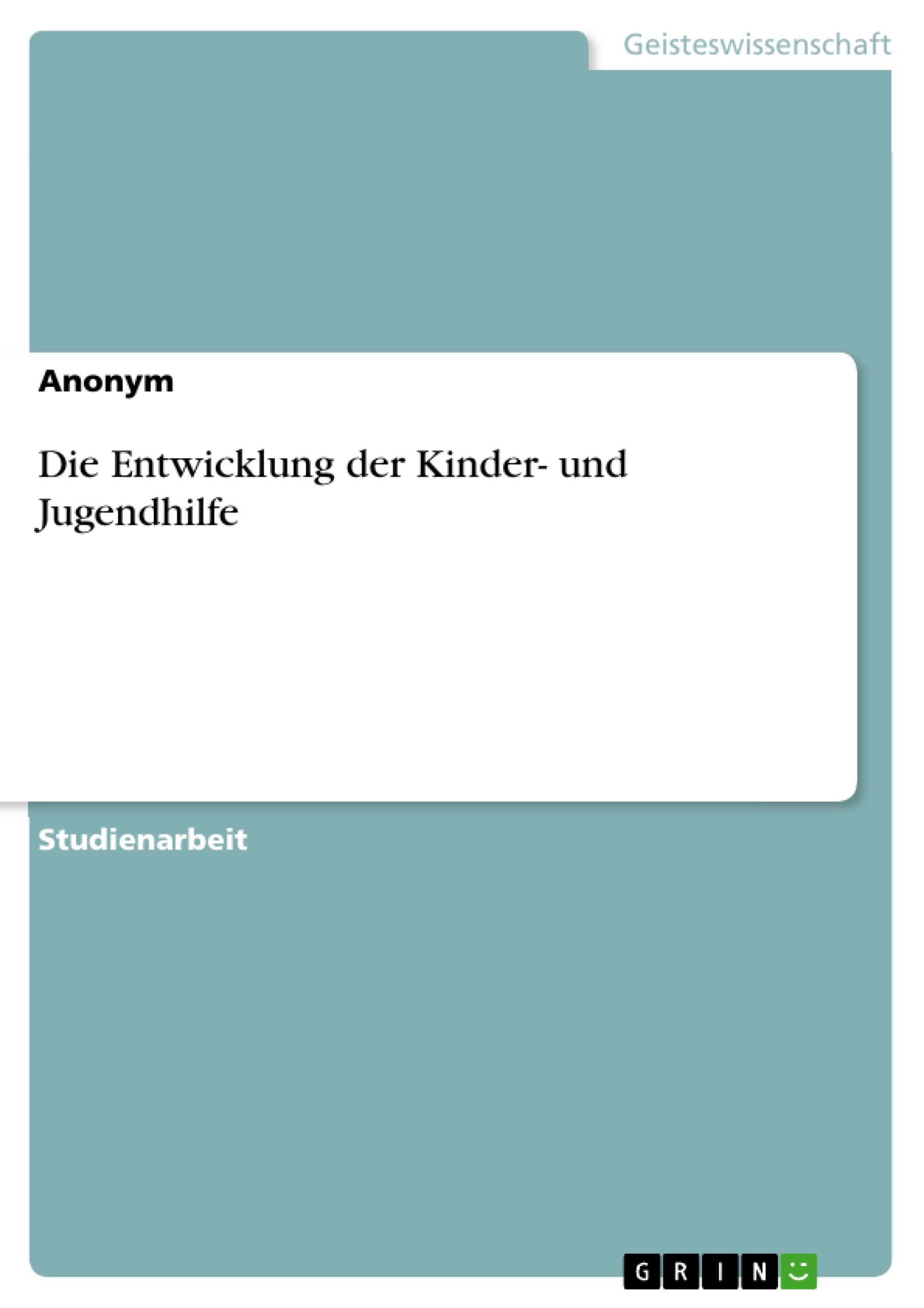Es stellt sich die Frage, wie die Kinder- und Jugendhilfe in der Vergangenheit gesetzlich festgelegt und praktiziert wurde und wie sich dies auf die heutige Rechtslage und Praxis ausgewirkt hat. Das Ziel meiner Ausführungen ist es, diesen Prozess sichtbar zu machen, indem die Lebenslagen und die damit verbundenen sozialen Probleme der Kinder und Jugendlichen,sowie die rechtlichen Bestimmungen chronologisch beleuchtet werden.
Zu Beginn möchte ich das Arbeitsfeld der Kinder- und Jugendhilfe aus heutiger Sicht, verbunden mit den rechtlichen Grundlagen, darstellen, um dem Leser anschließend die Ausmaße der Entwicklung besser aufzeigen zu können. Mir ist bewusst, dass es sich, insbesondere heutzutage, bei der Kinder- und Jugendhilfe um einen sehr breit gefächerten Bereich der Sozialen Arbeit handelt. Aufgrund der vorgegebenen Kapazität dieser Hausarbeit werde ich im Folgenden immer allgemein von der Kinder- und Jugendhilfe sprechen und mich nur in für mich wichtig erscheinenden Abschnitten auf einzelne Bereiche dieser konzentrieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition Kinder- und Jugendhilfe
- Die Ursprünge der Kinder- und Jugendfürsorge
- Erziehung im Zuchthaus
- Private Kinder- und Jugendfürsorge im 19. Jahrhundert
- Die Rettungshausbewegung
- Eingrenzung der Kinderarbeit
- Einführung der Berufsvormundschaft
- Jugendhilfe in der Weimarer Republik
- Die Situation der Jugendlichen in der Weimarer Republik
- Das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz
- Jugendhilfe im NS-Staat
- Der NS-Staat und das RJWG
- Die Nationalsozialistische Volkswohlfahrt - Jugendhilfe
- Die „Hitler-Jugend“
- Jugendhilfe nach 1945
- Ausbau der gesetzlichen Grundlagen
- Reform des Jugendhilferechts
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, die Entwicklung der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland chronologisch darzustellen und aufzuzeigen, wie sich die Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen sowie die entsprechenden rechtlichen Bestimmungen im Laufe der Zeit verändert haben. Die Arbeit beleuchtet den Einfluss gesellschaftlicher Entwicklungen auf die Gestaltung und Praxis der Kinder- und Jugendhilfe.
- Entwicklung der Kinder- und Jugendhilfe im historischen Kontext
- Wandel des Menschenbildes und seine Auswirkungen auf die Kinder- und Jugendfürsorge
- Einfluss von politischen und gesellschaftlichen Systemen auf die Kinder- und Jugendhilfe
- Rechtliche Grundlagen und ihre Entwicklung
- Vergleichende Betrachtung verschiedener Epochen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Entwicklung der Kinder- und Jugendhilfe ein und beschreibt die Zielsetzung der Arbeit. Sie betont den dynamischen Charakter der Kinder- und Jugendhilfe als Reaktion auf gesellschaftliche Veränderungen und den Fokus auf die Darstellung des historischen Prozesses, der Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen und die entsprechenden rechtlichen Bestimmungen beleuchtet.
Definition Kinder- und Jugendhilfe: Dieses Kapitel definiert den Begriff Kinder- und Jugendhilfe aus heutiger Sicht, basierend auf dem SGB VIII. Es erläutert die rechtlichen Grundlagen, die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe, die verschiedenen Leistungsbereiche und die Rolle der Jugendämter und freier Träger. Der Fokus liegt auf der Freiwilligkeit der Hilfe, dem Schutz von Kindern bei Kindeswohlgefährdung und der Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen.
Die Ursprünge der Kinder- und Jugendfürsorge: Dieses Kapitel befasst sich mit den Anfängen der Kinder- und Jugendfürsorge im Mittelalter und der frühen Neuzeit. Es beschreibt die Rolle kirchlicher Stiftungen und die Entwicklung von Familienpflege und Anstaltserziehung. Der Wandel des Menschenbildes und die damit verbundenen Veränderungen in der sozialen Fürsorge, sowie die repressiven Maßnahmen der Obrigkeit zur Reduzierung von Armut und Kindervernachlässigung werden analysiert. Die Kapitel zeigt den Übergang von einem gottgewollten Verständnis von Armut hin zu einem Verständnis von Armut als Ergebnis von Arbeitsscheu und persönlichem Versagen.
Schlüsselwörter
Kinder- und Jugendhilfe, Entwicklungsgeschichte, Jugendfürsorge, Rechtliche Grundlagen, SGB VIII, Sozialgeschichte, Armut, Erziehung, Menschenbild, Nationalsozialismus, Weimarer Republik, Kinderarbeit.
Häufig gestellte Fragen zur Entwicklungsgeschichte der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Übersicht über die Geschichte der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzungserklärung, Kapitelzusammenfassungen, Schlüsselwörter und definiert den Begriff der Kinder- und Jugendhilfe. Der Fokus liegt auf der chronologischen Darstellung der Entwicklung, dem Einfluss gesellschaftlicher und politischer Systeme sowie der sich verändernden rechtlichen Grundlagen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung der Kinder- und Jugendhilfe von ihren Ursprüngen bis in die Gegenwart. Dies umfasst die Anfänge der Kinder- und Jugendfürsorge (inkl. Erziehung im Zuchthaus, private Fürsorge im 19. Jahrhundert, Rettungshausbewegung, Eingrenzung der Kinderarbeit und Einführung der Berufsvormundschaft), die Situation in der Weimarer Republik (inkl. Reichsjugendwohlfahrtsgesetz), die Zeit des Nationalsozialismus (inkl. NS-Staat und RJWG, NS-Volkswohlfahrt und Hitlerjugend) und die Entwicklung nach 1945 (inkl. Ausbau der gesetzlichen Grundlagen und Reform des Jugendhilferechts).
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Entwicklung der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland chronologisch darzustellen und den Einfluss gesellschaftlicher Entwicklungen auf die Gestaltung und Praxis der Kinder- und Jugendhilfe aufzuzeigen. Es wird der Wandel der Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen sowie der entsprechenden rechtlichen Bestimmungen im Laufe der Zeit beleuchtet.
Welche Kapitel gibt es und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Einleitung, Definition Kinder- und Jugendhilfe, den Ursprüngen der Kinder- und Jugendfürsorge, der Jugendhilfe in der Weimarer Republik, der Jugendhilfe im NS-Staat, der Jugendhilfe nach 1945 und einem Fazit. Jedes Kapitel behandelt die jeweilige Epoche im Detail, inklusive der relevanten rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die Schlüsselwörter umfassen: Kinder- und Jugendhilfe, Entwicklungsgeschichte, Jugendfürsorge, Rechtliche Grundlagen, SGB VIII, Sozialgeschichte, Armut, Erziehung, Menschenbild, Nationalsozialismus, Weimarer Republik und Kinderarbeit.
Wie ist der Begriff „Kinder- und Jugendhilfe“ definiert?
Der Begriff wird aus heutiger Sicht, basierend auf dem SGB VIII, definiert. Es werden die rechtlichen Grundlagen, Aufgaben, Leistungsbereiche, die Rolle der Jugendämter und freier Träger erläutert. Die Freiwilligkeit der Hilfe, der Kinderschutz bei Kindeswohlgefährdung und die Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen stehen im Fokus.
Wie wird der Einfluss des Nationalsozialismus auf die Kinder- und Jugendhilfe dargestellt?
Die Arbeit untersucht den Einfluss des NS-Staates auf das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz (RJWG), die Rolle der nationalsozialistischen Volkswohlfahrt und den Einfluss der Hitler-Jugend. Es wird analysiert, wie die nationalsozialistische Ideologie die Kinder- und Jugendhilfe beeinflusste und umgestaltete.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2019, Die Entwicklung der Kinder- und Jugendhilfe, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/706674