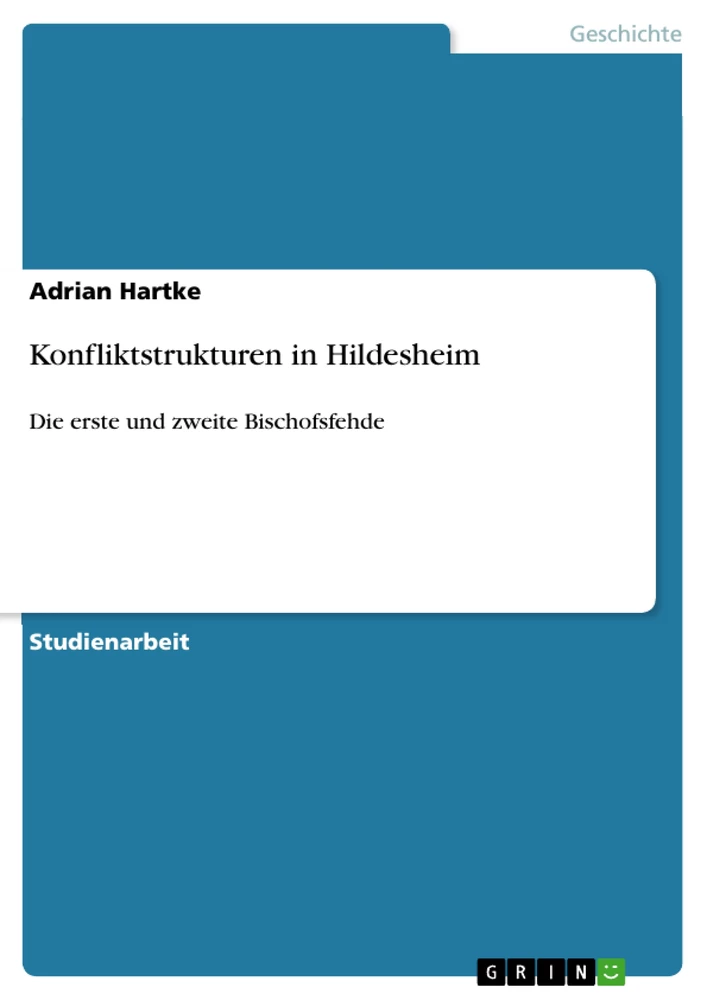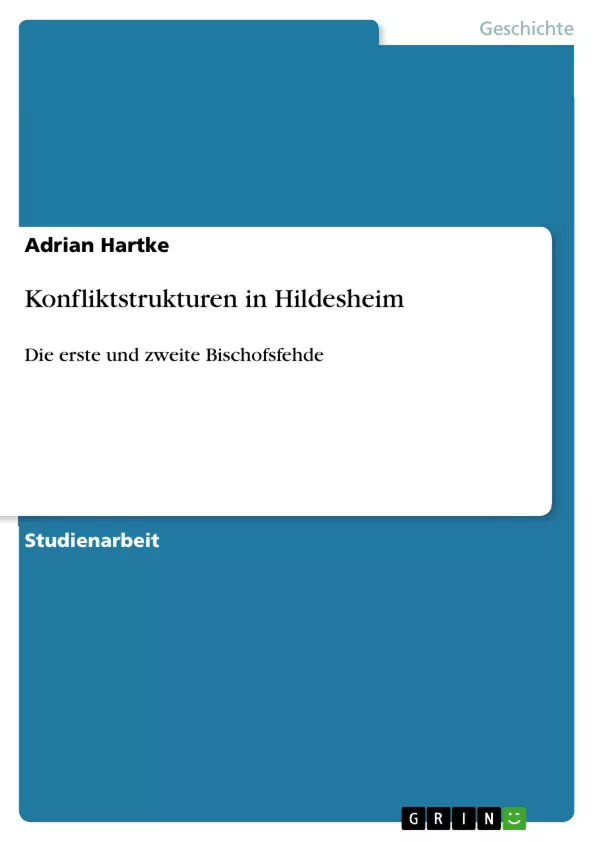In dem Hauptseminar „Kultur der Konflikte - Konfliktstrukturen im späten Mittelalter“ wurde die Frage behandelt, ob mittelalterliche Konflikte der Definition des Begriffs Kultur genügen. Anhand der in den Referaten vorgestellten und hinsichtlich ihrer Strukturen untersuchten Konflikte konnte dies bestätigt werden. Trotz verschiedener Konfliktparteien und anderer, für die jeweiligen Konflikte spezifischer Sachverhalte, sind übergreifende Merkmale ersichtlich, die dem Begriff der Kultur zugeordnet werden können.
In dieser Arbeit soll das im Seminar entwickelte Modell „Konflikthandeln“ auf einen Konflikt zwischen Stadtherrn und Stadt angewandt werden. Exemplarisch soll hierbei die Konfliktphase in der Stadt Hildesheim betrachtet werden, in der die Hildesheimer Bürgerschaft sich von ihrem Stadtherrn, dem Hildesheimer Bischof, zu emanzipieren suchte. Es soll zunächst versucht werden einen Überblick über die in Hildesheim im Spätmittelalter herrschenden Konflikte zu geben. Zudem soll geklärt werden, ob respektive bis wann der Konflikt latent war und ab wann die althergebrachten Strukturen, die schon in der latenten Phase hinterfragt wurden, von der aufstrebenden Bürgergemeinde schließlich verändert wurden. Außerdem soll das Konflikthandeln dahingehend untersucht werden, ob der Hildesheimer Bischof kontinuierlich seine Macht verlor, die Stadt somit also ihre Macht bis zur Stadtfreiheit ebenso kontinuierlich ausdehnen konnte. Dies würde die Frage nach sich ziehen, ob es eine Zwangsläufigkeit in der Entwicklungslinie des Machtverlustes beziehungsweise des Machtzuwachses im Spätmittelalter gab. Schließlich soll analysiert werden, ob Normen und Regeln die Konfliktphase prägten.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hauptteil
- 1. Grundlage des Konfliktes:
- 2. Phasen des Konfliktes zwischen dem Bischof und der Stadt Hildesheim:
- a) Die Erste Bischofsfehde und die rechtliche Grundlage der Stadt (1246-1294):
- b) Die erste Konflikteskalation im Jahre 1294 und ihre Folgen:
- α) Ursache:
- B) Anlass/Auslöser:
- y) Ablauf des Konfliktes:
- 8) Wiederherstellung der Ordnung und die Bedeutung des Stadtrechtes von 1300:
- c) Die Konfliktsituation bis zur Zweiten Bischofsfehde:
- d) Die Zweite Bischofsfehde und der Konflikt mit der Dammstadt 1331-1345:
- a) Ursache:
- B) Anlass:
- Y) Auslöser/Beginn:
- 8) Ablauf des Konfliktes:
- ε) Befriedung, Wiederherstellung der Ordnung und erneutes Aufflammen des Konfliktes:
- () Beilegung der Zweiten Bischofsfehde:
- e) Die Fortsetzung des Konfliktes bis ins 15. Jahrhundert:
- 3. Die Frage nach Regeln/Normen:
- III. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den Konflikt zwischen dem Bischof von Hildesheim und der Stadt Hildesheim im späten Mittelalter und wendet das Modell "Konflikthandeln" auf diese konkrete Fallstudie an. Ziel ist es, die Entwicklung der Konfliktphase und die Veränderungen der Machtverhältnisse zwischen Stadtherrn und Stadt zu analysieren. Dabei soll geklärt werden, ob die Bürgergemeinde ihre Macht bis zur Stadtfreiheit kontinuierlich ausdehnen konnte und ob es eine Zwangsläufigkeit in der Entwicklungslinie des Machtverlustes des Bischofs gab.
- Entwicklung der Machtverhältnisse zwischen Bischof und Stadt Hildesheim im Spätmittelalter
- Analyse der Konfliktphase und die Veränderungen der Machtverhältnisse
- Untersuchung des Modells "Konflikthandeln" im Kontext der Hildesheimer Konfliktphase
- Bewertung des Einflusses von Normen und Regeln auf die Konfliktphase
- Frage nach einer möglichen Zwangsläufigkeit in der Entwicklungslinie des Machtverlustes des Bischofs
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel I: Einleitung: Die Arbeit stellt die Problemstellung vor und erläutert die Relevanz des Konfliktes zwischen Bischof und Stadt im Kontext des Seminars "Kultur der Konflikte". Die Arbeit soll die Anwendung des Modells "Konflikthandeln" auf die Konfliktphase in Hildesheim erforschen und untersuchen, inwieweit die Bürgergemeinde ihre Macht ausweiten konnte.
- Kapitel II.1: Grundlage des Konfliktes: Dieses Kapitel beschreibt die historische Entwicklung der Stadt Hildesheim und die Entstehung der Konfliktbasis zwischen Bischof und Bürgergemeinde. Es wird die Entstehung der Marktsiedlung, die Entwicklung der Gerichtsbarkeit und die ersten korporativen Ansätze der Bürgerschaft beleuchtet.
- Kapitel II.2: Phasen des Konfliktes: Dieser Abschnitt behandelt die verschiedenen Phasen des Konfliktes zwischen dem Bischof und der Stadt Hildesheim. Es werden die Erste Bischofsfehde, die Konflikteskalation im Jahr 1294 und die Zweite Bischofsfehde mit ihren Ursachen, Anlässen und Folgen detailliert analysiert. Die Analyse fokussiert auf die Bedeutung des Stadtrechts, die Rolle der Bürgergemeinde und die Veränderungen in der Machtverteilung.
- Kapitel II.3: Die Frage nach Regeln/Normen: Dieses Kapitel befasst sich mit der Frage, inwieweit Normen und Regeln die Konfliktphase prägten und welche Bedeutung sie für die Entwicklung der Machtverhältnisse hatten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Konflikte zwischen Stadtherrn und Stadt im späten Mittelalter, insbesondere auf die Konfliktphase zwischen dem Bischof und der Stadt Hildesheim. Dabei stehen die Analyse der Machtverhältnisse, das Modell "Konflikthandeln", die Bedeutung des Stadtrechts und die Rolle von Normen und Regeln im Kontext der Konfliktentwicklung im Vordergrund.
Häufig gestellte Fragen
Worum ging es im Konflikt zwischen dem Bischof und der Stadt Hildesheim?
Es war ein Emanzipationskampf der Hildesheimer Bürgerschaft, die versuchte, sich von der Herrschaft ihres Stadtherrn, dem Bischof, zu lösen und mehr städtische Freiheit zu erlangen.
Was war die Bedeutung der Bischofsfehden?
Die Bischofsfehden (z. B. 1246-1294 und 1331-1345) waren Phasen militärischer und rechtlicher Eskalation, in denen die Machtverhältnisse zwischen Stadt und Bischof neu ausgehandelt wurden.
Welche Rolle spielte das Stadtrecht von 1300?
Das Stadtrecht diente als rechtliche Grundlage zur Wiederherstellung der Ordnung nach Konflikten und festigte die Autonomieansprüche der Bürger gegenüber dem Bischof.
Gab es eine Zwangsläufigkeit beim Machtverlust des Bischofs?
Die Arbeit untersucht, ob die Ausdehnung der städtischen Macht eine kontinuierliche Entwicklung war oder ob sie von spezifischen Regeln und Normen des Konflikthandelns abhing.
Was ist das Modell „Konflikthandeln“?
Es ist ein im Seminar entwickeltes Modell zur Analyse mittelalterlicher Konfliktstrukturen, das hier auf die Phasen der Eskalation und Befriedung in Hildesheim angewandt wird.
- Quote paper
- Adrian Hartke (Author), 2006, Konfliktstrukturen in Hildesheim, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/70703