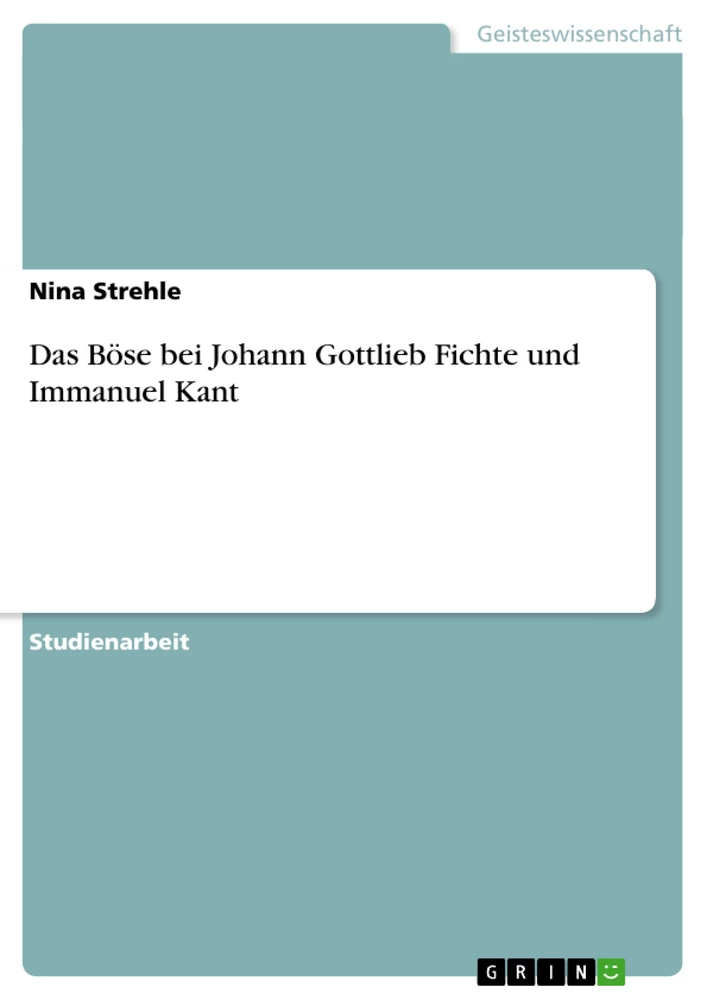Den Ursprung des Bösen, unter dem als ethischen Begriff das sittlich Verwerfliche verstanden wird , hat die Religion und Philosophie auf verschiedene Weisen zu erklären versucht, von denen hier einige kurz vorgestellt werden sollen.
SOKRATES (ca. 470 - 399 v. Chr.) ist der Auffassung, dass die Menschen aus Unwissenheit das Böse tun, solange sie das Gute nicht erkennen. Sie sind aber von Natur aus gut und müssen sich nur wieder auf jenes besinnen. Die Zweckmäßigkeit, die überall in der Welt zu finden ist, zeugt von einer göttlichen Weltregierung. Etwas selbständiges Böses gibt es daher nicht.
PLATON (ca. 428 - 348 v. Chr.) stellt das Problem durch den Dualismus des Vollkommenen - Unvollkommenen, Guten - Bösen als ein metaphysisches Problem dar. Er leitet das Böse aus der Natur des Körperlichen, aus der Unbestimmtheit und Unordnung des Materiellen her. Da das Böse ungöttlich ist und dem Ordnungsprinzip der Welt widerstrebt, kann die gute Gottheit nicht der Urheber desselben sein.
Nach Anschauung des ARISTOTELES (ca. 384 - 322 v. Chr.) liegt der Ursprung des Bösen im freien Willen des Menschen.
Für die STOIKER (ca. 300 v. - 200 n. Chr.) besteht das Böse nur in Teilen des Alls, nicht im Ganzen des Kosmos. Das Böse ist für sie ein Mittel zur Beförderung des Guten.
Nach dem Emanationsmodell des PLOTIN (205 - 270 n. Chr.) geht das Böse aus der Materie hervor. Der Anfang des Bösen in der Seele ist das Vergessen der göttlichen Herkunft, d. h. ein Abfall von Gott. Die Materie der Körperwelt stellt dabei das dem Guten entfernteste Böse (kein Dualismus) dar, die Dunkelheit, worin sich das Licht des Einen durch die Emanation verliert.
Auch AUGUSTINUS (354 - 430 n. Chr.) sieht im Bösen die Folge einer verkehrten Willensrichtung, eines Abfalls von Gott. Das Böse ist dabei nur Beraubung oder Mangel des Guten.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- J. G. FICHTES Sittenlehre
- Die Deduktion des Prinzips der Sittlichkeit
- Die Deduktion der Realität und Anwendbarkeit dieses Prinzips
- J. G. FICHTE: Über die Ursache des Bösen im endlichen vernünftigen Wesen
- Die transzendentale Betrachtung des Bösen
- Der Mensch als Naturwesen
- Der Mensch als verständiges Tier
- Die Maxime der Glückseligkeit
- Blinder Trieb und gesetzlose Oberherrschaft
- Das Böse als Nichtgebrauch der Freiheit
- Die Stufe der absoluten Selbständigkeit
- Trägheit zur Reflexion
- Feigheit und Falschheit
- Warum sind wir träge?
- Überwindung der Trägheit
- IMMANUEL KANT: Vom radikalen Bösen in der menschlichen Natur
- Erbsünde und freie Willkür
- Die ursprüngliche Anlage zum Guten
- Der Hang zum Bösen
- Intelligible Tat und oberste Maxime
- Der Mensch als sinnliches und vernünftiges Wesen
- Das böse Herz
- Das radikal Böse
- Reform des Verhaltens und Revolution der Denkungsart
- Abschließende Bemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Ursprung des Bösen bei Johann Gottlieb Fichte und Immanuel Kant. Ziel ist es, die Konzeptionen des Bösen beider Philosophen zu analysieren, Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen und Fichtes Denken im Kontext von Kants Philosophie zu verstehen. Die Arbeit konzentriert sich auf Fichtes Sittenlehre und seine Schrift "Über die Ursache des Bösen im endlichen vernünftigen Wesen".
- Fichtes Sittenlehre und seine Deduktion des Prinzips der Sittlichkeit
- Fichtes Erklärung der Ursache des Bösen im Menschen
- Kants Konzept des radikalen Bösen und dessen Vergleich mit Fichtes Ansatz
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den philosophischen Ansätzen von Fichte und Kant
- Die Rolle der Freiheit und des Willens in der Entstehung des Bösen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung bietet einen kurzen Überblick über verschiedene historische und philosophische Ansätze zur Erklärung des Ursprungs des Bösen, von Sokrates bis Immanuel Kant, um den Kontext für die nachfolgende detaillierte Untersuchung des Bösen bei Fichte und Kant zu schaffen. Die verschiedenen Perspektiven – von Unwissenheit über den Dualismus von Gut und Böse bis hin zur Beschränktheit des endlichen Wesens – werden prägnant dargestellt, um die Komplexität des Themas zu veranschaulichen und die Positionen von Fichte und Kant einzuordnen.
J. G. FICHTES Sittenlehre: Dieses Kapitel präsentiert Fichtes ethische Konzeption, die sich eng an Kants Ethik anlehnt, jedoch eine eigene Begründung sucht. Es wird erläutert, wie Fichte Kants Theorie der Freiheit und des Sittengesetzes übernimmt, aber kritisiert, indem er die Prinzipien dieser Lehre aus einem ersten, unbedingten Grundsatz ("Setze dein Ich!") a priori ableitet. Das Kapitel beschreibt Fichtes Idealismus und wie dieser die Freiheit des Individuums und die Anerkennung anderer freier Persönlichkeiten impliziert. Die Natur wird als Widerstand dargestellt, den das Ich zur Selbstverwirklichung überwinden muss. Der Fokus liegt auf der Selbstbetätigung und Selbstverwirklichung des Ich als dem zentralen Prinzip der Fichteschen Ethik.
J. G. FICHTE: Über die Ursache des Bösen im endlichen vernünftigen Wesen: Dieses Kapitel analysiert Fichtes Werk "Über die Ursache des Bösen im endlichen vernünftigen Wesen". Es wird Fichtes transzendentale Betrachtung des Bösen untersucht, wobei der Mensch sowohl als Naturwesen als auch als verständiges Tier betrachtet wird. Die Rolle der Maxime der Glückseligkeit, des blinden Triebes und des Nichtgebrauchs der Freiheit wird erörtert. Der Weg zur absoluten Selbständigkeit und die Überwindung der Trägheit zur Reflexion, einschließlich Feigheit und Falschheit, werden als zentrale Aspekte im Kampf gegen das Böse dargestellt. Das Kapitel beleuchtet die Herausforderungen, die dem Individuum bei der Selbstverwirklichung und der Überwindung des Bösen begegnen.
IMMANUEL KANT: Vom radikalen Bösen in der menschlichen Natur: Das Kapitel analysiert Kants Konzept des radikalen Bösen, seinen Hang zum Bösen, der in der menschlichen Selbstliebe begründet liegt. Es werden Kants Ansichten zu Erbsünde und freier Willkür diskutiert, sowie die ursprüngliche Anlage zum Guten im Menschen. Die Ambivalenz des menschlichen Wesens, das sowohl sinnlich als auch vernünftig ist, wird im Kontext des bösen Herzens und der intelligenten Tat analysiert. Die Bedeutung des radikalen Bösen und der Notwendigkeit einer Reform des Verhaltens und Revolution der Denkungsart als Reaktion darauf wird erörtert. Der Vergleich mit Fichtes Position wird vorbereitet.
Schlüsselwörter
Johann Gottlieb Fichte, Immanuel Kant, Sittenlehre, Böse, Freiheit, Selbsttätigkeit, Selbstverwirklichung, radikal Böse, Hang zum Bösen, transzendentale Betrachtung, Maxime der Glückseligkeit, Trägheit, Reflexion, Willensfreiheit, Vernunft, Natur, Selbstliebe.
Häufig gestellte Fragen zu: Fichte und Kant über das Böse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese akademische Arbeit analysiert die Konzeptionen des Bösen bei Johann Gottlieb Fichte und Immanuel Kant. Sie vergleicht die Ansätze beider Philosophen, hebt Gemeinsamkeiten und Unterschiede hervor und betrachtet Fichtes Denken im Kontext von Kants Philosophie. Der Fokus liegt auf Fichtes Sittenlehre und seinem Werk "Über die Ursache des Bösen im endlichen vernünftigen Wesen".
Welche Texte werden untersucht?
Die Arbeit analysiert vor allem Fichtes Sittenlehre und seine Schrift "Über die Ursache des Bösen im endlichen vernünftigen Wesen", sowie Immanuel Kants Konzept des radikalen Bösen. Die Einleitung bietet zudem einen historischen Überblick über verschiedene philosophische Ansätze zur Erklärung des Bösen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Fichtes Sittenlehre und die Deduktion des Prinzips der Sittlichkeit; Fichtes Erklärung der Ursache des Bösen im Menschen; Kants Konzept des radikalen Bösen und dessen Vergleich mit Fichtes Ansatz; Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den philosophischen Ansätzen von Fichte und Kant; die Rolle der Freiheit und des Willens in der Entstehung des Bösen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu Fichtes Sittenlehre, Fichtes "Über die Ursache des Bösen...", Kants Konzept des radikalen Bösen und abschließende Bemerkungen. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Zusammenfassung und Analyse der jeweiligen Texte.
Was sind die zentralen Ergebnisse der Analyse von Fichtes Sittenlehre?
Die Analyse von Fichtes Sittenlehre zeigt, wie Fichte Kants Theorie der Freiheit und des Sittengesetzes aufgreift, aber durch die Ableitung der Prinzipien aus einem ersten Grundsatz ("Setze dein Ich!") eine eigene Begründung sucht. Fichtes Idealismus, die Selbstbetätigung und Selbstverwirklichung des Ich als zentrales Prinzip werden hervorgehoben. Die Natur wird als Widerstand dargestellt, den das Ich überwinden muss.
Wie erklärt Fichte die Ursache des Bösen?
In "Über die Ursache des Bösen..." betrachtet Fichte den Menschen als Naturwesen und verständiges Tier. Das Böse wird mit dem Nichtgebrauch der Freiheit, der Maxime der Glückseligkeit und dem blinden Trieb in Verbindung gebracht. Die Überwindung der Trägheit zur Reflexion (einschließlich Feigheit und Falschheit) wird als zentraler Aspekt im Kampf gegen das Böse dargestellt.
Wie unterscheidet sich Kants Konzept des radikalen Bösen von Fichtes Ansatz?
Die Arbeit vergleicht Kants Konzept des radikalen Bösen, begründet in der menschlichen Selbstliebe, mit Fichtes Ansatz. Kants Ansichten zu Erbsünde, freier Willkür und der ursprünglichen Anlage zum Guten werden diskutiert. Der Vergleich der beiden Philosophen bezüglich des "bösen Herzens", der intelligenten Tat und der Notwendigkeit einer Verhaltensreform wird vorbereitet, aber der konkrete Vergleich findet im Text nicht statt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Johann Gottlieb Fichte, Immanuel Kant, Sittenlehre, Böse, Freiheit, Selbsttätigkeit, Selbstverwirklichung, radikal Böse, Hang zum Bösen, transzendentale Betrachtung, Maxime der Glückseligkeit, Trägheit, Reflexion, Willensfreiheit, Vernunft, Natur, Selbstliebe.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für Leser gedacht, die sich für die philosophischen Ansätze von Fichte und Kant zum Thema des Bösen interessieren. Sie ist besonders für Studierende der Philosophie relevant, die sich mit der Geschichte der Ethik und der deutschen Idealismus befassen.
- Arbeit zitieren
- Nina Strehle (Autor:in), 2001, Das Böse bei Johann Gottlieb Fichte und Immanuel Kant, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/7070