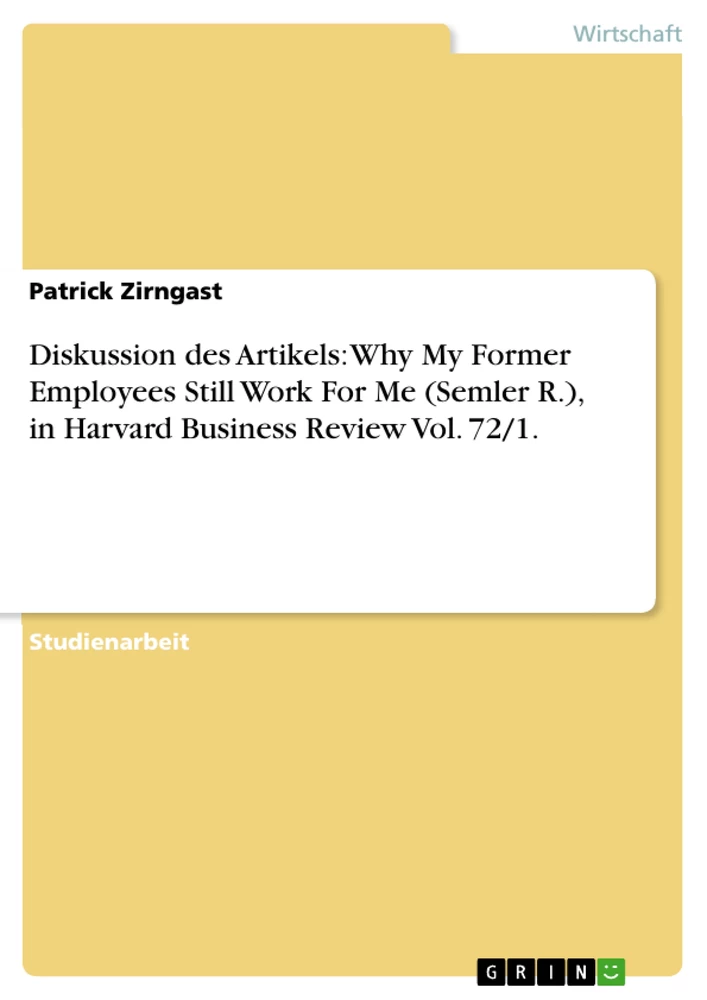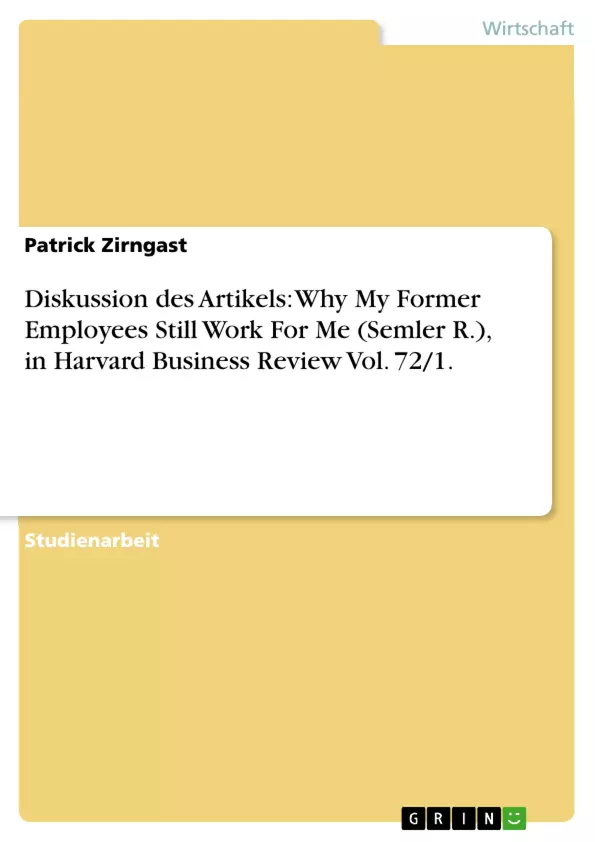Seit einigen Jahren befinden sich die Weltwirtschaft und damit der Wettbewerb in beinahe allen Branchen und Märkten in einem massiven Wandel. Das Wettbewerbsumfeld verschärfte sich zunehmend. Die Gründe dafür liegen unter anderem in der Liberalisierung lokaler Märkte, der weiter zunehmenden Globalisierung und dem Ausbau der Telekommunikationsinfrastruktur. Gleichzeitig sind eine Verkürzung der Technologie- und Produktlebenszyklen sowie eine steigende Komplexität der Produkte und Dienstleistungen feststellbar. Eine zunehmende Schnelllebigkeit und Individualisierung der Markt- und Kundenanforderungen ist bemerkbar. Rasante Fortschritte in der Informations- und Kommunikationstechnologie ermöglichen neue Produkte, Prozessinnovationen, neue Formen der Arbeitsorganisation und Unternehmensorganisation.
Unternehmen, die sich in ihrer Branche seit Jahren gut positionierten und ihre Märkte eindeutig definieren und verteidigen konnten, müssen sich auf Grund des geänderten Umfeldes neu orientieren um den komplexen Anforderungen gerecht zu werden. Traditionelle Organisationsformen vermögen oftmals das erforderliche Know-how, um auf den neuen Märkten bestehen zu können, nicht hervorzubringen beziehungsweise dieses nicht ausreichend zu bündeln.
In den Vordergrund unternehmerischen Handelns treten vermehrt Eigenschaften wie Flexibilität, Schnelligkeit und Kundenorientierung.
Einen möglichen Ansatz bietet eine neue Organisationsform, die in der Lage ist, die erforderlichen Problemlösungskompetenzen schnell aufzubauen. Diese Kombination von Eigenschaften wird durch das Konzept des virtuellen Unternehmens realisiert. Anhand eines Aufsatzes im Harvard Business Review von Ricardo Semler soll die Anwendung des Konzeptes der „virtuellen Organisation“ (VO) auf reale Begebenheiten überprüft, Grenzen definiert und einer kritischen Würdigung unterzogen werden.
Der zweite Teil dieser Arbeit beschäftigt sich mit traditionellen Organisationsformen und beschreibt deren Vor- wie auch Nachteile in der geänderten Wettbewerbssituation. Beginnend bei grundlegenden Organisationsdefinitionen wird der Bogen über die Ziele einer Organisation bis hin zu Ein- und Mehrlinienorganisation sowie zur Matrixorganisation gespannt. Der darauf folgende Teil stellt das Framework einer VO vor. Es werden deren Strukturmerkmale und Besonderheiten zu bisherigen Organisationsformen beleuchtet. Eine klare Abgrenzung zu ähnlichen Konzepten schließt diesen Teil ab.
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Zielsetzung dieser Arbeit
- Traditionelle Organisationsformen
- Definition
- Instrumenteller Organisationsbegriff
- Funktionale Definition
- Formalisierungsgrad
- Formale Organisation
- Informale Organisation
- Organisationsziel
- Traditionelle Organisationstheorie
- Aufbau- und Ablauforganisation
- Organisationsformen
- Das virtuelle Unternehmen als neue Organisationsform
- Definition
- Merkmale von Virtuellen Unternehmen
- Netzwerkcharakter
- Einbringen von Kernkompetenzen
- Modularisierung
- Kommunikation- und Informationstechnologien
- Vertrauensbeziehungen
- Abgrenzung zu ähnlichen Konzepten
- Kritische Würdigung
- Semler: Why My Former Employees Still Work For Me
- Background
- Systembeschreibung
- Modularisierung
- Netzwerkcharakter
- Einbringen von Kernkompetenzen
- Kommunikations- und Informationstechnologien
- Vertrauensbeziehungen
- Kontrolle und klassische Unternehmensführung
- Kritische Würdigung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung neuer Organisationsformen und untersucht die Funktionsweise des virtuellen Unternehmens im Vergleich zu traditionellen Organisationsmodellen. Ziel ist es, die Vorteile und Herausforderungen des virtuellen Unternehmens anhand eines Fallbeispiels aus der Praxis zu beleuchten und die Relevanz des Konzepts im Kontext der sich verändernden Wettbewerbssituation zu bewerten.
- Definition und Charakterisierung traditioneller Organisationsformen
- Entwicklung und Merkmale des virtuellen Unternehmens
- Anwendung des virtuellen Unternehmens in der Praxis anhand des Fallbeispiels von Ricardo Semler
- Kritische Würdigung der Vor- und Nachteile des virtuellen Unternehmens
- Bewertung der Relevanz des virtuellen Unternehmens im Kontext des modernen Wettbewerbs
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Thematik und definiert die Zielsetzung. Anschließend werden traditionelle Organisationsformen vorgestellt, einschließlich ihrer Definition, des Formalisierungsgrades, des Organisationsziels und der klassischen Organisationstheorie. Die Arbeit erläutert verschiedene Organisationsformen wie Einlinien-, Stablinien-, Mehrlinien- und Matrixorganisationen.
Im nächsten Abschnitt wird das virtuelle Unternehmen als neue Organisationsform vorgestellt. Es werden die Definition, die Merkmale, wie z. B. Netzwerkcharakter, Einbringen von Kernkompetenzen, Modularisierung, Kommunikations- und Informationstechnologien und Vertrauensbeziehungen, sowie die Abgrenzung zu ähnlichen Konzepten erläutert.
Der darauffolgende Teil analysiert den Artikel von Ricardo Semler „Why My Former Employees Still Work For Me“ im Hinblick auf die Anwendung des virtuellen Unternehmens. Die Arbeit untersucht, inwieweit die Vorgaben einer virtuellen Organisation im Fallbeispiel erfüllt sind, und analysiert die Stärken und Schwächen des von Semler vorgeschlagenen Modells.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Bereiche Betriebsstruktur, Unternehmensorganisation, neue Unternehmensformen, virtuelle Unternehmen, traditionelle Organisationsformen, Netzwerkcharakter, Kernkompetenzen, Modularisierung, Kommunikations- und Informationstechnologien, Vertrauensbeziehungen, Kontrolle und klassische Unternehmensführung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein virtuelles Unternehmen?
Ein virtuelles Unternehmen ist eine temporäre Kooperation rechtlich unabhängiger Partner, die ihre Kernkompetenzen bündeln, um eine Marktchance zu nutzen.
Wer ist Ricardo Semler?
Ricardo Semler ist ein Unternehmer, der durch radikale demokratische Organisationsformen und das Konzept der „virtuellen Organisation“ bekannt wurde.
Welche Rolle spielt Vertrauen in virtuellen Organisationen?
Da formale Hierarchien fehlen, ist Vertrauen die zentrale Koordinationsinstanz zwischen den Netzwerkpartnern.
Was sind die Nachteile traditioneller Organisationsformen?
Traditionelle Strukturen sind oft zu starr und langsam, um auf die rasanten technologischen Veränderungen und individuellen Kundenwünsche zu reagieren.
Was bedeutet Modularisierung im Unternehmenskontext?
Es beschreibt die Aufteilung des Unternehmens in kleine, flexible und eigenverantwortliche Einheiten, die schnell neu kombiniert werden können.
- Quote paper
- MMag. Patrick Zirngast (Author), 2006, Diskussion des Artikels: Why My Former Employees Still Work For Me (Semler R.), in Harvard Business Review Vol. 72/1., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/70732