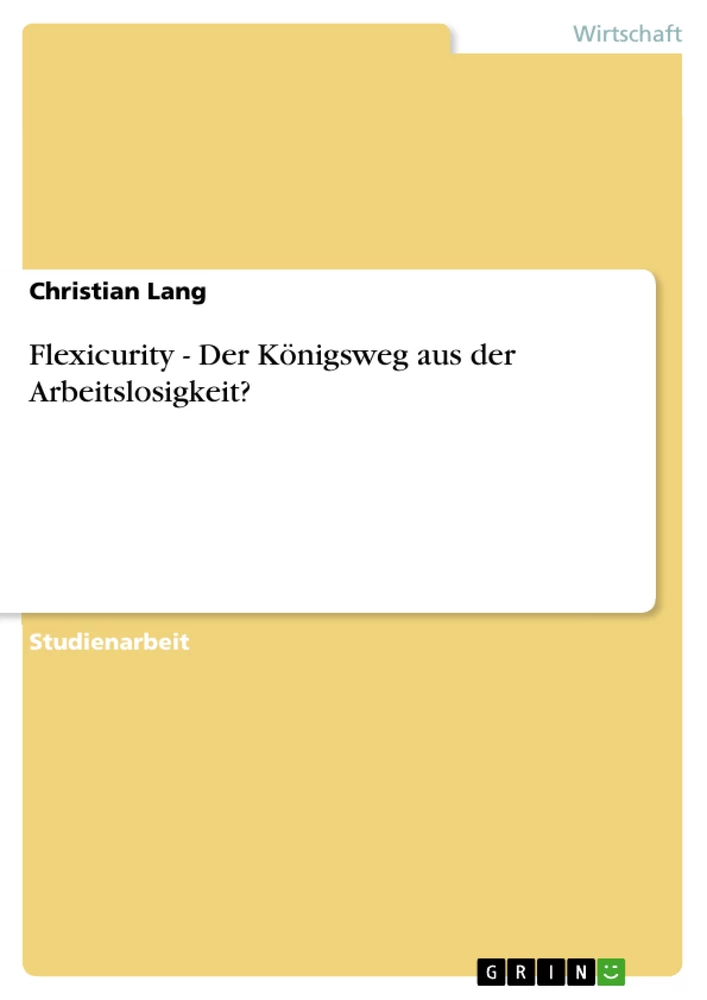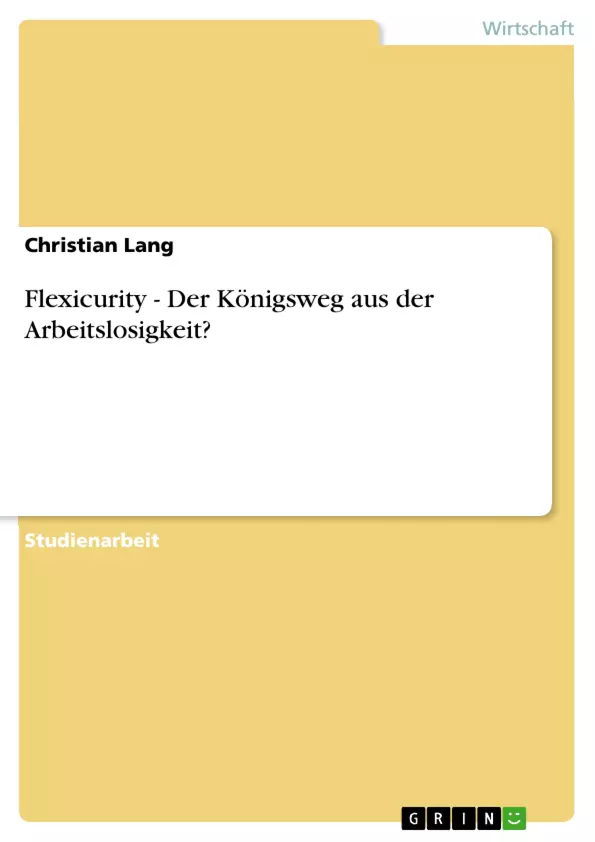Ökonomen sehen in dem Modell der Liberalisierung von Märkten und der wirtschaftlichen Selbststeuerung durch Marktentscheidungen, die Entwicklung zu individueller und politischer Freiheit. Sie interpretieren die Globalisierung als Chance, die Märkte aus staatlichen Fesseln zu lösen und sehen damit einhergehend einen Freiheitsgewinn der allen zugute kommen soll. Kritiker befürchten jedoch, dass staatliches Lenken und die Politik immer weniger in der Lage ist den Markt beeinflussen zu können. Besonders die Bereitstellung öffentlicher Güter, Bürgerechte und der Sozialleistungen werden durch die Erosion der Steuerbasis als bedroht gesehen. Nicht nur der internationale Warentausch wird den Wettbewerbseffekten stärker unterworfen, sondern auch die Arbeitsmärkte der Industrienationen werden dramatisch durch die Konsequenzen der Globalisierung und des internationalen Wettbewerbs tangiert. Dort sucht man immer drängender nach Antworten auf Probleme in den Arbeitsmärkten. Die Entkopplung von Wirtschaft und Staat führt zwangsläufig, besonders für die Arbeitsmärkte, zu großen Veränderungen.
Was könnte die Antwort auf die sich zuspitzende Problematik der Arbeitslosigkeit in Deutschland sein? In den Niederlanden und Dänemark wurde Anfang der 90er Jahre mit großem Erfolg versucht dieser Entwicklung, durch eine gleichzeitige Politik der Flexibilisierung (Flexibility) und der Wahrung sozialer Sicherheit (Security), auf den Arbeitsmärkte Paroli zu bieten (Flexibility + Security = Flexicurity). Könnte dies auch der Königsweg für einen Ausweg aus der Arbeitslosigkeitsmisere auf dem deutschen Arbeitsmarktes sein? Die folgende Ausarbeitung legt dar, um was es sich bei der Idee „Flexicurity“ handelt und zeigt die Probleme die sich bei der Übertragung auf den deutschen Arbeitsmarkt ergeben könnten.
Da das Thema „Flexicurity“ noch relativ neu und nur ein Modell zur Reform des Arbeitsmarktes neben anderen ist, war die Beschaffung von Quellen für die Bearbeitung dieser Ausarbeitung schwierig. Wenn möglich wurden deshalb Quellen und Aufsätze auch aus dem Internet benutzt, um eine breitere Informationsbasis ermöglichen zu können. Entstanden ist ein Einstieg in die Diskussion um das Modell Flexicurity der zeigt, dass es weiterer Recherchen und Auseinandersetzungen mit den arbeitsrechtlichen und sozialen Konsequenzen zunehmender Flexibilität in der Arbeitswelt bedarf.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungen
- Einleitung
- Flexibilisierung des Arbeitsmarktes als Reaktion auf zunehmende Arbeitslosigkeit
- Flexibilität auf den Arbeitsmärkten in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit
- Flexibilität und Sicherheit
- Varianten einer Flexibilisierung des Arbeitsmarktes
- Wirtschaftspolitische Impulse
- Das Prinzip Flexicurity in Dänemark
- Elemente flexibler Arbeitsmodelle
- Typische Beschäftigungsmodelle
- Übergangsarbeitsmärkte
- Beschäftigungssicherung
- Weiterbildung (Lebenslanges Lernen)
- Atypische Beschäftigungsmodelle
- Teilzeitarbeit
- Leiharbeit
- Befristung
- Flexibilisierung als Jobmotor?
- Versuch einer Diagnose
- Weitere Forderungen an die Flexibilität der Arbeitnehmer
- Ausblick
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Ausarbeitung untersucht das Modell „Flexicurity“ als potenziellen Lösungsansatz für die Arbeitslosigkeitsmisere in Deutschland. Sie beleuchtet die Hintergründe der Flexibilisierungsdebatte, analysiert die Funktionsweise von „Flexicurity“ in Dänemark und zeigt die Herausforderungen bei der Übertragung dieses Modells auf den deutschen Arbeitsmarkt auf.
- Flexibilisierung des Arbeitsmarktes als Reaktion auf zunehmende Arbeitslosigkeit
- Der Zusammenhang zwischen Flexibilität und sozialer Sicherheit
- Das Modell „Flexicurity“ als Antwort auf die Herausforderungen des globalisierten Arbeitsmarktes
- Die Rolle des Staates bei der Gestaltung flexibler Arbeitsmodelle
- Die Auswirkungen von Flexibilisierung auf verschiedene Gruppen am Arbeitsmarkt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die globalen Veränderungen in den Arbeitsmärkten und die wachsende Bedeutung der Flexibilisierung. Kapitel 1 fokussiert auf die Flexibilitätsdebatte und die unterschiedlichen Interpretationen des Begriffs „Flexibilität“. Kapitel 2 analysiert die „Flexicurity“-Strategie in Dänemark als Modell für die Verbindung von Flexibilität und Sicherheit. Kapitel 3 widmet sich verschiedenen Aspekten flexibler Arbeitsmodelle, wie z.B. typischen und atypischen Beschäftigungsformen. Kapitel 4 untersucht die Auswirkungen der Flexibilisierung auf die Arbeitsmarktsituation und die Herausforderungen, die sich bei der Anwendung des „Flexicurity“-Modells in Deutschland ergeben könnten.
Schlüsselwörter
Flexibilisierung, Arbeitsmarkt, Arbeitslosigkeit, Flexicurity, Dänemark, soziale Sicherheit, Normalarbeitsverhältnis, atypische Beschäftigungsmodelle, Globalisierung, Wettbewerb, Deregulierung.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet das Modell 'Flexicurity'?
Flexicurity setzt sich aus 'Flexibility' und 'Security' zusammen. Es beschreibt eine Arbeitsmarktpolitik, die hohe Flexibilität für Unternehmen mit hoher sozialer Sicherheit für Arbeitnehmer kombiniert.
Welche Länder gelten als Vorbilder für Flexicurity?
Dänemark und die Niederlande haben dieses Modell seit den 1990er Jahren erfolgreich umgesetzt, um die Arbeitslosigkeit zu senken.
Was sind 'atypische Beschäftigungsverhältnisse'?
Dazu zählen Teilzeitarbeit, Leiharbeit und befristete Verträge, die im Rahmen der Flexibilisierung an Bedeutung gewonnen haben.
Kann Flexicurity einfach auf Deutschland übertragen werden?
Die Übertragung ist schwierig, da Deutschland andere arbeitsrechtliche Traditionen und ein anderes Sozialversicherungssystem hat, was spezifische Anpassungen erfordert.
Welche Rolle spielt lebenslanges Lernen bei Flexicurity?
Es ist eine zentrale Säule: Arbeitnehmer müssen kontinuierlich weitergebildet werden, um trotz flexibler Arbeitsmärkte ihre Beschäftigungsfähigkeit (Employability) zu erhalten.
- Arbeit zitieren
- Christian Lang (Autor:in), 2006, Flexicurity - Der Königsweg aus der Arbeitslosigkeit?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/70803