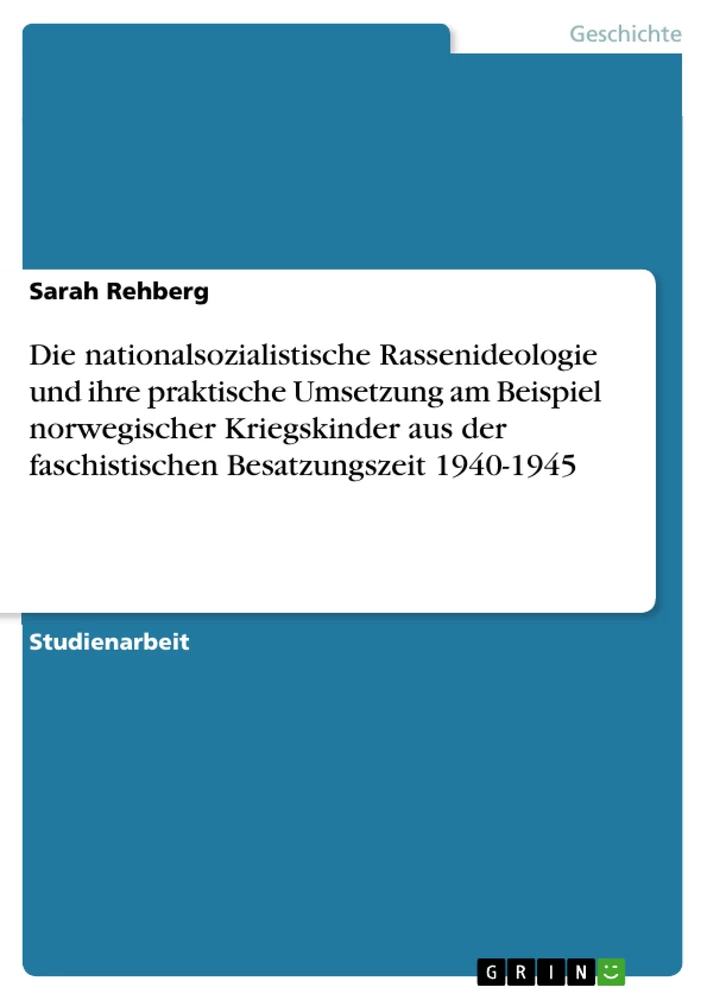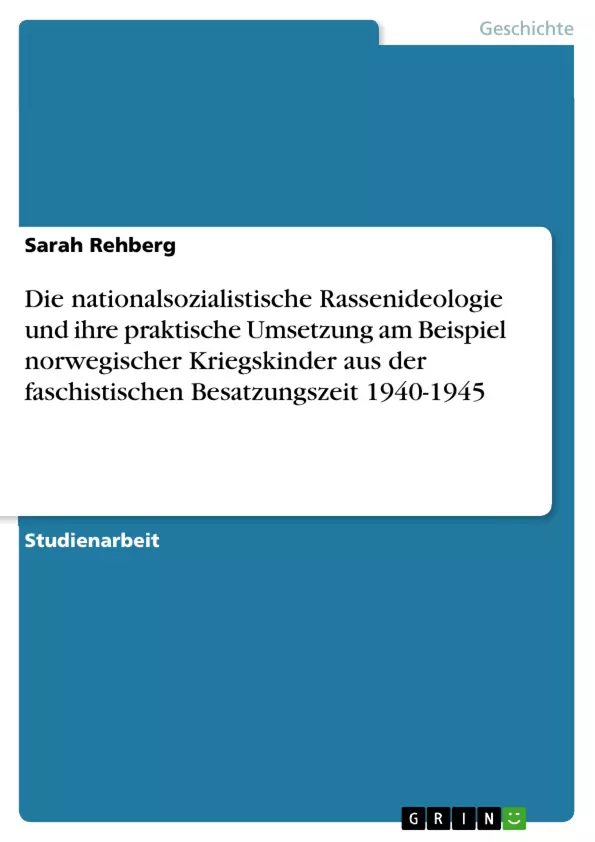Im Jahr 2000 treten Paul Hansen, Karl-Otto Zinken, sowie fünf weitere Kläger an die Rechtsanwältin Randi Hagen Spydevold in Oslo heran. Was sie mit einander teilen, ist ihr gemeinsames Schicksal als so genannte "Tyskerbarn" (Deutschenkinder), deren Kindheit und Jugend davon geprägt waren, dass sie oft ohne ihre Eltern aufwuchsen, zwischen Heimen und Pflegefamilien hin und hergereicht und von der norwegischen Gesellschaft als schändlicher Makel des NS-Regimes gepeinigt und gedemütigt wurden. Sie sind Kinder norwegischer Frauen, die während des Zweiten Weltkrieges eine enge Beziehung mit einem Deutschen eingegangen waren, sprich aus gesellschaftspolitischer Sicht ganz offensichtlich und schamlos mit dem Feind fraternisiert hatten. Die Zahl der deutsch-norwegischen Kriegskinder kann zwar lediglich geschätzt werden, sie beläuft sich jedoch laut Aktenfund in Oslo auf etwa 10.000 bis 12.000 Kinder. Degradierung, Ausstoßung und Misshandlungen waren die Folge, meist für Mutter und Kind, die nicht nur willkürlich aus der Bevölkerung hervorgingen, sondern auch häufig von der Regierung der Nachkriegszeit gebilligt wurden. Ein Jahr später liegen bereits 150 Klagebegehren beim Osloer Stadtgericht vor und die Zahlen steigen in der folgenden Zeit stetig. Die dahinter stehenden Kläger fordern eine längst überfällige Auseinandersetzung der Gesellschaft mit diesem Kapitel der eigenen Vergangenheit, da der Umgang mit dieser besonderen Art der Kriegsopfer lange Zeit ignoriert, ihre Schicksale tabuisiert und von der norwegischen Regierung als "verjährt" abgestempelt wurde.
Um sich den Einfluss auf diese Kinder zu sichern, die aus nationalsozialistischer rassen-ideologischen Sicht, dem Deutschen Reich nicht verloren gingen durften, schaltete das Rassen- und Siedlungshauptamtes (RuSHA) der SS 1941 den Verein "Lebensborn e.V." ein. Dem Reichsführer des SS, Heinrich Himmler, direkt unterstellt organisierte er fortan die Versorgung der norwegischen Frauen, die von deutschen Männern ein Kind erwarteten, und war für die zukünftigen Lebensumstände hunderter Kriegskinder maßgeblich verantwortlich.
Doch auch nach Ende der deutschen Besatzung folgten Jahre der Diskriminierung seitens der norwegischen Gesellschaft bis in die heutige Zeit hinein, die das Leben dieser betroffenen auch weiterhin bestimmten.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung.
- Rassenpolitisches Interesse an der Gleichschaltung Norwegens im Sinne der "Neuordnung" zum "Großgermanischen Reich".
- "Positive" Rassen- und Siedlungspolitik der SS
- Ideologisches Interesse der Nationalsozialisten an norwegischen Soldatenkindern
- Überblick über den deutschen Überfall auf Norwegen am 9. April 1940 und die "Neuordnung" des besetzen Landes
- Der Lebensborn e. V. - SS-Institution nationalsozialistischer Rassenpolitik
- Die wichtigsten Beauftragten zur Ausführung der Lebensborn-Tätigkeit in Norwegen: Rediess, Reinecke, Sollmann, Richert, Titgen und Rallager.
- Lebensbornheime: gesetzliche Richtlinien zur Ausführung ihrer Arbeit und implizierte Ziele.
- Die "Deutschenmädchen" und ihre Kinder - ihre Behandlung durch die deutsche Besatzungsmacht und ihr Status innerhalb der norwegischen Gesellschaft als Landesverräterinnen
- Umgang mit den deutsch-norwegischen Kriegskindern und deren Müttern nach der Befreiung Norwegens von der faschistischen Besatzungsmacht - Beginn des lang erhofften Friedens oder einer gefürchteten Verfolgungswelle?
- Maßnahmen des norwegischen Staates in der ersten Nachkriegszeit im Umgang mit den "Deutschenkindern" und ihren Müttern.
- Einstellung der norwegischen Gesellschaft gegenüber den Kriegskinder heute
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den deutsch-norwegischen Kriegskindern während der deutschen Besatzungszeit Norwegens im Zweiten Weltkrieg. Sie untersucht die rassenpolitischen Interessen der Nationalsozialisten an diesen Kindern und die Rolle des "Lebensborn e. V." bei deren Betreuung. Darüber hinaus beleuchtet die Arbeit den Umgang der norwegischen Gesellschaft mit den Kriegskindern und deren Müttern nach der Befreiung und in der Folgezeit.
- Die rassenpolitischen Ziele der deutschen Nationalsozialisten in Bezug auf Norwegen
- Die Rolle des "Lebensborn e. V." bei der Betreuung von deutsch-norwegischen Kriegskindern
- Die Erfahrungen der Kriegskinder und ihrer Mütter während der Besatzung und nach der Befreiung
- Die Diskriminierung der Kriegskinder und ihrer Mütter durch die norwegische Gesellschaft
- Die langfristigen Auswirkungen der Diskriminierung auf das Leben der betroffenen Menschen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung, die den historischen Kontext und die Problematik der deutsch-norwegischen Kriegskinder beleuchtet. Anschließend wird die rassenpolitische Ideologie der Nationalsozialisten im Kontext der deutschen Besatzungspolitik in Norwegen erläutert. Dabei wird der Fokus auf die "Neuordnungspläne" der Nationalsozialisten gelegt, die auf eine Gleichschaltung Norwegens zum "Großgermanischen Reich" abzielten.
Kapitel 4 befasst sich mit dem "Lebensborn e. V.", einer SS-Institution, die für die Betreuung von Frauen, die von deutschen Männern ein Kind erwarteten, zuständig war. Die Arbeit analysiert die Ziele und die Arbeitsweise des Lebensborn und die Behandlung der "Deutschenmädchen" und ihrer Kinder durch die deutsche Besatzungsmacht.
Kapitel 5 untersucht den Umgang der norwegischen Gesellschaft mit den Kriegskindern und ihren Müttern nach der Befreiung. Die Arbeit beleuchtet die Diskriminierung und Verfolgung, der die Kriegskinder und ihre Mütter ausgesetzt waren, sowie die langfristigen Folgen dieser Diskriminierung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen deutsche Besatzungszeit, Kriegskinder, Rassenideologie, "Lebensborn e. V.", Diskriminierung, Integration, Norwegen, Zweiter Weltkrieg, Nationalsozialismus.
Häufig gestellte Fragen
Wer waren die „Tyskerbarn“ in Norwegen?
Als „Tyskerbarn“ (Deutschenkinder) wurden Kinder bezeichnet, die während der Besatzungszeit (1940–1945) aus Beziehungen zwischen norwegischen Frauen und deutschen Soldaten hervorgingen.
Was war der Verein „Lebensborn e.V.“?
Der Lebensborn war eine SS-Institution, die die rassenpolitischen Ziele der Nationalsozialisten unterstützte, indem sie sich um „arische“ Kinder kümmerte, um deren biologisches Potenzial für das Deutsche Reich zu sichern.
Wie wurden die Mütter dieser Kinder in Norwegen behandelt?
Die Frauen wurden als „Landesverräterinnen“ gebrandmarkt, oft öffentlich gedemütigt (z. B. Haarscheren) und nach dem Krieg gesellschaftlich ausgestoßen oder interniert.
Welche rechtlichen Schritte unternahmen die Kriegskinder später?
Ab dem Jahr 2000 klagten viele Betroffene gegen den norwegischen Staat, um eine Anerkennung ihres Leids und eine Entschädigung für die jahrzehntelange Diskriminierung zu erreichen.
Wie viele deutsch-norwegische Kriegskinder gab es etwa?
Schätzungen basierend auf Aktenfunden in Oslo belaufen sich auf etwa 10.000 bis 12.000 Kinder.
- Quote paper
- Sarah Rehberg (Author), 2005, Die nationalsozialistische Rassenideologie und ihre praktische Umsetzung am Beispiel norwegischer Kriegskinder aus der faschistischen Besatzungszeit 1940-1945, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/70908