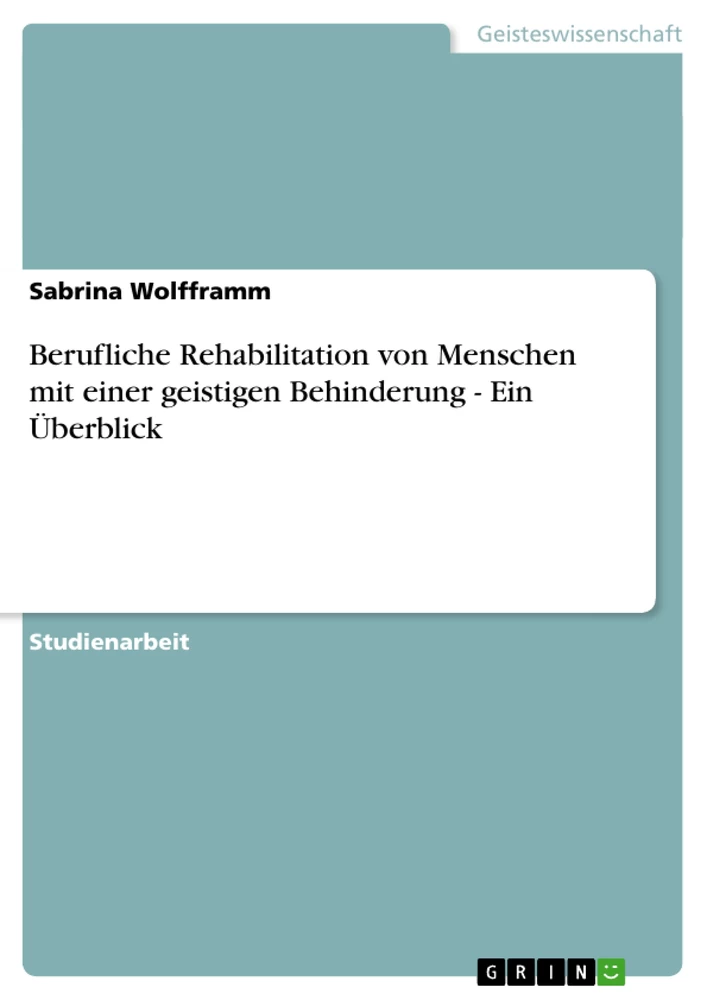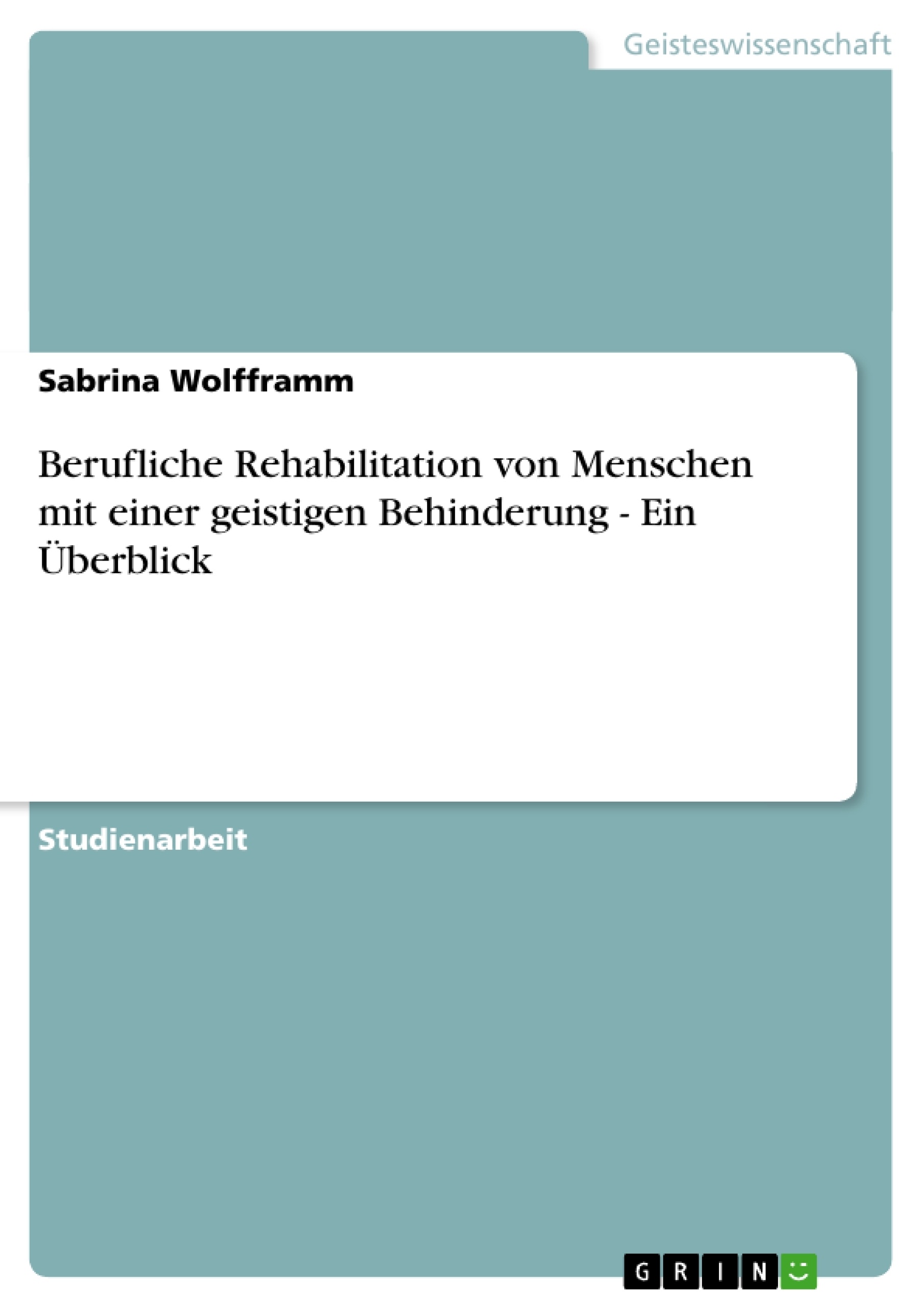Rehabilitation, Integration und Inklusion sind in meinen Augen die aktuellen Schlagworte der Behindertenpädagogik. Immer wieder erneuerte und spezialisierte Definitionen machen den Gebrauch von Fachwörtern schwierig. Nicht zuletzt der Paradigmenwechsel zu Selbstbestimmung [vgl. Westecker, 2001] und Normalisierung [vgl. Ommerle, 1999] tragen zu einer sich ständig verändernden Perspektive der Begrifflichkeiten an sich, aber auch zu deren Gebrauch, bei. Dadurch kommt es zu dem Dilemma, dass ein und der selbe Begriff in zwei unterschiedlichen Situationen auf verschiedene Art und Weise definiert und interpretiert wird.
Beispiel des oben genannten Dilemmas sind zum einen der Begriff der (beruflichen) Rehabilitation und zum anderen der Begriff der geistigen Behinderung. Dabei existieren nicht nur verschiedene Definitionsansätze, sondern auch professionalitätsspezifische Formen.
In der folgenden Arbeit werde ich einen Überblick über die Begriffe der (beruflichen) Rehabilitation und der geistigen Behinderung geben.
Dazu werde ich in einem ersten Kapitel die Formen der Rehabilitation beschreiben. Dabei wird der Schwerpunkt bei der beruflichen Rehabilitation liegen.
In einem weiteren Kapitel werde ich die verschiedenen Definitionsansätze und Sichtweisen der geistigen Behinderung vorstellen.
Das dritte Kapitel wird sich mit den Möglichkeiten und Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation für Menschen mit einer geistigen Behinderung beschäftigen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Was ist Rehabilitation? Verschiedene Formen
- 1.1 Medizinische Rehabilitation
- 1.2 Schulisch-Pädagogische Rehabilitation
- 1.3 Soziale Rehabilitation
- 1.4 Berufliche Rehabilitation
- 1.5 Zusammenfassung
- 2 Menschen mit einer geistigen Behinderung: Definitionsansätze und Sichtweisen
- 2.1 Psychiatrisch-nihilistische Sicht
- 2.2 Heilpädagogisch-defizitorientierte Sicht
- 2.3 IQ-theoretische Sicht
- 2.4 Ansatz des Doppelkriteriums
- 2.5 Ansatz des „kognitiven Andersseins“
- 2.6 Geistige Behinderung als ein soziales Phänomen
- 2.7 Zusammenfassung
- 3 Möglichkeiten und Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation für Menschen mit einer geistigen Behinderung
- 3.1 Berufliche Vorbereitung und Berufsfindung in Berufsbildungswerken
- 3.2 Berufliche Rehabilitation in Berufsförderungswerken
- 3.3 Werkstätten für behinderte Menschen
- 3.4 Zusammenfassung
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Studienarbeit bietet einen umfassenden Überblick über die Bereiche der (beruflichen) Rehabilitation und der geistigen Behinderung. Ziel ist es, die verschiedenen Definitionsansätze und Sichtweisen auf diese Themenbereiche zu beleuchten und einen Einblick in die Möglichkeiten und Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation für Menschen mit einer geistigen Behinderung zu geben.
- Verschiedene Formen der Rehabilitation, insbesondere die berufliche Rehabilitation
- Definitionsansätze und Sichtweisen der geistigen Behinderung
- Möglichkeiten und Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation für Menschen mit einer geistigen Behinderung
- Der Einfluss von Selbstbestimmung und Normalisierung auf die Sichtweise von Behinderung
- Die Herausforderungen und Chancen der Integration und Inklusion von Menschen mit einer geistigen Behinderung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Relevanz der Begriffe Rehabilitation und geistige Behinderung im Kontext der Behindertenpädagogik. Sie stellt die unterschiedlichen Definitionsansätze und die sich verändernde Perspektive der Begrifflichkeiten im Laufe der Zeit heraus.
Kapitel 1 beschäftigt sich mit den verschiedenen Formen der Rehabilitation. Hier werden die medizinische, schulisch-pädagogische, soziale und berufliche Rehabilitation näher betrachtet. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der beruflichen Rehabilitation.
Kapitel 2 analysiert verschiedene Definitionsansätze und Sichtweisen der geistigen Behinderung, darunter die psychiatrisch-nihilistische, heilpädagogisch-defizitorientierte, IQ-theoretische Sicht, sowie der Ansatz des Doppelkriteriums und des „kognitiven Andersseins“. Zudem wird die geistige Behinderung als ein soziales Phänomen betrachtet.
Kapitel 3 beleuchtet die Möglichkeiten und Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation für Menschen mit einer geistigen Behinderung. Hier werden Berufsbildungswerke, Berufsförderungswerke und Werkstätten für behinderte Menschen vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter der Arbeit sind: Rehabilitation, berufliche Rehabilitation, geistige Behinderung, Integration, Inklusion, Selbstbestimmung, Normalisierung, Definitionsansätze, Sichtweisen, Möglichkeiten, Einrichtungen, Berufsbildungswerke, Berufsförderungswerke, Werkstätten für behinderte Menschen, Chancengleichheit, Lebensbewältigung.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die verschiedenen Formen der Rehabilitation?
Man unterscheidet medizinische, schulisch-pädagogische, soziale und berufliche Rehabilitation, wobei letztere auf die Eingliederung in das Arbeitsleben abzielt.
Wie wird geistige Behinderung heute definiert?
Es gibt verschiedene Sichtweisen: von der defizitorientierten und IQ-theoretischen Sicht bis hin zum Verständnis der Behinderung als soziales Phänomen oder als „kognitives Anderssein“.
Welche Einrichtungen unterstützen die berufliche Rehabilitation?
Wichtige Einrichtungen sind Berufsbildungswerke (BBW), Berufsförderungswerke (BFW) und Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM).
Was bedeutet der Paradigmenwechsel zur Inklusion?
Der Fokus verschiebt sich weg von der reinen Fürsorge hin zu Selbstbestimmung, Normalisierung und der gleichberechtigten Teilhabe (Inklusion) an der Gesellschaft.
Welche Rolle spielen Berufsbildungswerke?
Sie dienen der beruflichen Vorbereitung und Berufsfindung für junge Menschen mit Behinderungen, um ihnen den Einstieg in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen.
- Quote paper
- Sabrina Wolfframm (Author), 2006, Berufliche Rehabilitation von Menschen mit einer geistigen Behinderung - Ein Überblick, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/70941