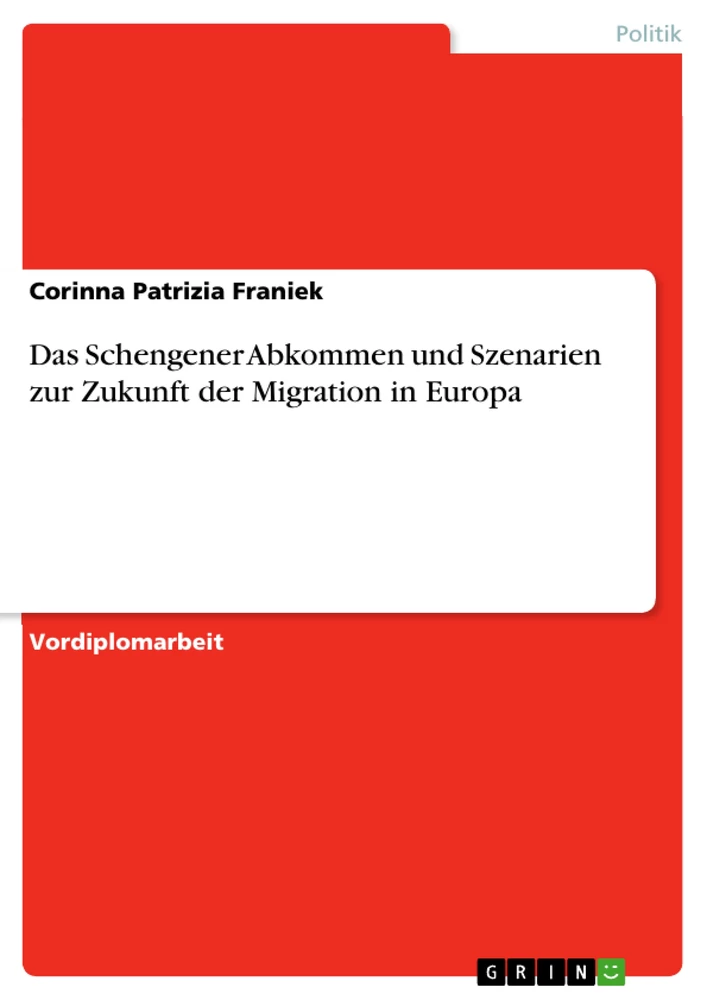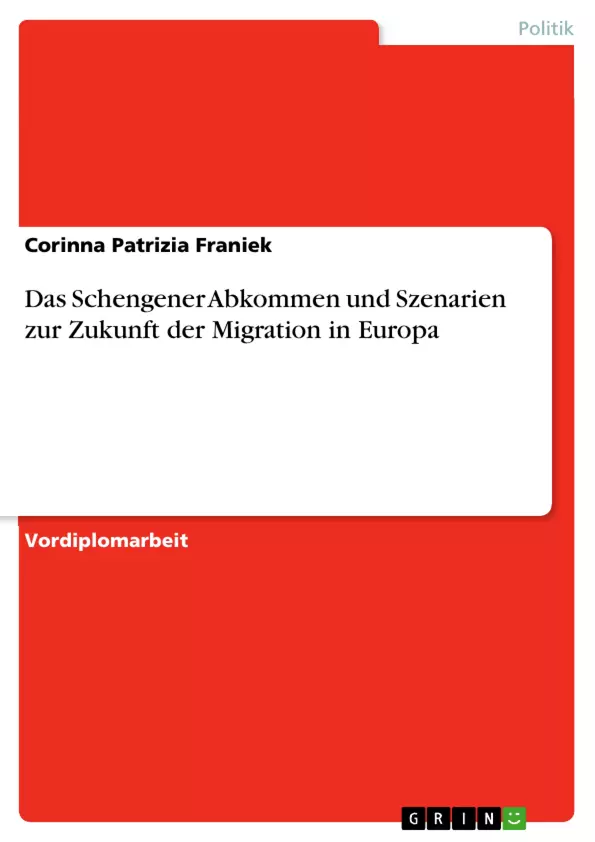Mit Beginn des 21.Jahrhunderts sieht sich die erweiterte Europäische Union vor große Herausforderungen gestellt; im Gegensatz zu vergangenen Jahrhunderten zählt Europa nicht mehr zu den klassischen Auswandererregionen, sondern zu den bevorzugten Einwanderungsregionen der Erde, was aktuelle Meldungen in der Presse, wie Flüchtlingsboote vor Lampedusa oder verzweifelte Afrikaner in den spanischen Exklaven Melilla und Ceuta, belegen. Alle EU-Länder gelten als Einwanderungsstaaten, was ein positives Wanderungssaldo in den Ländern belegt; hieraus resultieren verschiedene Probleme für die EU.
Pro Jahr wandern ca. 700.000 Menschen in die EU ein. Die Gründe für ihre Flucht oder Migration sind verschiedener Natur und reichen von Verfolgung, über familiäre Probleme/Gründe bis hin zu wirtschaftlichen Anreizen. Kontrovers diskutiert wird vor allem die Wohlstandsmigration, welche die EU zu vermeiden versucht. Die Zuwanderung ethnisch Zugehöriger, lange Zeit bevorzugt in der EU praktiziert, (z. B. in Deutschland Spätaussiedler) wurde in den letzten zehn Jahren immer mehr abgebaut. Bei Zuwanderung in die EU spielt die Familienzusammenführung eine bedeutende Rolle, weiterhin wird die Arbeitsmigration zukünftig eine wichtigere Rolle spielen (aus demographischen und wirtschaftlichen Gründen), Flüchtlinge und Asylbewerber gehören zu jener Gruppe, der die Aufnahme aus humanitärer Sicht nicht verwehrt werden darf. Doch durch schärfere nationale Asylgesetze wird versucht, die Zahl der Asylanten zu reduzieren, was aber die illegale Immigration nicht aufhalten kann. Die IOM (International Organisation for Migration) schätzt, dass pro Jahr ca. 300.000 – 500.000 Menschen illegal in die EU einreisen.
Migrationsströme sind kaum noch steuerbar geworden, auch nicht oder gerade nicht durch nationale Politik. Dies liegt an einer erhöhten Mobilität, an der erweiterten Telekommunikation, an der Vernetzung von Politik weltweit und an neuen Formen von Migration. Globalisierung führt dazu, dass bisherige Migrationspolitik im eigentlichen Sinne nicht mehr möglich ist. Die De-jure-Zuständigkeiten stimmen räumlich nicht mehr mit der De-facto-Regulierbarkeit überein. Grenzüberschreitende und supranationale Lösungen sind deshalb von Nöten.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- I. 1. Arbeitsziele
- II. Die europäische Migrations- und Asylpolitik
- III. Das Schengener Abkommen und seine humanitären Folgen
- IV. Migration nach Europa
- IV. 1. Legale Migration nach Europa
- VI. 2. Illegale Migration nach Europa
- IV. 3. Ursachen für Migration
- V. Ist das Boot voll? - Zukunftsszenarien
- V.1. Bevölkerungs- und Arbeitskräfteentwicklung
- V. 1. 1. Zuwanderung
- V. 1. 2. Geburtenentwicklung
- V. 1. 3. Lebenserwartung
- V. 1. 4. Erwerbsverhalten
- V. 1. 5. Folgerungen
- V. 2. Arbeitsplatzszenarien
- V. 2. 1. Arbeitskräfteangebot
- VI. Ausblick
- VI. 1. Persönliches Fazit
- VII. Literaturverzeichnis
- VII. 1. Monographien, Sammelbände und Aufsätze
- VII. 2. Internet
- VIII. Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Schengener Abkommen und seinen Folgen für die Migrations- und Asylpolitik in Europa. Sie untersucht die Entwicklungen der europäischen Einwanderungspolitik und analysiert die Herausforderungen, die sich aus dem demographischen Wandel und der globalen Vernetzung ergeben.
- Entwicklungen der europäischen Migrations- und Asylpolitik
- Auswirkungen des Schengener Abkommens auf die Migration in Europa
- Ursachen und Trends der Migration nach Europa
- Zukunftsszenarien für die Migration in Europa
- Zusammenarbeit und Herausforderungen der EU-Mitgliedsstaaten im Bereich der Einwanderungspolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik der Arbeit vor und beleuchtet die aktuellen Herausforderungen der EU im Kontext von Migration und Asylpolitik. Sie thematisiert die wachsende Bedeutung Europas als Einwanderungsregion und die verschiedenen Ursachen für Flucht und Migration.
Das zweite Kapitel behandelt die Entwicklung der europäischen Migrations- und Asylpolitik von den Anfängen der europäischen Integration bis hin zum Maastrichter Vertrag. Es beschreibt den Wandel von nationalstaatlicher Zuständigkeit hin zur Notwendigkeit einer gemeinsamen europäischen Politik im Bereich der Migration und Asyl.
Kapitel drei widmet sich dem Schengener Abkommen und seinen Folgen für die Migration in Europa. Es diskutiert die Auswirkungen des Abkommens auf die Grenzkontrollen, die freie Bewegung von Personen und die Asylpolitik.
Kapitel vier analysiert verschiedene Aspekte der Migration nach Europa. Es differenziert zwischen legaler und illegaler Migration und untersucht die Ursachen für die Migrationsströme.
Das fünfte Kapitel widmet sich den Zukunftsszenarien der Migration in Europa und analysiert die Auswirkungen des demographischen Wandels und der Arbeitskräfteentwicklung auf die Einwanderungspolitik.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themenbereiche europäische Migrations- und Asylpolitik, Schengener Abkommen, Migration nach Europa, demographischer Wandel, Arbeitskräfteentwicklung, Zukunftsszenarien, EU-Zusammenarbeit und Einwanderungspolitik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptziel des Schengener Abkommens?
Das Abkommen zielt darauf ab, die stationären Grenzkontrollen zwischen den teilnehmenden EU-Staaten abzuschaffen, um die freie Bewegung von Personen zu gewährleisten.
Wie viele Menschen wandern jährlich etwa in die EU ein?
Es wird geschätzt, dass jährlich ca. 700.000 Menschen legal in die EU einwandern, während die illegale Migration auf etwa 300.000 bis 500.000 Personen geschätzt wird.
Welche Rolle spielt die Arbeitsmigration für die Zukunft Europas?
Aufgrund des demographischen Wandels und sinkender Geburtenraten wird die Arbeitsmigration eine immer wichtigere Rolle spielen, um den Bedarf an Fachkräften und die wirtschaftliche Stabilität zu sichern.
Was sind die Hauptursachen für Migration nach Europa?
Die Gründe sind vielfältig: Sie reichen von politischer Verfolgung und Kriegen über Familienzusammenführung bis hin zu wirtschaftlichen Anreizen (Wohlstandsmigration).
Warum ist die Steuerung von Migrationsströmen heute schwieriger geworden?
Durch Globalisierung, verbesserte Telekommunikation und weltweite Vernetzung lassen sich Migrationsbewegungen kaum noch allein durch nationale Politik regulieren; es bedarf supranationaler Lösungen.
Was versteht man unter dem „Wanderungssaldo“?
Der Wanderungssaldo ist die Differenz zwischen Zu- und Fortzügen in einer Region. Ein positives Saldo bedeutet, dass mehr Menschen einwandern als auswandern, was derzeit auf alle EU-Länder zutrifft.
- Quote paper
- Corinna Patrizia Franiek (Author), 2006, Das Schengener Abkommen und Szenarien zur Zukunft der Migration in Europa, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/71010