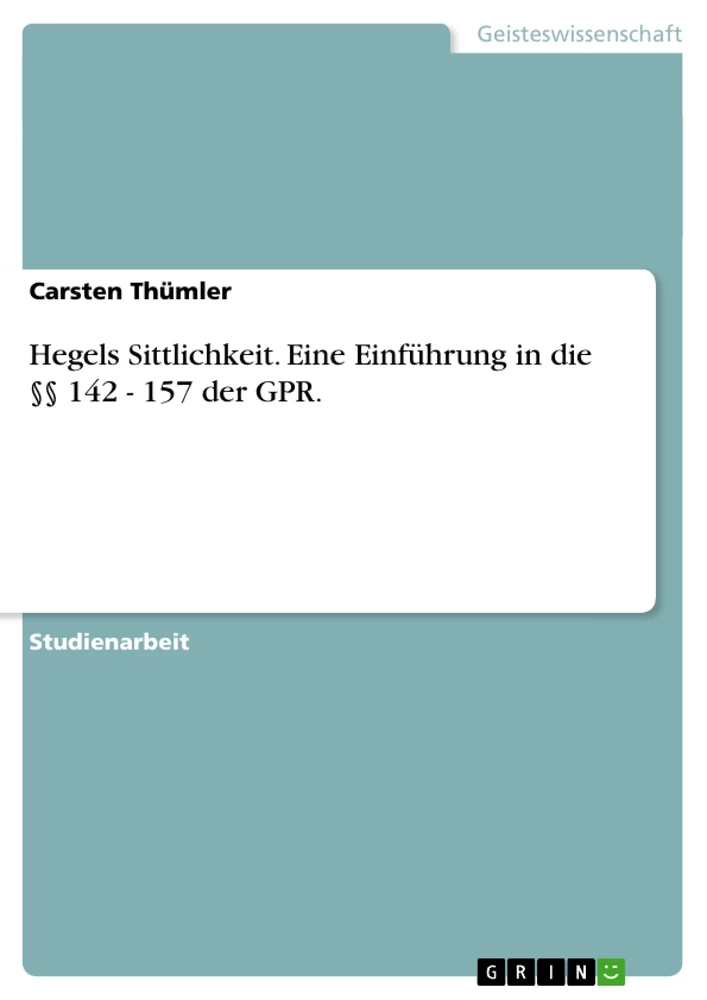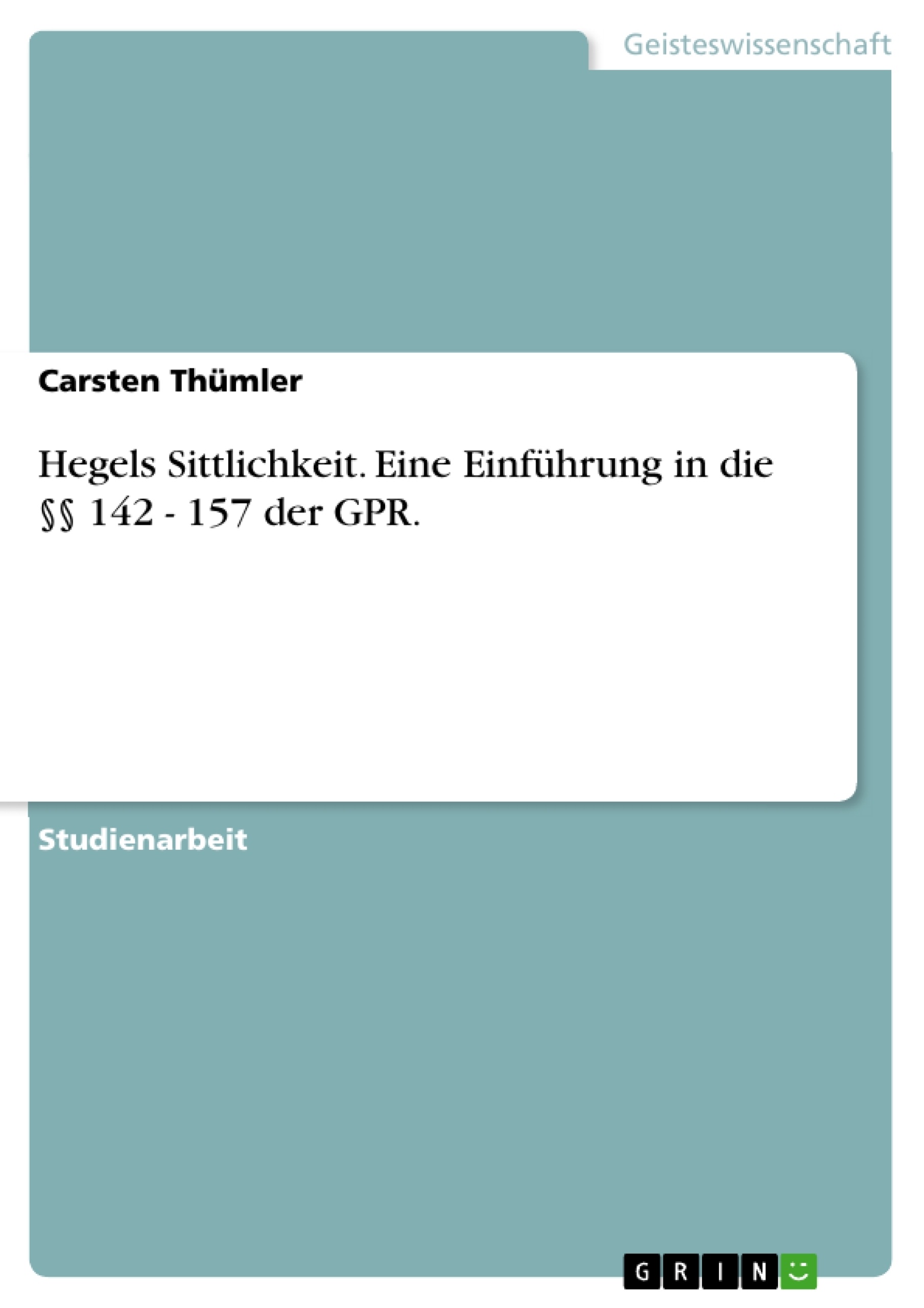„Die Elemente der Sittlichkeit gehen nicht von Begriffen, sie gehen vom Glauben aus.“
Diese Worte stammen von Hegels schweizerischem Zeitgenossen Johann Heinrich Pestalozzi, seines Zeichens Pädagoge und Sozialreformer, der letztlich mit der Erprobung der von ihm entwickelten pädagogischen Grundsätze in der Yverdoner Heimatschule Weltbekanntheit erlangen sollte. Hegel, Absolvent des Studiums der Philosophie und Theologie an der Tübinger Landesuniversität und nach seiner Habilitation in Jena als Dozent der Philosophie noch in Heidelberg und Berlin tätig, beschäftigte sich in seiner gut dreißigjährigen Schaffensperiode weitaus intensiver und umfangreicher als sein Denkerkollege mit dem Terminus der „Sittlichkeit“.
Nicht erst in den anno 1821 in Berlin veröffentlichten „Grundlinien der Philosophie des Rechts“ (GPR), sondern bereits in seinen Theologischen Jugendschriften versuchte sich der junge Hegel an einer Wiederaufrichtung der antiken Sittlichkeit unter den Bedingungen des Christentums und der Neuzeit.2 Der erste Entwurf einer derartig „neuen“ Sittlichkeit war schließlich die Arbeit „Über die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts“3 aus den Jahren 1802/03; im ebenfalls 1803 erschienenen „System der Sittlichkeit“ taucht der angesprochene Begriff dann erstmals im Titel einer Hegelschen Schrift auf.
In dieser Hausarbeit werde ich mich jedoch ausschließlich mit dem Sittlichkeitsbegriff auseinandersetzen, wie er durch Hegel in den §§ 142 – 157 der GPR, also mit Beginn des dritten Teiles dieses dreiteiligen Werkes, eingeführt wird, und mich dabei gedanklich im wesentlichen an den Interpretationen und der Analyse Peperzaks orientieren. Der – zwar eigenwilligen, aber dennoch höchst interessanten – Deutung der Hegelschen Rechtsphilosophie und damit auch der Sittlichkeit als ein wesentlicher Teil dieser durch Honneths Werk „Leiden an Unbestimmtheit“ werde ich sekundär Aufmerksamkeit schenken; die sehr umfangreichen Ausführungen zur Sittlichkeit in den drei Fassungen der „Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften“ möchte ich nicht zum Thema dieser Arbeit machen – sie bleiben damit gänzlich außen vor.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Der Weg zur Sittlichkeit
- Das abstrakte Recht
- Die Moralität
- Der Honnethsche Ansatz
- Die Sittlichkeit
- Die Struktur der §§ 142 - 157 GPR
- Zum Begriff der Sittlichkeit
- Die objektive Seite der Sittlichkeit
- Die subjektive Seite der Sittlichkeit
- Schlußbemerkung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Begriff der Sittlichkeit, wie er von Hegel in den §§ 142 – 157 der GPR eingeführt wird. Die Arbeit konzentriert sich auf die Interpretation Peperzaks, wobei die Ausführungen Honneths im Werk „Leiden an Unbestimmtheit“ sekundär berücksichtigt werden. Ziel der Arbeit ist es, den Sittlichkeitsbegriff Hegels im Kontext der GPR zu analysieren und die wichtigsten relevanten Begriffe wie Recht, Pflicht, Tugend und Rechtschaffenheit zu erhellen.
- Hegels Sittlichkeitsbegriff in den §§ 142 – 157 der GPR
- Interpretation Peperzaks zur Hegelschen Rechtsphilosophie
- Analyse der relevanten Begriffe: Recht, Pflicht, Tugend, Rechtschaffenheit
- Die Bedeutung der Sittlichkeit im Kontext der objektiven Geistlehre Hegels
- Die Struktur der §§ 142 – 157 GPR und ihre Beziehung zum Gesamtwerk
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung: Das Kapitel stellt die Relevanz des Sittlichkeitsbegriffs in Hegels Werk dar und beleuchtet dessen Entstehung in den Theologischen Jugendschriften und weiteren Werken. Die Arbeit fokussiert auf die GPR, insbesondere auf die §§ 142 – 157, und verweist auf die zentrale Rolle von Peperzaks Interpretation.
Der Weg zur Sittlichkeit: Dieses Kapitel erläutert die systematische Einordnung der Sittlichkeit in Hegels Rechtsphilosophie als Teil des objektiven Geistes. Es stellt die drei Stufen des abstrakten Rechts, der Moralität und der Sittlichkeit vor, die in der GPR systematisch aufeinander aufbauen. Die Bedeutung und Einordnung der Sittlichkeit im Rahmen dieser Dreiteilung wird dabei herausgestellt.
Schlüsselwörter
Hegels Rechtsphilosophie, Sittlichkeit, objektiver Geist, GPR, §§ 142 – 157, Peperzak, Honneth, abstraktes Recht, Moralität, Recht, Pflicht, Tugend, Rechtschaffenheit, Interpretation, Analyse, Systematisierung, Dreiteilung.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Hegel unter dem Begriff "Sittlichkeit"?
Sittlichkeit ist bei Hegel die Einheit des objektiven Rechts und der subjektiven Moralität, die sich in sozialen Institutionen wie Familie, bürgerlicher Gesellschaft und Staat manifestiert.
In welchem Werk beschreibt Hegel die Sittlichkeit am detailliertesten?
Die zentralen Ausführungen finden sich in den „Grundlinien der Philosophie des Rechts“ (GPR), speziell in den Paragraphen 142 bis 157.
Welche drei Stufen gehen der Sittlichkeit in Hegels System voraus?
Das System des objektiven Geistes baut stufenweise auf: beginnend mit dem abstrakten Recht, gefolgt von der Moralität, bis hin zur Sittlichkeit.
Was ist der Unterschied zwischen Moralität und Sittlichkeit?
Während die Moralität das subjektive Gewissen und die innere Überzeugung betont, bezeichnet Sittlichkeit die gelebte, in Institutionen verkörperte Vernunft einer Gemeinschaft.
Welche Rolle spielen "Pflicht" und "Tugend" in Hegels Theorie?
Pflichten sind die konkreten Anforderungen der sittlichen Substanz an das Individuum; Tugend ist die habituelle Übereinstimmung des Individuums mit diesen Pflichten.
Wer sind die Hauptinterpreten, auf die sich diese Arbeit stützt?
Die Arbeit orientiert sich maßgeblich an den Analysen von Peperzak und bezieht ergänzend Axel Honneths Deutung aus „Leiden an Unbestimmtheit“ mit ein.
- Citar trabajo
- Carsten Thümler (Autor), 2002, Hegels Sittlichkeit. Eine Einführung in die §§ 142 - 157 der GPR., Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/7102