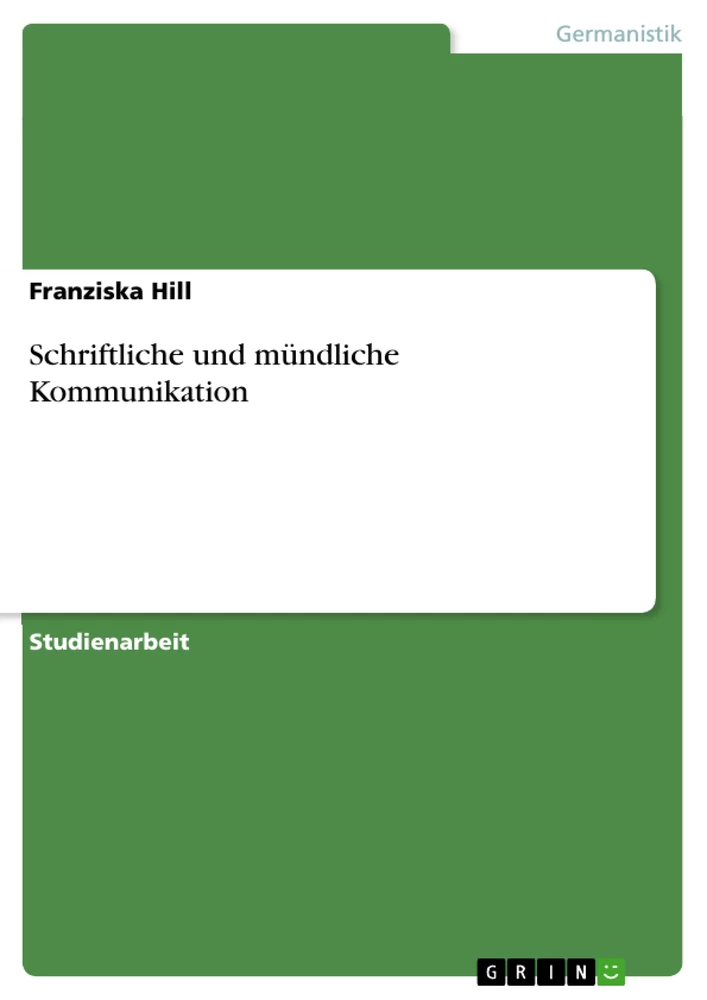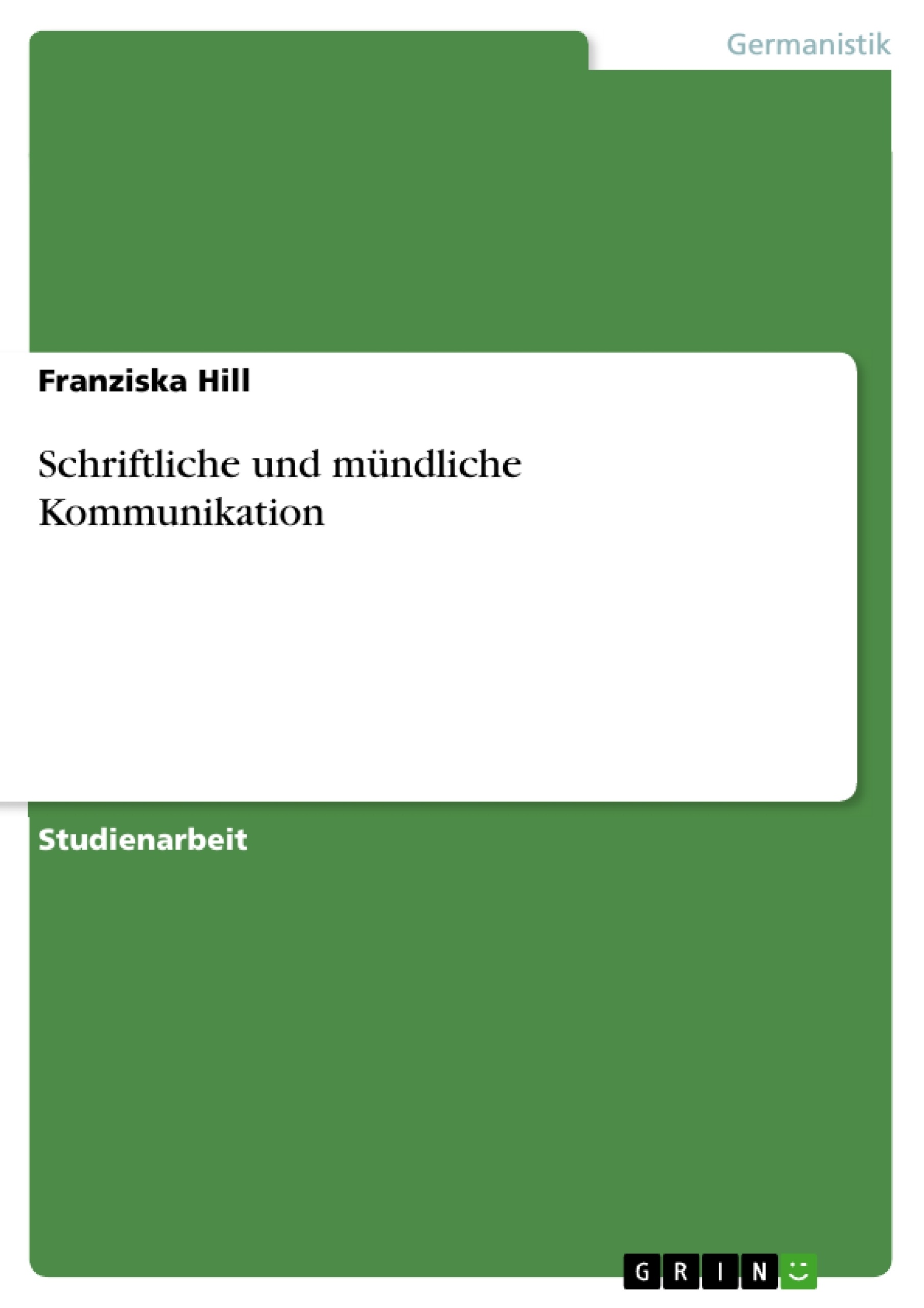Der Anteil der schriftlichen und mündlichen Kommunikation im Alltagsleben hat sich meiner Meinung nach stark verändert. In fast jedem Haushalt ist ein Computer zu finden, der dann auch meistens noch einen Internetanschluss besitzt. Dadurch werden viele Informationen auf dem schriftlichen Wege, per e-mail, ausgetauscht. Wo man früher vielleicht angerufen hätte, wird jetzt eine kurze Nachricht geschrieben.
Der Nachteil ist natürlich genauso wie bei anderen schriftlichen Erzeugnissen, dass die Nachricht nicht unmittelbar beim Empfänger ankommt, sondern zeitverzögert. Daher ist es in einigen Firmen nicht mehr erlaubt, dass die Mitarbeiter untereinander mit e-mails kommunizieren. Es hat sich herausgestellt, dass ein einfacher Anruf schneller geht, denn man bekommt die Antwort auf eine Frage unmittelbar.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Unterschiede mündlicher und schriftlicher Kommunikation
- Die Kommunikation in der Novelle "Die missbrauchten Liebesbriefe"
- Schriftlose Idylle = Ideal; Warum schreibt Keller dann?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Unterschiede zwischen mündlicher und schriftlicher Kommunikation und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft, insbesondere im Kontext von Gottfried Kellers Novellen. Der Fokus liegt auf der Analyse der Kommunikationsformen und ihrer jeweiligen Vor- und Nachteile.
- Vergleich mündlicher und schriftlicher Kommunikation
- Der Einfluss von Schriftlichkeit auf die Gesellschaft und das menschliche Denken
- Die Rolle der Kommunikation in Kellers Novelle "Die missbrauchten Liebesbriefe"
- Die scheinbare Paradoxie der schriftlosen Idylle im Vergleich zur tatsächlichen Praxis des Schreibens bei Keller
- Die Entwicklung und Auswirkungen der Schrift auf die menschliche Kultur
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beleuchtet den Wandel der Kommunikationsformen im Alltag durch die zunehmende Verbreitung von Computern und Internet. Sie hebt die Vorteile und Nachteile schriftlicher Kommunikation (z.B. Zeitverzögerung, Ausschluss von Personen ohne Internetzugang) hervor und betont die Bedeutung des Schreibens für das Speichern und Weitergeben von Wissen sowie die Notwendigkeit, die mündliche Kommunikation zu erhalten, um den zwischenmenschlichen Kontakt zu bewahren und die Verbindung zur Realität aufrechtzuerhalten. Der Text verweist auf die zunehmende Bedeutung der Schriftlichkeit in der modernen Gesellschaft und ihre Auswirkungen auf die Informationsweitergabe und den gesellschaftlichen Fortschritt, gleichzeitig aber auch die Gefahr des Verlustes von direktem, unmittelbarem Kontakt.
Unterschiede mündlicher und schriftlicher Kommunikation: Dieses Kapitel vergleicht mündliche und schriftliche Kommunikation anhand der Theorien von Eric Havelock und Walter Ong. Havelock betont die fundamentale Bedeutung der Sprache für die menschliche Kultur und die scheinbare Gleichsetzung von Schriftlichkeit mit Intelligenz. Ong diskutiert den "autonomen Diskurs" – die Unabhängigkeit des geschriebenen Textes vom Autor – und die unterschiedlichen Möglichkeiten der Interaktion und des Widerstands in mündlicher und schriftlicher Kommunikation. Der Text beleuchtet die Vorteile schriftlicher Kommunikation für die Verbreitung von Informationen, aber auch die möglichen Nachteile wie den Verlust von direktem Feedback und die potenzielle Entfremdung von der Realität. Die Kapitel analysiert kritisch die Vorteile und Gefahren der jeweiligen Kommunikationsformen, indem sie historische Beispiele und theoretische Ansätze miteinander verknüpft.
Schlüsselwörter
Mündliche Kommunikation, Schriftliche Kommunikation, Gottfried Keller, Novelle, "Die missbrauchten Liebesbriefe", Autonomer Diskurs, Oralität, Literalität, Informationsverbreitung, gesellschaftlicher Wandel, Denkfähigkeit, Interpersonelle Kommunikation.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse der Kommunikation in Gottfried Kellers "Die missbrauchten Liebesbriefe"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Unterschiede zwischen mündlicher und schriftlicher Kommunikation und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft, insbesondere im Kontext von Gottfried Kellers Novelle "Die missbrauchten Liebesbriefe". Der Fokus liegt auf der Analyse der Kommunikationsformen und ihrer jeweiligen Vor- und Nachteile. Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, einen Vergleich mündlicher und schriftlicher Kommunikation, eine Analyse der Kommunikation in Kellers Novelle und eine Auseinandersetzung mit der scheinbaren Paradoxie der schriftlosen Idylle in Kellers Werk.
Welche Theorien werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf Theorien von Eric Havelock und Walter Ong. Havelock betont die fundamentale Bedeutung der Sprache für die menschliche Kultur und die scheinbare Gleichsetzung von Schriftlichkeit mit Intelligenz. Ong diskutiert den "autonomen Diskurs" – die Unabhängigkeit des geschriebenen Textes vom Autor – und die unterschiedlichen Möglichkeiten der Interaktion und des Widerstands in mündlicher und schriftlicher Kommunikation.
Welche Aspekte der Kommunikation werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht mündliche und schriftliche Kommunikation hinsichtlich ihrer Vorteile und Nachteile. Berücksichtigt werden Aspekte wie Informationsverbreitung, direktes Feedback, potentielle Entfremdung von der Realität, der Einfluss auf das menschliche Denken und die gesellschaftliche Entwicklung. Der Vergleich wird anhand theoretischer Ansätze und historischer Beispiele durchgeführt.
Welche Rolle spielt Gottfried Kellers Novelle "Die missbrauchten Liebesbriefe"?
Kellers Novelle dient als Fallstudie, um die theoretischen Überlegungen zur mündlichen und schriftlichen Kommunikation zu illustrieren und zu konkretisieren. Die Analyse der Kommunikation in der Novelle steht im Mittelpunkt der Arbeit und liefert konkrete Beispiele für die untersuchten Kommunikationsformen und deren Auswirkungen.
Was ist die zentrale These oder Fragestellung der Arbeit?
Ein zentraler Punkt ist die scheinbare Paradoxie: Keller beschreibt eine scheinbar schriftlose Idylle, gleichzeitig ist das Schreiben aber essenziell für seine literarische Arbeit. Die Arbeit untersucht diesen Widerspruch und beleuchtet die Bedeutung der Schriftlichkeit in Kellers Werk und den Einfluss auf Gesellschaft und Kultur.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Mündliche Kommunikation, Schriftliche Kommunikation, Gottfried Keller, Novelle, "Die missbrauchten Liebesbriefe", Autonomer Diskurs, Oralität, Literalität, Informationsverbreitung, gesellschaftlicher Wandel, Denkfähigkeit, Interpersonelle Kommunikation.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zum Vergleich mündlicher und schriftlicher Kommunikation und ein Kapitel zur Analyse der Kommunikation in "Die missbrauchten Liebesbriefe". Die Einleitung beleuchtet den Wandel der Kommunikationsformen im digitalen Zeitalter.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zeigt die Vor- und Nachteile beider Kommunikationsformen auf und analysiert ihren Einfluss auf Gesellschaft und Kultur. Die Analyse von Kellers Novelle verdeutlicht die Komplexität der Kommunikation und die Auswirkungen der Schriftlichkeit auf das menschliche Denken und Handeln. Die scheinbare Paradoxie der schriftlosen Idylle wird im Kontext der Bedeutung von Schriftlichkeit für die gesellschaftliche Entwicklung diskutiert.
- Quote paper
- Franziska Hill (Author), 2003, Schriftliche und mündliche Kommunikation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/71027