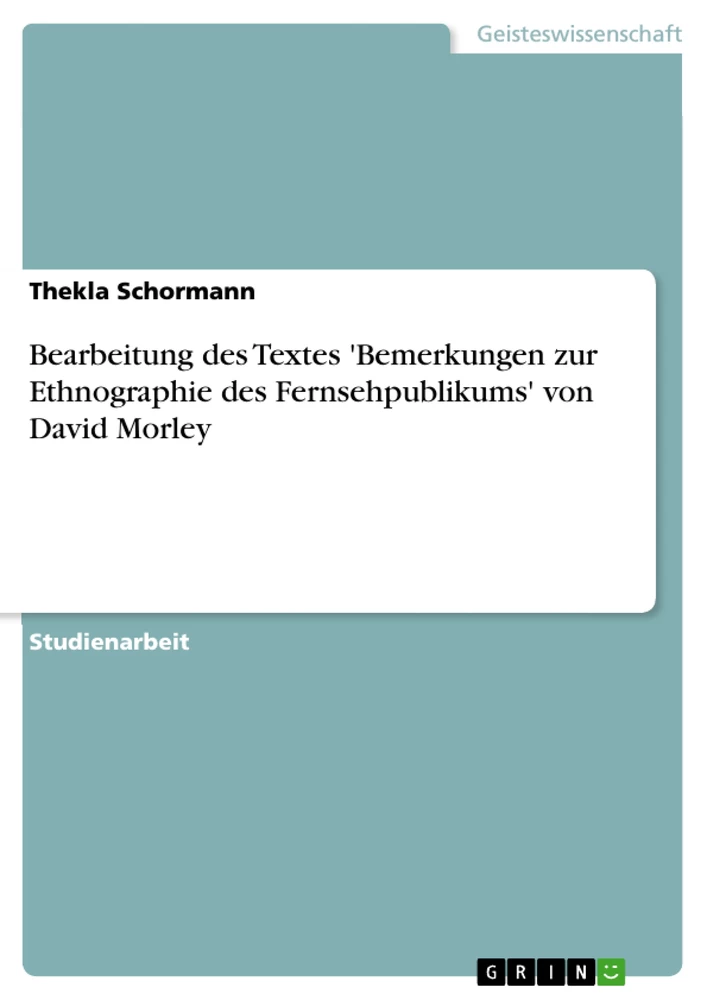Die Arbeit analysiert den Text „Bemerkungen zur Ethnographie des Fernsehpublikums“ von David Morley aus dem Jahre 1999 und stellt die Problematiken, auf die Morley in seinem Text eingeht, dar.
Hierbei geht es ihm zunächst um die Tatsache, dass Publikumsforschung bis jetzt nur auf quantitativer Ebene durchgeführt wird. Er fordert eine qualitative Forschung, welche das Fernsehen-Gucken in den Alltag des Publikums einordnet. Seine These ist hierbei, dass ein kultureller Akt, welcher so stark in den Alltag des Publikums integriert ist, nicht durch simple Quotenmessung ethnologisch oder kulturwissenschaftlich analysiert werden kann. Denn gerade diese starke Einbindung in die Alltagskultur der Menschen erfordert eine kulturwissenschaftliche qualitative Untersuchung des Fernsehen-Guckens.
Die Frage nach dem „Wie“ einer solchen Forschung versucht Morley in Verbindung mit dem Diskurs um die „Krise der Repräsentation“ in der Ethnologie zu beantworten, indem er das Für und Wider einer solchen Forschung abwägt. Es geht ihm also darum, die Frage nach dem richtigen Weg, die Methode der qualitativen Forschung zu nutzen, zu klären.
Auch Morleys Ausführungen bezüglich des Diskurses um die „Krise der Repräsentation“ des Ethnographen werden ausführlich vorgestellt. Jenen Diskurs bezieht er in die Suche nach einer geeigneten Methode für die Publikumsforschung ein, denn dieser hat die Kulturwissenschaft und ihr Selbstverständnis im Bezug auf ihre Methodik in den letzten Jahrzehnten geprägt. Diese „Krise der Repräsentation“ bezeichnet vor allem die Problematik der eigenen Authentizität des Ethnographen, welcher möglicherweise ‚das Andere’, welches er erforschen möchte, durch seinen verdichteten Blick darauf erst konstruiert.
Letztendlich versucht Morley, trotz des Problems der Authentizität des Forschers und des zu Erforschenden, Lösungsansätze für die Durchführung einer qualitativen Publikumsforschung zu finden.
Weiterhin werden Morleys Thesen und Ausführungen in den Kontext der Europäischen Eth-nologie/Kulturwissenschaft eingeordnet und auf einige Punkte, welche ein zentrales Thema in der Arbeit der Kulturwissenschaft und in ihrem Selbstverständnis bilden, wird näher eingegangen.
Letztendlich wird der Inhalt des Textes im Fazit kritisch beurteilt. Hierbei wird dargestellt, welche Punkte seiner Ausführungen überzeugen können und welche Punkte noch Fragen offen lassen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil: Empirische Publikumsforschung und der Diskurs über Ethnographie
- Methoden der Publikumsforschung
- Die quantitativ-empirische Publikumsforschung und Morleys Kritik
- Die qualitativ-empirische Publikumsforschung und die Bedeutung des Kontexts
- Der Diskurs über Ethnographie und die „Krise der Repräsentation“
- Forschungsansätze nach Morley - Das Publikum als Konstruktion?
- Das Problem der Subjektivität: Der Forscher als selbstreflektierender Autor
- Der Machtfaktor in der Ethnographie
- Der Umgang des Forschers mit Macht und Subjektivität
- Methodenvorschlag für eine kontextualisierte Publikumsforschung unter Berücksichtigung der „Krise der Repräsentation“
- Methoden der Publikumsforschung
- Kritik am Text und Fazit
- Bibliographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert David Morleys Text „Bemerkungen zur Ethnographie des Fernsehpublikums“ und setzt sich kritisch mit seinen zentralen Argumenten auseinander. Im Fokus stehen die Kritik an der traditionellen quantitativen Publikumsforschung und die Herausforderungen, die der Diskurs um die „Krise der Repräsentation“ für die Ethnographie stellt. Morley plädiert für eine qualitative Forschung, die das Fernsehverhalten im alltäglichen Kontext berücksichtigt.
- Kritik an der quantitativen Publikumsforschung
- Der Diskurs um die „Krise der Repräsentation“ in der Ethnographie
- Die Bedeutung des Kontextes für die Publikumsforschung
- Suche nach einer geeigneten Methode für die qualitative Publikumsforschung
- Einordnung der Thesen in die europäische Ethnologie/Kulturwissenschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentralen Punkte der Arbeit vor. Der Hauptteil gliedert sich in zwei Abschnitte: Zunächst wird Morleys Kritik an der quantitativen Publikumsforschung erläutert und die Bedeutung des Kontextes für die Analyse des Fernsehverhaltens betont. Im zweiten Abschnitt wird der Diskurs um die „Krise der Repräsentation“ in der Ethnographie aufgezeigt, der die Selbstreflexion des Forschers und den Umgang mit Macht und Subjektivität thematisiert. Morley argumentiert, dass die Ethnographie die „Krise der Repräsentation“ berücksichtigen muss, um valide Erkenntnisse zu gewinnen. In diesem Zusammenhang präsentiert er seinen Methodenvorschlag für eine kontextualisierte Publikumsforschung.
Schlüsselwörter
Ethnographie, Fernsehpublikum, qualitative Forschung, quantitative Publikumsforschung, „Krise der Repräsentation“, Kontextualisierung, Macht, Subjektivität, Selbstreflexion
Häufig gestellte Fragen
Was kritisiert David Morley an der traditionellen Publikumsforschung?
Er kritisiert, dass sie meist nur quantitativ (über Quoten) erfolgt und fordert stattdessen eine qualitative Forschung, die den Alltagskontext der Zuschauer einbezieht.
Was ist die „Krise der Repräsentation“ in der Ethnologie?
Sie bezeichnet die Problematik, dass Forscher „das Andere“ durch ihren Blick erst konstruieren und ihre eigene Authentizität sowie Subjektivität kritisch hinterfragen müssen.
Warum ist der Kontext beim Fernsehen-Gucken so wichtig?
Fernsehen ist ein kultureller Akt, der tief in den Alltag integriert ist. Nur durch die Untersuchung des sozialen Umfelds lässt sich die wahre Bedeutung verstehen.
Welche Rolle spielt Macht in der ethnographischen Forschung?
Morley thematisiert das Machtgefälle zwischen Forscher und Beforschten und wie dieses die Ergebnisse beeinflussen kann.
Was ist Morleys Methodenvorschlag?
Er plädiert für eine kontextualisierte, selbstreflektierende Publikumsforschung, die die Subjektivität des Forschers offenlegt.
Wie wird Morleys Text in der Kulturwissenschaft bewertet?
Die Arbeit ordnet seine Thesen in das Selbstverständnis der Europäischen Ethnologie ein und beurteilt kritisch, welche Fragen noch offen bleiben.
- Quote paper
- Thekla Schormann (Author), 2006, Bearbeitung des Textes 'Bemerkungen zur Ethnographie des Fernsehpublikums' von David Morley , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/71072