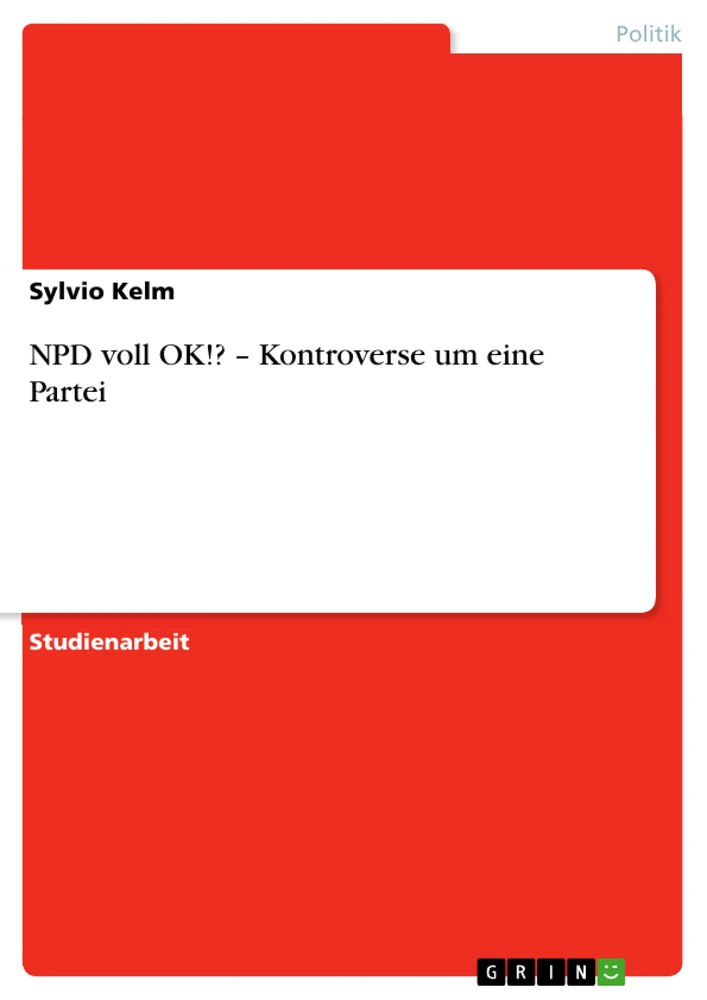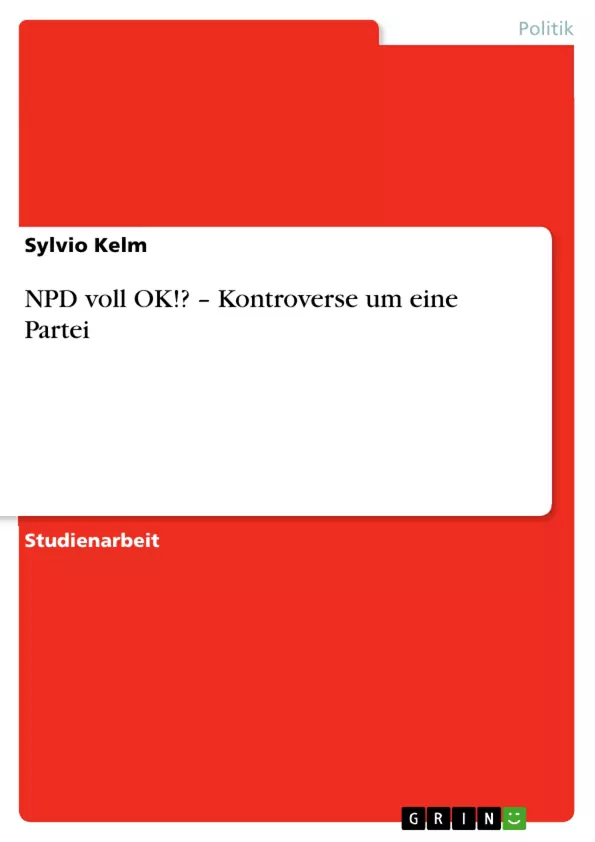Die Gewalttaten im Jahr 2000, denen rechtsradikale Motive nachgewiesen werden konnten, erlangten eine hohe öffentliche Aufmerksamkeit. Auch symbolische Aktionen rechter Parteien (insbesondere der NPD), wie beispielsweise der Demonstrationszug am Brandenburger Tor, erregten zudem Assoziationen zum deutschen Nationalsozialismus im In- und Ausland. Die politischen Akteure sahen sich in einem Handlungszwang. Forderungen nach einem Antrag zur Untersuchung der Verfassungswidrigkeit der ,,Nationaldemokratischen Partei Deutschlands" (NPD) waren die Folge. Die Debatte um ein Verbot der NPD verdeutlicht die Schwierigkeiten hinsichtlich des Umgangs mit Rechtsextremismus. Zwei Meinungen klaffen auseinander: Ausschöpfung der konventionellen Verbrechensbekämpfung und die Forderung nach der "wehrhaften" Demokratie.
Ein Hauptargument der Befürworter eines Verbots lautet, dass die NPD sich zu einer aggressiv- kämpferischen Partei in den letzten Jahren entwickelt hat. Die vorliegende Arbeit versucht den politischen Werdegang der NPD nachzuzeichnen und mögliche Veränderungen in der Struktur ihrer Anhänger und ihrer Programmatik heraus zu filtern, um aus diesen Ergebnissen die Rechtfertigung für bzw. gegen einen Verbotsantrag zu finden. Unsere Fragestellung zielt darauf ab, ob es der Tatsache entspricht, dass dieser Trend erst in den letzten Jahren eingetreten ist und zur der Debatte im Sommer geführt hat oder ob es sich beim Verbotsantrag nur um "symbolische Politik" gehandelt hat, die keine effektiven Ergebnisse im Kampf gegen Rechtsextremismus bringen wird. Deshalb teilten wir die Arbeit in zwei Hauptteile: Im ersten Teil der Arbeit gehen wir auf die Entstehung der NPD und ihre Entwicklung ein. Die Programmatik und die Mitgliederzusammensetzung bilden hierbei die beiden Kernelemente. Am Rande werden parteipolitische Ereignisse (z.B. Wahlerfolge, Führungswechsel) in die Betrachtung mit einfließen, da wir davon ausgehen, dass sie die Entwicklung der Partei beeinflussten.
Der zweite Teil beschäftigt sich mit der Parteiverbotsdebatte an sich und liefert eine Beschreibung des Weges zum Parteiverbotsantrag durch die Verfassungsinstitutionen (Bundesregierung, Bundesrat und Bundestag) anhand von Berichterstattungen von verschiedenen Medien (Internet, Wochen- und Tageszeitschriften). Eingegangen wird auch auf die Akteure und Institutionen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gründung und Entwicklung der NPD
- Der Weg zum Verbotsantrag
- Schlussbetrachtung
- Parteiverbotsdebatte
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Entwicklung der NPD und die Debatte um ein Verbot der Partei. Sie untersucht, ob sich die NPD in den letzten Jahren zu einer aggressiv-kämpferischen Partei entwickelt hat und ob diese Veränderung die Grundlage für den Verbotsantrag im Sommer 2000 bildet.
- Entstehung und Entwicklung der NPD
- Programmatik und Mitgliederzusammensetzung der NPD
- Parteiverbotsdebatte und ihre Akteure
- Der Weg zum Verbotsantrag durch die Verfassungsinstitutionen
- Rechtsextremismus in Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Arbeit befasst sich mit dem Thema des Rechtsextremismus in Deutschland, insbesondere mit der NPD und der Debatte um ein Verbot dieser Partei. Die Einleitung erläutert den Hintergrund und die Relevanz des Themas, insbesondere im Kontext der Gewalttaten im Jahr 2000, die auf rechte Motive zurückzuführen sind. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die Entwicklung der NPD und ihre Programmatik zu beleuchten, um die Rechtfertigung für oder gegen einen Verbotsantrag zu beurteilen.
Gründung und Entwicklung der NPD
Dieses Kapitel beschreibt die Entstehung der NPD im Jahr 1964 als Zusammenschluss mehrerer rechtsradikaler Parteien. Es analysiert die programmatische Zielsetzung, die vornehmlich auf eine Rückkehr zu nationalen Werten und eine starke Autorität setzt. Das Kapitel beleuchtet auch die Mitgliederstruktur und die Entwicklung der Partei in den ersten Jahren nach der Gründung, wobei der Fokus auf den Einfluss von ehemaligen NSDAP-Mitgliedern und dem Wandel der Programmatik liegt.
Parteiverbotsdebatte
Der dritte Abschnitt beschäftigt sich mit der Debatte um ein Verbot der NPD. Er untersucht die politischen und juristischen Prozesse, die zum Verbotsantrag führten. Die Arbeit beleuchtet die Rolle der Verfassungsinstitutionen (Bundesregierung, Bundesrat und Bundestag) und der Medien in der Debatte. Das Kapitel analysiert die Argumente der Befürworter und Gegner eines Verbots und die Schwierigkeiten im Umgang mit Rechtsextremismus.
Schlüsselwörter
NPD, Rechtsextremismus, Parteiverbot, Verfassungsschutz, Nationalismus, Demokratie, Bundesrepublik Deutschland, Nationalsozialismus, Rechtsradikalismus, Programmatik, Mitgliederstruktur, Parteientwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Warum wurde im Jahr 2000 über ein Verbot der NPD debattiert?
Anlass waren vermehrte rechtsextreme Gewalttaten und provokante Aktionen der Partei, wie Demonstrationen am Brandenburger Tor, die national und international für Aufsehen sorgten.
Wie hat sich die NPD seit ihrer Gründung 1964 entwickelt?
Die Arbeit zeichnet den Weg von der Gründung als Zusammenschluss rechtsradikaler Kräfte bis hin zur Entwicklung zu einer als „aggressiv-kämpferisch“ eingestuften Partei nach.
Welche Rolle spielen die Verfassungsinstitutionen beim Parteiverbot?
Bundesregierung, Bundesrat und Bundestag sind die Akteure, die den Antrag auf Prüfung der Verfassungswidrigkeit beim Bundesverfassungsgericht stellen können.
Was sind die Kernpunkte der NPD-Programmatik?
Die Programmatik ist geprägt von Nationalismus, der Forderung nach Rückkehr zu traditionellen Werten und einer starken Autorität, oft unter Einbeziehung ehemaliger nationalsozialistischer Ideologeme.
Wird der Verbotsantrag als effektives Mittel gegen Rechtsextremismus gesehen?
Die Arbeit diskutiert, ob ein Verbot tatsächlich Ergebnisse bringt oder ob es sich eher um „symbolische Politik“ handelt, während konventionelle Verbrechensbekämpfung vernachlässigt wird.
- Quote paper
- Sylvio Kelm (Author), 2001, NPD voll OK!? – Kontroverse um eine Partei, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/711