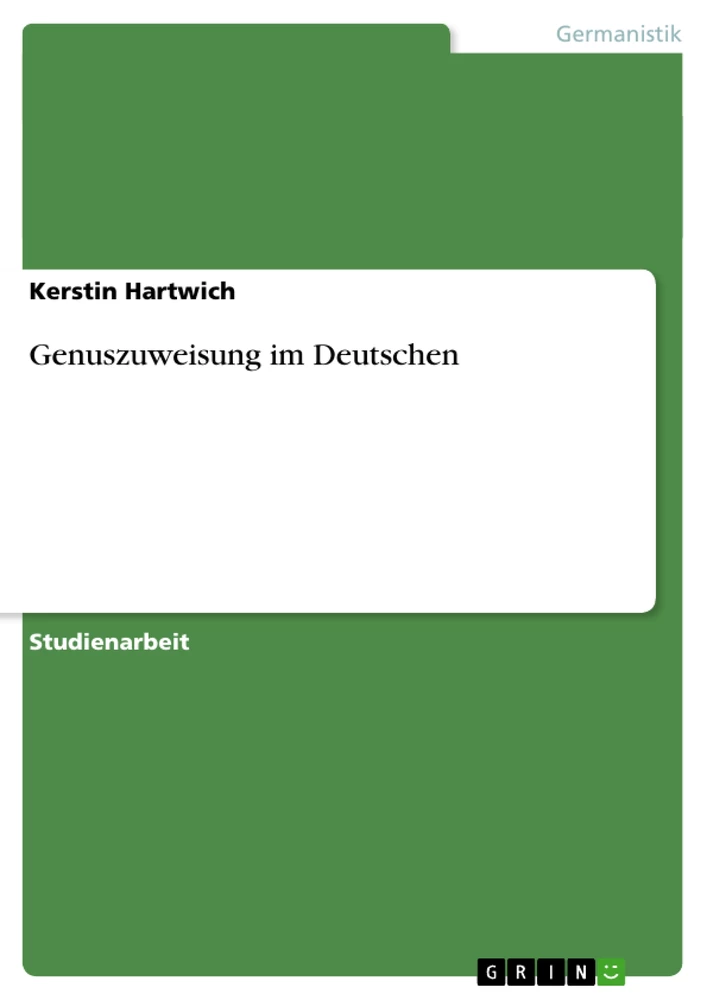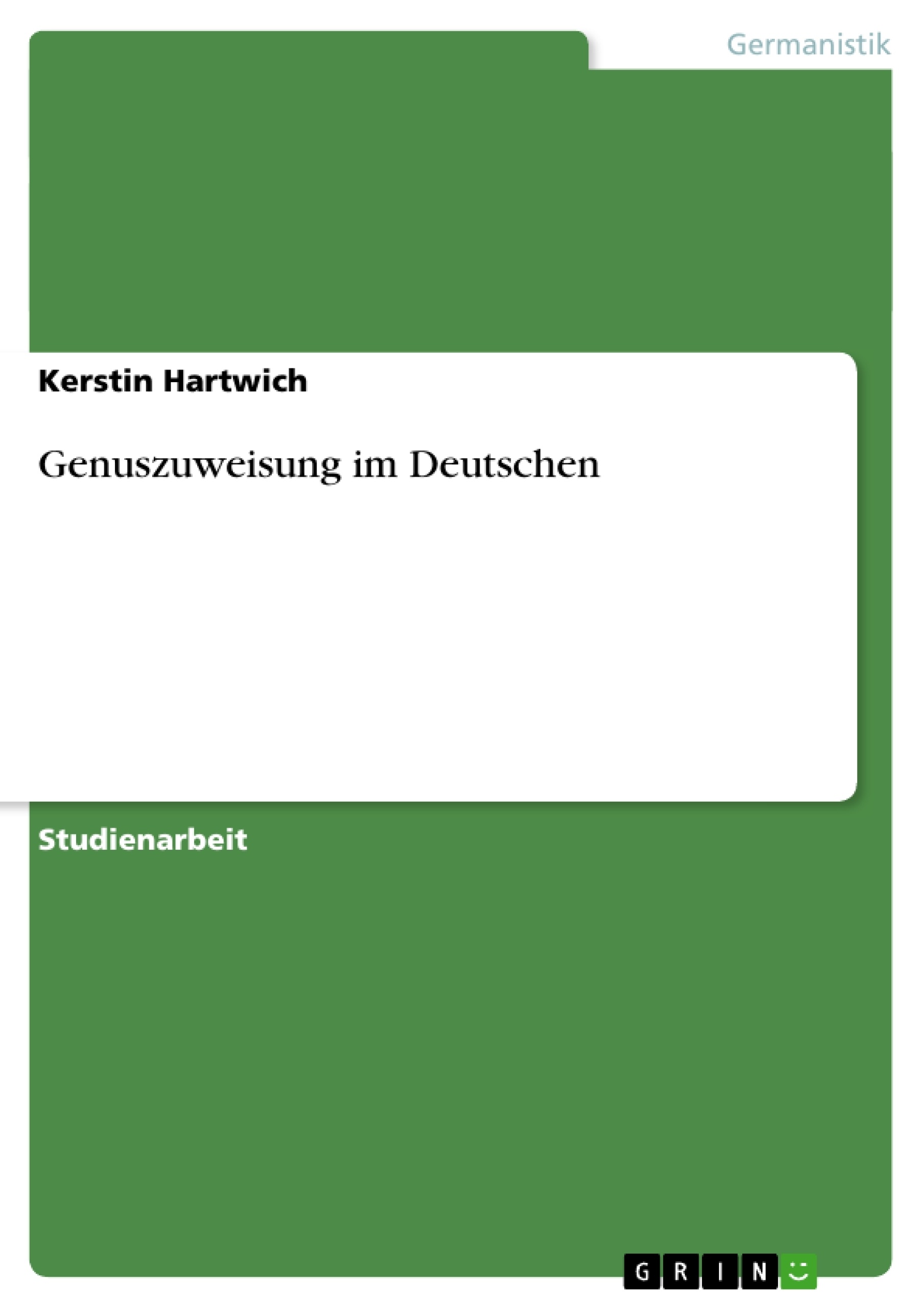Die direkte Genusentlehnung aus der Stammsprache der Lehn- und Fremdworte betrifft nur einen Teil derer, nämlich diejenigen, die einer Genussprache entstammen.
Sprachen, die ohne ein grammatisches Geschlecht auskommen, hier seien als Beispiele das Englische, das Finnische, sowie das Türkische genannt, können auch kein grammatisches Geschlecht für das entsprechende Wort im neu vererbten, deutschen Zusammenhang motivieren. Folglich kann eine Genuszuweisung nur für die Entlehnung von Worten, die aus Genussprachen, wie beispielsweise dem Spanischen, dem Französischen, oder dem Lateinischen stammen, gelten.
Da nun aber nur bilinguale Sprecher das ursprüngliche Genus eines Wortes in der Stammsprache wissen können, ist diese Art der Genuszuweisung auch nur unter ihnen besonders frequent, oder wird von jenen besonders stark etabliert. Auch sei die direkte Genusentlehnung, so Marion Schulte-Beckhausen in ihrem Aufsatz2, vor allem ein Phänomen der Grenzgebiete und der direkten Kommunikation zwischen bilingualen und monolingualen Sprechern, wo es zu einer Übernahme und/oder Nachahmung der Sprechweise und damit des Genusgebrauchs des bilingualen Sprechers durch den monolingualen Sprecher kommt. Oft kommt es so aber auch zu gegenläufigen Entwicklungen. Benutzt nämlich der bilinguale Sprecher aus irgendeinem Grund, z.B. der Unterstellung eines anderen Kriteriums (dazu später mehr), ein nicht-originales Genus, wächst auch die Wahrscheinlichkeit, dass der bilinguale Sprecher dieses übernimmt, wenn er das entsprechende Lehnwort im deutschen Sprachzusammenhang verwendet. Oft hält der bilinguale Sprecher dann aber am ursprünglichen Genus fest um als besonders gebildet oder sprachgewandt zu gelten.
Offenbar spielt hierbei der Etablierungszeitraum eine besondere Rolle.
[...]
2 Schulte-Beckhausen, Marion (2002): Genusschwankungen bei Anglizismen, französischen, italienischen und spanischen Lehnwörtern im Deutschen: Eine Untersuchung auf den Grundlagen deutscher Wörterbücher seit 1945. Frankfurt/Main: Lang.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kriterien der Genusübernahme
- Die Genunsentlehnung
- Das natürliche Geschlecht
- Formale Kriterien
- Die Genuszuweisung entsprechend dem Wortausgang
- Genuszuweisung nach der Lautgestalt
- Genuszuweisung nach dem Schriftbild
- Semantische Kriterien
- Der übergeordnete Gattungsbegriff
- Die latente semantische Analogie
- Das abstrakte Neutrum
- Soziolinguistische Kriterien
- Persönliches Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Genuszuweisung von Fremdwörtern im Deutschen. Ziel ist es, zu untersuchen, ob und inwiefern die Genuszuweisung von Fremdwörtern durch bestimmte Kriterien vorhersehbar ist. Hierzu werden die verschiedenen Kriterien der Genuszuweisung analysiert und deren hierarchisches Beziehungsgefüge sowie deren pragmatischer Gehalt überprüft, um deren Zuverlässigkeit einzuschätzen.
- Die Bedeutung der Genunsentlehnung aus der Stammsprache
- Die Rolle des natürlichen Geschlechts bei der Genuszuweisung
- Die Bedeutung formaler Kriterien wie Wortausgang, Lautgestalt und Schriftbild
- Die Rolle semantischer Kriterien wie Gattungsbegriff, semantische Analogie und abstraktes Neutrum
- Die Relevanz soziolinguistischer Faktoren
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Problematik der Genuszuweisung von Fremdwörtern im Deutschen dar. Es wird erläutert, dass das Deutsche im Gegensatz zu einigen Stammsprachen eine eindeutige Genuszuweisung erfordert. Es wird die Frage aufgeworfen, ob und inwiefern die Genuszuweisung von Fremdwörtern durch bestimmte Kriterien vorhersehbar ist.
Kriterien der Genusübernahme
Die Genunsentlehnung
Dieser Abschnitt untersucht die direkte Genusentlehnung aus der Stammsprache der Lehn- und Fremdwörter. Es wird festgestellt, dass diese Form der Genuszuweisung nur für Sprachen gilt, die ein grammatisches Geschlecht besitzen. Die Rolle bilingualer Sprecher und die Etablierungszeiträume werden beleuchtet. Als Beispiel werden die Wörter "Baguette" und "Tequila" betrachtet.
Das natürliche Geschlecht
Dieser Abschnitt fokussiert sich auf das Kriterium des natürlichen Geschlechts. Es wird beschrieben, wie das Deutsche Personenbezeichnungen entsprechend ihres natürlichen Geschlechts kategorisiert. Die Übernahmepraxis bei Fremd- und Lehnwörtern wird untersucht.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Genuszuweisung, Fremdwörter, Lehnwörter, Genussprache, natürliche Geschlecht, formale Kriterien, semantische Kriterien, soziolinguistische Kriterien, Etablierungszeitraum, bilingualer Sprecher, monolingualer Sprecher, Sprachentlehnung.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird das grammatische Geschlecht (Genus) von Fremdwörtern im Deutschen bestimmt?
Die Zuweisung erfolgt nach verschiedenen Kriterien: der Entlehnung aus der Stammsprache, dem natürlichen Geschlecht, formalen Wortendungen oder semantischen Analogien.
Was passiert, wenn ein Wort aus einer Sprache ohne Genus (z. B. Englisch) kommt?
In diesem Fall greifen oft semantische Kriterien (z. B. "das Auto" -> "der Ford") oder formale Analogien zum Deutschen.
Was ist die "semantische Analogie" bei der Genuszuweisung?
Fremdwörter erhalten oft das Genus des entsprechenden deutschen Begriffs, z. B. "die Baguette", weil es "die Stange (Brot)" bedeutet.
Welche Rolle spielen bilinguale Sprecher?
Bilinguale Sprecher kennen das Originalgenus und etablieren dieses oft im Deutschen, während monolinguale Sprecher eher nach Klang oder Analogie entscheiden.
Warum schwankt das Genus bei manchen Wörtern (z. B. der/das Blog)?
Genusschwankungen entstehen, wenn verschiedene Kriterien gleichzeitig wirken (z. B. Lautgestalt vs. semantische Analogie) und sich noch kein Standard durchgesetzt hat.
- Citation du texte
- Kerstin Hartwich (Auteur), 2007, Genuszuweisung im Deutschen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/71147