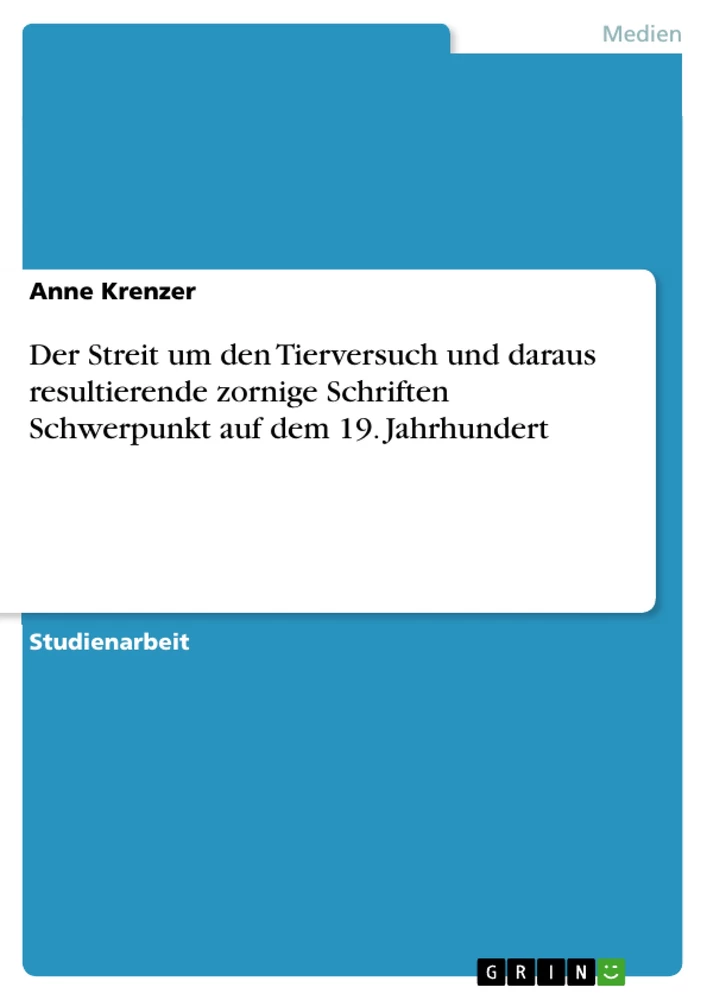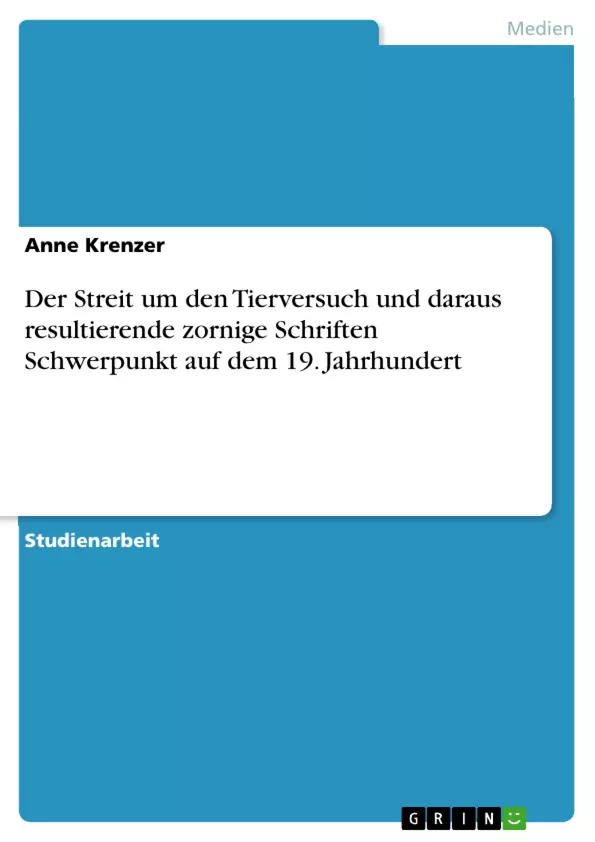Was verbirgt sich hinter dem Begriff „zornige Bücher“? - diese Frage stand am Anfang des Seminars über „Religiöse Manifeste, politische Pamphlete und literarische Provokationen.“ Die vorliegende Arbeit will das am Thema Vivisektion oder genauer gesagt am Streit um den Tierversuch mit Schwerpunkt auf dem 19. Jahrhundert untersuchen. Wie bereits das Zitat im Titel verrät, bietet er mehr „zornigen“ Stoff, als auf den ersten Blick zu vermuten wäre. Zunächst sind einige Begriffsklärungen, Abgrenzungen und Einschränkungen notwendig, denn eine umfassende Auseinandersetzung mit dem Begriff Zorn würde ein eigenes Forschungsthema darstellen und kann hier nicht geleistet werden. Der theoretische Hintergrund der Arbeit wird jedoch von den Fragen bestimmt „Was ist Zorn?“ und „Können Bücher/Medien zornig sein?“. Wörterbücher und Lexika liefern keine einheitliche Zorn-Definition , es kristallisieren sich aber zumindest einige Merkmale heraus, die auch dem Verständnis von Zorn in dieser Arbeit zu Grunde liegen: Zorn ist eine heftige und leidenschaftliche Emotion/ein Affekt, der mit Ungerechtigkeitsempfinden - sowohl in Bezug auf die eigene Person als auch in Bezug auf andere - einhergeht und sich (mehr oder weniger aggressiv) gegen einen bestimmten Verursacher oder Anlass richtet. Nach dem Verständnis der Verfasserin unterscheidet sich „Zorn“ von „Ärger“ und „Wut“ durch die „rationale und im weitesten Sinne ethische Komponente“ , d.h. er hat etwas mit Reflexion zu tun, und die Ungerechtigkeit oder Verwerflichkeit wird mit Bezug auf bestimmte Wertvorstellungen und Normen empfunden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begrifflicher und geschichtlicher Hintergrund
- Zum Begriff Vivisektion
- Vivisektion bis ins 19. Jahrhundert: Geschichte, Denkmuster und Debatten
- Rahmenbedingungen und Tendenzen des Vivisektionsstreits im 19.Jahrhundert
- Zornige Bücher? – Streitschriften zum Thema Vivisektion
- Der Vivisektionsstreit in Deutschland - Ernst von Weber und Rudolf Heidenhain als Protagonisten
- Ernst von Webers ,,Folterkammern der Wissenschaft"
- Inhalt: Argumente und Behauptungen
- Form: Techniken der Darstellung
- Rudolf Heidenhains Abhandlung „Auf Veranlassung des Königlich Preußischen Ministers...“
- Ausblick: Debatten um Tierversuche bis in die Gegenwart
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Streit um den Tierversuch im 19. Jahrhundert und untersucht, wie dieses Thema in „zornigen“ Schriften zum Ausdruck kommt. Sie analysiert sowohl den Inhalt als auch die Form dieser Schriften und beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven und Argumentationsstrategien der Protagonisten.
- Die Entstehung des Begriffs „Vivisektion“ und seine historische Entwicklung
- Die Entwicklung des Vivisektionsstreits im 19. Jahrhundert
- Die Analyse von Streitschriften als Ausdruck von Zorn im Kontext des Tierversuchs
- Die Rolle von Kommunikations-Techniken in der Darstellung von Argumenten und Emotionen
- Die Bedeutung des Diskurses und der Umgangsweisen mit einem umstrittenen Gegenstand
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema „zorniger Bücher“ ein und erläutert den Begriff Zorn im Kontext des Tierversuchs. Kapitel 2 behandelt den Begriff „Vivisektion“ und die historische Entwicklung des Tierversuchs mit Schwerpunkt auf dem 19. Jahrhundert. Kapitel 3 analysiert den Vivisektionsstreit in Deutschland anhand von zwei exemplarischen Schriften: Ernst von Webers „Folterkammern der Wissenschaft“ und Rudolf Heidenhains Abhandlung „Auf Veranlassung des Königlich Preußischen Ministers...“.
Schlüsselwörter
Vivisektion, Tierversuch, Zorn, Streitschriften, Kommunikation, Diskurs, 19. Jahrhundert, Ernst von Weber, Rudolf Heidenhain, „Folterkammern der Wissenschaft“, „Vivisection“, Ethische Argumente, Medizinische Argumente, Rechtliche Argumente.
- Quote paper
- Anne Krenzer (Author), 2005, Der Streit um den Tierversuch und daraus resultierende zornige Schriften Schwerpunkt auf dem 19. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/71181