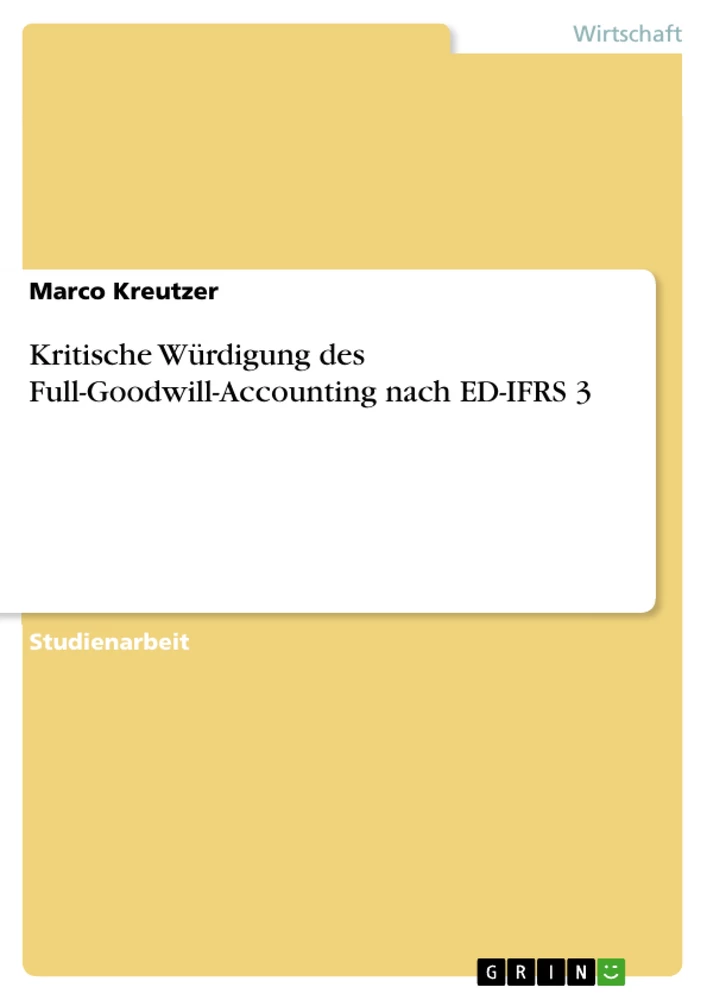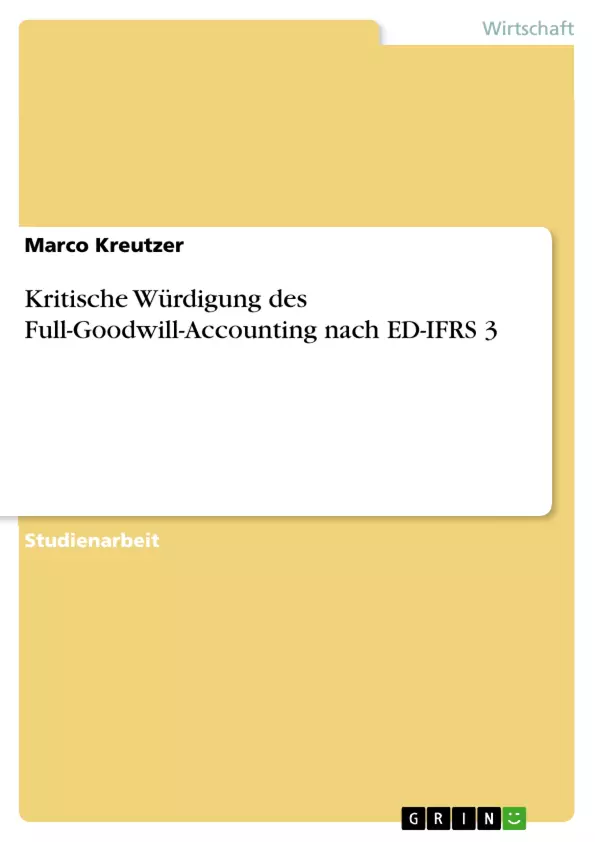Die Beurteilung der Full-Goodwill-Methode erfolgt anhand von qualitativen Anforderungen, die an einen IFRS-Abschluss gestellt werden. Danach müssen vermittelte Informationen einerseits Relevanz für die Entscheidungsfindung von Investoren besitzen, im Folgenden wird von der Vermittlung eines Informationsnutzens gesprochen. Andererseits dürfen Informationen keine wesentlichen Fehler enthalten, um nicht nur relevant, sondern auch verlässlich zu sein. In der Regel besteht ein Zielkonflikt zwischen Relevanz und Verlässlichkeit. Johnson (2005) befürwortet im Zweifel die stärkere Fokussierung auf die Vermittlung des Informationsnutzens.
Insbesondere wird daher untersucht, inwiefern durch die Einführung der Full-Goodwill-Methode eine Annäherung des Konzerneigenkapitals an den Wert des Konzerns gelingt und ob der Ausweis eines nicht auf die Mehrheitsgesellschafter entfallenden Goodwills relevante Informationen für die Adressaten des Konzernabschlusses bereitstellt. Die Diskussion über den Charakter des ausgewiesenen Geschäfts- oder Firmenwerts gewinnt zentrale Bedeutung auf Grund der zunehmenden Gleichbehandlung des Goodwills mit gewöhnlichen Vermögenswerten sowie den sich daraus ergebenden Konsequenzen für die Verlässlichkeit der berichteten Informationen. Zielkonflikte zwischen den beiden qualitativen Anforderungen eröffnen sich bei der Diskussion über die Anschaffungskostenrestriktion für den auf die Mehrheiten entfallenden Geschäfts- oder Firmenwert. Spezielle Problembereiche sowie die Auswirkungen der geplanten Goodwill-Bilanzierung auf die investororientierte Bilanzanalyse werden hier nicht thematisiert, da sich die vorliegende Arbeit ausschließlich mit grundlegenden Problemen der vorgeschlagenen Bilanzierungstechnik befasst. Weiterhin wird nicht detailliert auf den Anwendungsbereich des zu Grunde liegenden Exposure Drafts und auf entstehende Inkonsistenzen mit anderen Standards eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- Problemstellung
- Einordnung der Full-Goodwill-Methode in das Regelwerk der Konzernrechnungslegung
- Systematische Hinführung zur Full-Goodwill-Methode
- Kompatibilität mit den zu Grunde liegenden Bilanztheorien
- Auswirkungen auf das Fair Value Konzept
- Kritische Beleuchtung der Vorgehensweise
- Grundsätzliche Methoden zur Ermittlung des Full-Goodwills
- Erläuterung einzelner Schritte der Full-Goodwill-Bilanzierung
- Ermittlung des Unternehmenswertes des Tochterunternehmens
- Bilanzierung und Bewertung des übernommenen Nettovermögens
- Aufteilung des Full-Goodwills auf die Gesellschafterstämme
- Konsequenzen für die Folgekonsolidierung des Full-Goodwills
- Beurteilung im Hinblick auf Anforderungen eines IFRS-Abschlusses
- Kritische Würdigung des vermittelten Informationsnutzens (relevance)
- Kritische Würdigung der erreichbaren Verlässlichkeit (reliability)
- Thesenförmige Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich kritisch mit der Full-Goodwill-Methode im Rahmen von IFRS 3. Ziel ist es, die Methode im Hinblick auf ihre Vereinbarkeit mit den Anforderungen an einen IFRS-Abschluss zu untersuchen, insbesondere hinsichtlich Relevanz und Verlässlichkeit der bereitgestellten Informationen. Die Arbeit analysiert die Methode selbst, ihre Auswirkungen auf die Konzernbilanzierung und die daraus resultierenden Konsequenzen.
- Kritische Analyse der Full-Goodwill-Methode nach IFRS 3
- Bewertung der Methode im Hinblick auf Relevanz und Verlässlichkeit der Informationen
- Untersuchung der Kompatibilität mit bestehenden Bilanztheorien
- Auswirkungen auf die Konzernkonsolidierung und die Folgebilanzierung
- Zielkonflikt zwischen Relevanz und Verlässlichkeit im Kontext der Full-Goodwill-Methode
Zusammenfassung der Kapitel
Problemstellung: Die Arbeit untersucht die geplante Einführung der Full-Goodwill-Methode im Rahmen des IASB/FASB-Projekts "Business Combinations Phase II" und deren Auswirkungen auf die Konzernrechnungslegung. Der Fokus liegt auf der Frage, ob diese Methode zu einer besseren Annäherung des Konzerneigenkapitals an den Unternehmenswert führt und ob der ausgewiesene Goodwill relevante Informationen für Adressaten des Konzernabschlusses liefert. Die Arbeit konzentriert sich auf grundlegende Probleme der vorgeschlagenen Bilanzierungstechnik und lässt spezielle Problemfelder außer Acht.
Einordnung der Full-Goodwill-Methode in das Regelwerk der Konzernrechnungslegung: Dieses Kapitel führt systematisch in die Full-Goodwill-Methode ein, beleuchtet ihre Kompatibilität mit bestehenden Bilanztheorien und untersucht die Auswirkungen auf das Fair-Value-Konzept. Es wird der Zusammenhang zwischen der Methode und dem Ziel der Fair-Value-Bilanzierung hergestellt und die damit verbundenen Herausforderungen und Interpretationsspielräume diskutiert.
Kritische Beleuchtung der Vorgehensweise: Dieses Kapitel analysiert die Methoden zur Ermittlung des Full-Goodwills, erläutert die einzelnen Schritte der Bilanzierung und bewertet die Konsequenzen für die Folgekonsolidierung. Es werden detailliert die Schritte der Ermittlung des Unternehmenswerts, die Bilanzierung des Nettovermögens und die Aufteilung des Goodwills auf die Gesellschafterstämme beschrieben und kritisch hinterfragt. Die Auswirkungen auf die zukünftige Konsolidierung werden ebenfalls behandelt.
Beurteilung im Hinblick auf Anforderungen eines IFRS-Abschlusses: Dieses Kapitel bewertet die Full-Goodwill-Methode anhand der qualitativen Anforderungen an einen IFRS-Abschluss, nämlich Relevanz und Verlässlichkeit. Es wird untersucht, inwieweit die Methode den Informationsnutzen für Investoren verbessert und ob die erzielte Verlässlichkeit den Anforderungen genügt. Mögliche Zielkonflikte zwischen diesen beiden Aspekten werden diskutiert.
Schlüsselwörter
Full-Goodwill-Methode, IFRS 3, Konzernrechnungslegung, Fair Value, Relevanz, Verlässlichkeit, Informationsnutzen, Bilanzierung, Konsolidierung, Unternehmenswert, Goodwill.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Full-Goodwill-Methode im Rahmen von IFRS 3
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert kritisch die Full-Goodwill-Methode im Kontext von IFRS 3. Der Fokus liegt auf der Vereinbarkeit der Methode mit den Anforderungen an einen IFRS-Abschluss, insbesondere hinsichtlich Relevanz und Verlässlichkeit der bereitgestellten Informationen. Untersucht werden die Methode selbst, ihre Auswirkungen auf die Konzernbilanzierung und die daraus resultierenden Konsequenzen.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit umfasst eine systematische Einführung in die Full-Goodwill-Methode, eine kritische Beleuchtung der Vorgehensweise bei der Ermittlung und Bilanzierung des Full-Goodwills, eine Beurteilung der Methode im Hinblick auf die Anforderungen an einen IFRS-Abschluss (Relevanz und Verlässlichkeit) und eine thesenförmige Zusammenfassung der Ergebnisse. Die Kompatibilität mit bestehenden Bilanztheorien und die Auswirkungen auf die Konzernkonsolidierung und Folgebilanzierung werden ebenfalls untersucht.
Wie wird die Full-Goodwill-Methode in das Regelwerk der Konzernrechnungslegung eingeordnet?
Das Kapitel zur Einordnung der Full-Goodwill-Methode beleuchtet deren systematische Hinführung, die Kompatibilität mit bestehenden Bilanztheorien und die Auswirkungen auf das Fair-Value-Konzept. Der Zusammenhang zwischen der Methode und dem Ziel der Fair-Value-Bilanzierung wird hergestellt, und die damit verbundenen Herausforderungen und Interpretationsspielräume werden diskutiert.
Wie wird die Vorgehensweise bei der Full-Goodwill-Methode kritisch beleuchtet?
Die kritische Beleuchtung umfasst die Analyse der Methoden zur Ermittlung des Full-Goodwills, eine detaillierte Erläuterung der einzelnen Bilanzierungsschritte (Ermittlung des Unternehmenswerts, Bilanzierung des Nettovermögens, Aufteilung des Goodwills), und eine Bewertung der Konsequenzen für die Folgekonsolidierung. Die einzelnen Schritte werden kritisch hinterfragt.
Wie wird die Methode im Hinblick auf die Anforderungen eines IFRS-Abschlusses beurteilt?
Die Beurteilung erfolgt anhand der qualitativen Anforderungen an einen IFRS-Abschluss, nämlich Relevanz und Verlässlichkeit. Es wird untersucht, inwieweit die Methode den Informationsnutzen für Investoren verbessert und ob die erzielte Verlässlichkeit den Anforderungen genügt. Mögliche Zielkonflikte zwischen Relevanz und Verlässlichkeit werden diskutiert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Full-Goodwill-Methode, IFRS 3, Konzernrechnungslegung, Fair Value, Relevanz, Verlässlichkeit, Informationsnutzen, Bilanzierung, Konsolidierung, Unternehmenswert, Goodwill.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Full-Goodwill-Methode auf ihre Vereinbarkeit mit den Anforderungen an einen IFRS-Abschluss. Das Ziel ist es, die Methode hinsichtlich Relevanz und Verlässlichkeit der bereitgestellten Informationen zu bewerten und deren Auswirkungen auf die Konzernbilanzierung zu analysieren.
Welche Kapitelzusammenfassungen bietet die Arbeit?
Die Arbeit bietet Kapitelzusammenfassungen zur Problemstellung, der Einordnung der Full-Goodwill-Methode, der kritischen Beleuchtung der Vorgehensweise und der Beurteilung im Hinblick auf die Anforderungen eines IFRS-Abschlusses. Diese Zusammenfassungen geben einen Überblick über den Inhalt der jeweiligen Kapitel.
- Arbeit zitieren
- Marco Kreutzer (Autor:in), 2006, Kritische Würdigung des Full-Goodwill-Accounting nach ED-IFRS 3, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/71241