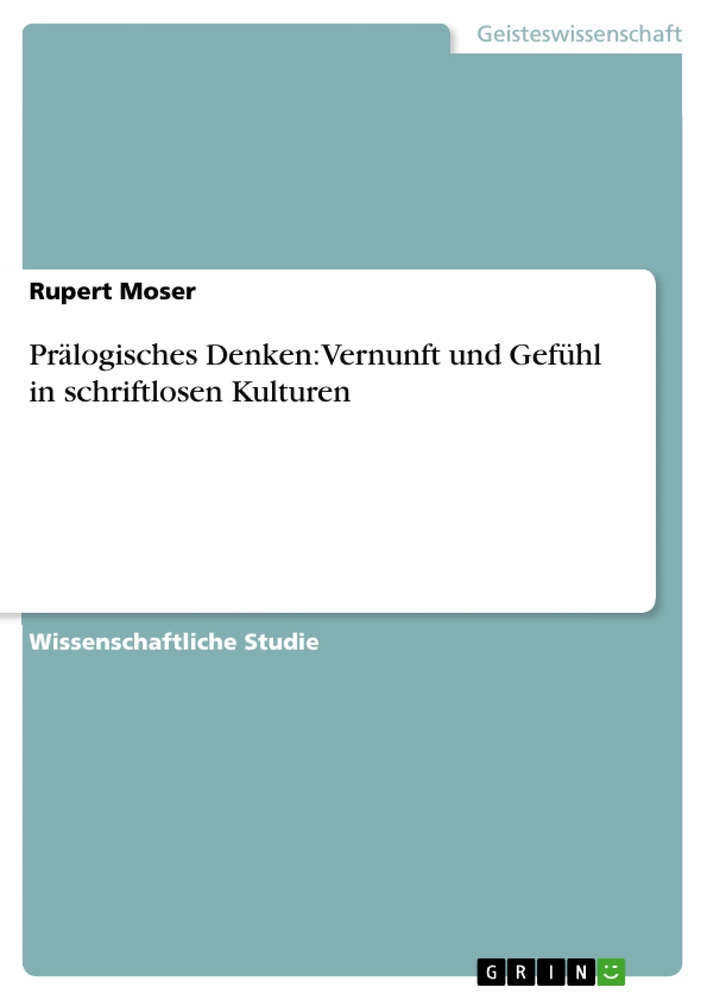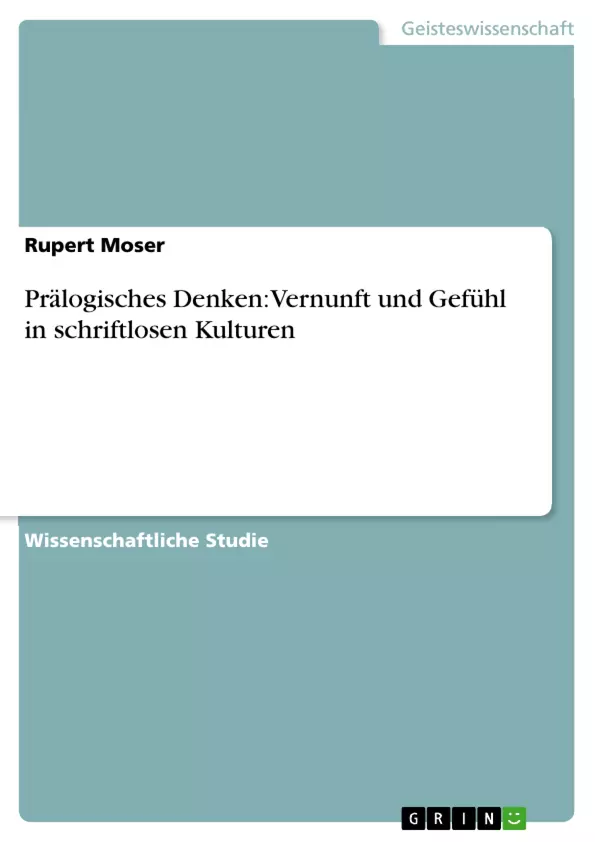1871 stellte Edward Tylor bei der Entwicklung des Begriffes "Animismus" in seinem Werk "Primitive Kultur" fest, dass der "primitive Mensch" sich frage, "what makes the difference between a living body and a dead one, what are those human beings which appear in dreams?" (I., p. 428) und in Beantwortung dieser Frage Seelenkonzeptionen entwickle. Aber nicht nur Seelen bewohtnen den Menschen, manchmal tun dies auch Geister. Und was sind Geister? "Spirits are simply personified causes" (II., p. 108). In seinem "Beitrag zu einer Studie über die kollektive Repräsentation des Todes" stellt Hertz 1905 fest, dass die Gemeinschaft den Tod eines ihrer Mitglieder nicht akzeptiere und
dass die mit dem Tode verbundenen Riten - kollektive Repräsentationen - nur ein Ausdruck der Trauer seien, dass der/die Verstorbene nun in der Welt der Toten lebe. "Kollektive Repräsentationen" werden zu einem der Schlüsselbegriffe in Lévy-Bruhls Werk "Die mentalen Funktionen in primitiven Gesellschaften" von 1910: (1) Sie werden von allen Mitgliedern einer Gemeinschaft geteilt. (2) Sie werden von Generation zu Generation weitergegeben. (3) Sie zwingen sich dem Individuum auf, indem sie in ihm Gefühle wecken wie Respekt, Furcht, Verehrung gegenüber ihrem Objekt. Sie besitzen somit Gemeinsamkeiten mit dem, was bei Durkheim als "soziale Fakten" bezeichnet wird. [...]
Inhaltsverzeichnis
- I Prälogisches Denken in Schriftlosen Kulturen
- II Medizinische Ethnologie und Ethnomedizin bei den Mwera
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Konzepte prälogischen Denkens in schriftlosen Kulturen und setzt diese in Beziehung zu modernen medizinischen und anthropologischen Perspektiven. Sie hinterfragt eurozentrische Vorurteile gegenüber nicht-westlichen Denkweisen.
- Prälogisches Denken vs. Logisches Denken
- Kollektive Repräsentationen und ihre Bedeutung
- Magisches Denken und seine Interpretation
- Ethnomedizin und die Integration von kausalen und finalen Ursachen
- Vergleichende Analyse von westlichen und nicht-westlichen Gesundheitsverständnissen
Zusammenfassung der Kapitel
I Prälogisches Denken in Schriftlosen Kulturen: Dieses Kapitel analysiert die historischen Konzepte von "prälogischem Denken" wie sie von Tylor, Lévy-Bruhl, Jaspers und anderen beschrieben wurden. Es beleuchtet die Verbindung von "kollektiven Repräsentationen," "mystischer Partizipation" und magischem Denken in verschiedenen Kulturen, unter anderem bei den Azande. Der Text untersucht kritisch, wie diese Konzepte zur Begründung von Vorurteilen gegenüber "primitiven" Kulturen verwendet wurden und diskutiert verschiedene Perspektiven auf die Interpretation von Ereignissen, die in westlichen Kontexten als "magisches Denken" kategorisiert werden könnten, beispielsweise durch die Einbeziehung von Intentionen neben natürlichen Ursachen. Der Text vergleicht die Ansätze von Bergson und Malinowski, die die Interpretation von Ereignissen als "prälogisch" hinterfragen.
II Medizinische Ethnologie und Ethnomedizin bei den Mwera: Dieses Kapitel veranschaulicht anhand des Beispiels der Mwera in Südtanzania, wie die Konzepte von Gesundheit und Krankheit kulturell geprägt sind und von den westlichen Auffassungen abweichen. Es wird gezeigt, dass die Mwera sowohl materielle als auch finale Ursachen von Krankheiten berücksichtigen. Der Text präsentiert ein Beispiel eines Mwera-Mannes mit einer Serie von Unfällen, die erst durch die Einbeziehung sowohl medizinischer als auch spiritueller Aspekte behoben werden konnte. Dies unterstreicht die Notwendigkeit eines ganzheitlichen Ansatzes in der Medizin, der sowohl körperliche als auch soziale und spirituelle Aspekte einbezieht, im Gegensatz zu einem rein biomedizinischen Modell. Die Integration von sozialpädagogischen Aspekten in die Heilung wird als ein wichtiger Bestandteil der ethnomedizinischen Praxis hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Prälogisches Denken, Kollektive Repräsentationen, Magisches Denken, Ethnomedizin, Mwera, Gesundheit, Krankheit, Kausalität, Finalität, Kulturvergleich, Ethnologie, Anthropologie.
Häufig gestellte Fragen zu: Prälogisches Denken in Schriftlosen Kulturen und Medizinische Ethnologie bei den Mwera
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Konzepte prälogischen Denkens in schriftlosen Kulturen und deren Beziehung zu modernen medizinischen und anthropologischen Perspektiven. Sie hinterfragt eurozentrische Vorurteile gegenüber nicht-westlichen Denkweisen und vergleicht westliche und nicht-westliche Gesundheitsverständnisse.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt prälogisches Denken im Vergleich zu logischem Denken, kollektive Repräsentationen, magisches Denken, Ethnomedizin (inklusive der Integration von kausalen und finalen Ursachen von Krankheiten), und bietet eine vergleichende Analyse von westlichen und nicht-westlichen Gesundheitsverständnissen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit besteht aus zwei Kapiteln: Kapitel I befasst sich mit prälogischem Denken in schriftlosen Kulturen und analysiert historische Konzepte von "prälogischem Denken" und deren kritische Anwendung auf "primitiven" Kulturen. Kapitel II untersucht die medizinische Ethnologie und Ethnomedizin bei den Mwera in Südtanzania, zeigt die kulturelle Prägung von Gesundheits- und Krankheitsvorstellungen und veranschaulicht einen ganzheitlichen Ansatz in der Medizin.
Wie wird "prälogisches Denken" in der Arbeit definiert und behandelt?
Die Arbeit analysiert die historischen Konzepte von "prälogischem Denken" wie sie von Tylor, Lévy-Bruhl, Jaspers und anderen beschrieben wurden. Sie untersucht kritisch, wie diese Konzepte zur Begründung von Vorurteilen gegenüber "primitiven" Kulturen verwendet wurden und diskutiert alternative Interpretationen von Ereignissen, die im westlichen Kontext als "magisches Denken" kategorisiert werden.
Welche Rolle spielt die Ethnomedizin in der Arbeit?
Das zweite Kapitel konzentriert sich auf die Ethnomedizin der Mwera. Es wird gezeigt, wie die Mwera sowohl materielle als auch finale Ursachen von Krankheiten berücksichtigen und wie ein ganzheitlicher Ansatz in der Medizin, der körperliche, soziale und spirituelle Aspekte einbezieht, im Gegensatz zu einem rein biomedizinischen Modell, notwendig ist.
Welche konkreten Beispiele werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit verwendet das Beispiel der Azande im Kapitel I zur Illustration von "kollektiven Repräsentationen" und "magischem Denken". Kapitel II verwendet das Beispiel eines Mwera-Mannes mit einer Serie von Unfällen, um die Bedeutung eines ganzheitlichen Ansatzes in der Medizin zu veranschaulichen.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit plädiert für eine kritische Auseinandersetzung mit eurozentrischen Vorurteilen gegenüber nicht-westlichen Denkweisen und betont die Notwendigkeit eines ganzheitlichen Ansatzes in der Medizin, der kulturelle und spirituelle Aspekte berücksichtigt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Prälogisches Denken, Kollektive Repräsentationen, Magisches Denken, Ethnomedizin, Mwera, Gesundheit, Krankheit, Kausalität, Finalität, Kulturvergleich, Ethnologie, Anthropologie.
- Quote paper
- Prof. Dr. mult. habil. Rupert Moser (Author), 1995, Prälogisches Denken: Vernunft und Gefühl in schriftlosen Kulturen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/71354