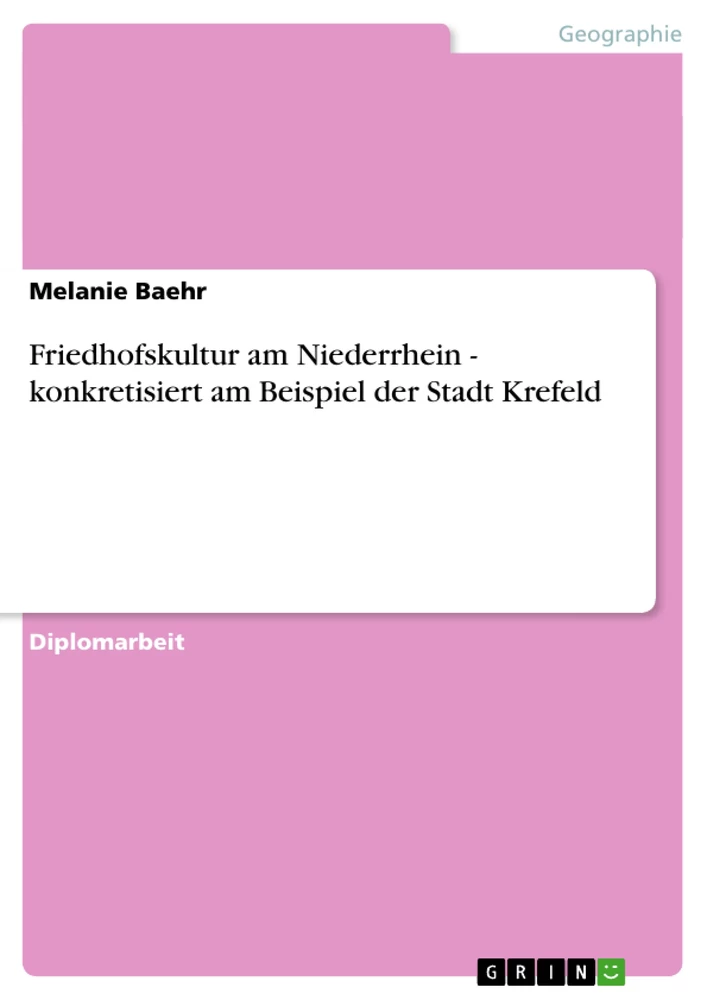Im Rahmen dieser Diplomarbeit wird einerseits die geschichtliche Entwicklung des Bestattungswesens am Niederrhein aufgezeigt mit besonderem Bezug auf die heute noch existierenden Friedhöfe Krefelds, die kurz dokumentiert werden, andererseits werden aktuelle Tendenzen und Trends in der Bestattungskultur dargestellt. Ziel ist es, für den Friedhof Fischeln mit Bezug auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft Lösungsansätze aufzuzeigen, wie ein zeitgemäßer Friedhof den verschiedenen unterschiedlichen Bedürfnissen einer modernen, multikulturellen Gesellschaft Rechnung tragen kann. Dabei wird die übergeordnete Frage stets lauten: Wie sollte eine würdevolle Bestattung heutzutage aussehen, und welche letzte Ruhestätte hilft den Hinterbliebenen am besten bei der Bewältigung ihrer Trauer?
Inhaltsverzeichnis
- Leben, Tod und Trauer
- Einleitung
- Friedhofskultur am Niederrhein
- Entwicklung der Friedhofskultur am Niederrhein und in der Stadt Krefeld
- Der Kirchhof und das Kirchengrab im Mittelalter
- Das Beerdigungsbrauchtum der Katholiken vom Mittelalter bis zum 18. Jahrhundert
- Der protestantische Kirchhof zu Beginn der Neuzeit
- Ästhetisch gestaltete Friedhöfe ab 1730 - Der Herrnhuter Gottesacker
- Wandlungen in der Sepulkralkultur zwischen 1750 und 1900
- Verschiedene Friedhofsformen ab dem 19. Jahrhundert
- Friedhofskultur heute & in Zukunft
- Derzeitige und zukünftige Entwicklungen der Friedhofskultur
- Tod und Trauer in der modernen Gesellschaft
- Heutige Möglichkeiten der Bestattung - Vom Wahlgrab zum Weltraum
- Der multikulturelle Friedhof - Trauerkultur in anderen Religionen
- Die Trauerkultur der Zukunft - Aktuelle Trends in Deutschland
- Bestattungen in anderen Ländern - Tendenzen in Europa
- Visionen für zukünftige Friedhöfe
- Krefelds Friedhöfe
- Dokumentation der Friedhöfe Krefelds
- Die einstigen Friedhöfe Krefelds
- Der Krefelder Hauptfriedhof
- Die Friedhöfe der Krefelder Vororte
- Friedhof Traar
- Friedhof Hüls
- Friedhof Elfrath
- Friedhof Uerdingen
- Friedhof Verberg
- Friedhof Bockum
- Friedhof Linn
- Friedhof Gellep-Stratum
- Friedhof Oppum
- Friedhof Fischeln
- Jüdische Friedhöfe in Krefeld
- Exkurs: Grabmäler am Niederrhein
- Die Analyse
- Allgemeine Fakten über Krefeld
- Der Friedhof Krefeld Fischeln
- Das Konzept
- Begründung des Gesamtkonzepts
- Konzept - Erweiterungsfläche
- Konzept - langfristig
- Der Entwurf
- Erläuterung des Gesamtentwurfs und der relevanten Teilbereiche
- Entwurf
- Zusammenfassung und Ausblick
- Quellen und Anhang
- Quellen- und Abbildungsverzeichnis
- Literaturverzeichnis
- Internet-Adressen
- Sendungen in Hörfunk und Fernsehen
- Bildnachweis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Friedhofskultur am Niederrhein und konzentriert sich speziell auf die Stadt Krefeld. Das Ziel ist es, die historische Entwicklung des Bestattungswesens aufzuzeigen, aktuelle Tendenzen und Trends in der Bestattungskultur darzustellen und schließlich Lösungsansätze für den Friedhof Fischeln zu entwickeln, die den Bedürfnissen einer modernen, multikulturellen Gesellschaft gerecht werden.
- Historische Entwicklung der Friedhofskultur am Niederrhein
- Aktuelle Bestattungsformen und Trends
- Integration unterschiedlicher Trauerkulturen
- Ökologische Aspekte der Friedhofsgestaltung
- Der Friedhof als Ort der Trauerarbeit und Begegnung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung der Friedhofskultur am Niederrhein, beginnend mit dem Mittelalter und der Bedeutung des Kirchhofs als Ort der Bestattung und des Gemeindelebens. Sie beschreibt das Bestattungsbrauchtum der Katholiken und Protestanten, den Einfluss der Aufklärung auf die Friedhofsgestaltung und die Entstehung von Kommunalfriedhöfen. Das Kapitel „Friedhofskultur heute & in Zukunft“ beschäftigt sich mit aktuellen Entwicklungen, wie der zunehmenden Anzahl an Feuerbestattungen, der Bedeutung des Trauerprozesses und der Bedeutung des Friedhofes als Ort der Erinnerung. Der multikulturelle Charakter der heutigen Gesellschaft wird im Hinblick auf die Integration von Trauerkulturen anderer Religionen, wie Islam, Judentum, Hinduismus und Buddhismus, beleuchtet. Die Arbeit beleuchtet verschiedene Bestattungsformen, wie Baumgräber, Friedwälder, Seebestattungen und die Verwendung der Asche in Medaillons oder Diamanten. Darüber hinaus werden aktuelle Trends, wie die anonyme Bestattung und das Online-Gedenken, diskutiert. Schließlich werden Visionen für zukünftige Friedhöfe entwickelt, die den Anforderungen einer sich wandelnden Gesellschaft, die gleichzeitig traditionelle Werte und neue Ideen berücksichtigen, gerecht werden. Die Arbeit wird abgerundet durch eine umfassende Dokumentation der Krefelder Friedhöfe, ihrer historischen Entwicklung und ihrer aktuellen Situation.
Schlüsselwörter
Friedhofskultur, Bestattungswesen, Trauerkultur, multikulturelle Gesellschaft, Religionen, Nachhaltigkeit, Biotope, Trauerarbeit, Kommunikation, Integration, Krefeld, Friedhof Fischeln.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat sich die Friedhofskultur am Niederrhein entwickelt?
Die Entwicklung reicht vom mittelalterlichen Kirchhof über den protestantischen Gottesacker bis hin zu den ästhetisch gestalteten Parkfriedhöfen des 19. Jahrhunderts.
Welche Bestattungstrends prägen die heutige Zeit?
Aktuelle Tendenzen sind die Zunahme von Feuerbestattungen, anonyme Bestattungen, Baumgräber in Friedwäldern sowie digitale Formen des Gedenkens (Online-Friedhöfe).
Was zeichnet einen multikulturellen Friedhof aus?
Ein zeitgemäßer Friedhof muss den unterschiedlichen Bestattungsriten verschiedener Religionen wie Islam, Judentum, Hinduismus und Buddhismus gerecht werden.
Welche Rolle spielt der Friedhof Krefeld-Fischeln in dieser Arbeit?
Der Friedhof Fischeln dient als Fallbeispiel, für das konkrete Lösungsansätze entwickelt wurden, um den Bedürfnissen einer modernen Gesellschaft Rechnung zu tragen.
Wie hilft die Friedhofsgestaltung bei der Trauerbewältigung?
Ein würdevoller Ort der Ruhe und Erinnerung unterstützt Hinterbliebene emotional bei der Bewältigung ihres Verlustes und fördert die Kommunikation.
Gibt es ökologische Aspekte bei der modernen Friedhofsplanung?
Ja, moderne Konzepte integrieren Nachhaltigkeit und den Erhalt von Biotopen in die Gestaltung der letzten Ruhestätten.
- Quote paper
- Diplom Ingenieur Melanie Baehr (Author), 2006, Friedhofskultur am Niederrhein - konkretisiert am Beispiel der Stadt Krefeld, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/71533