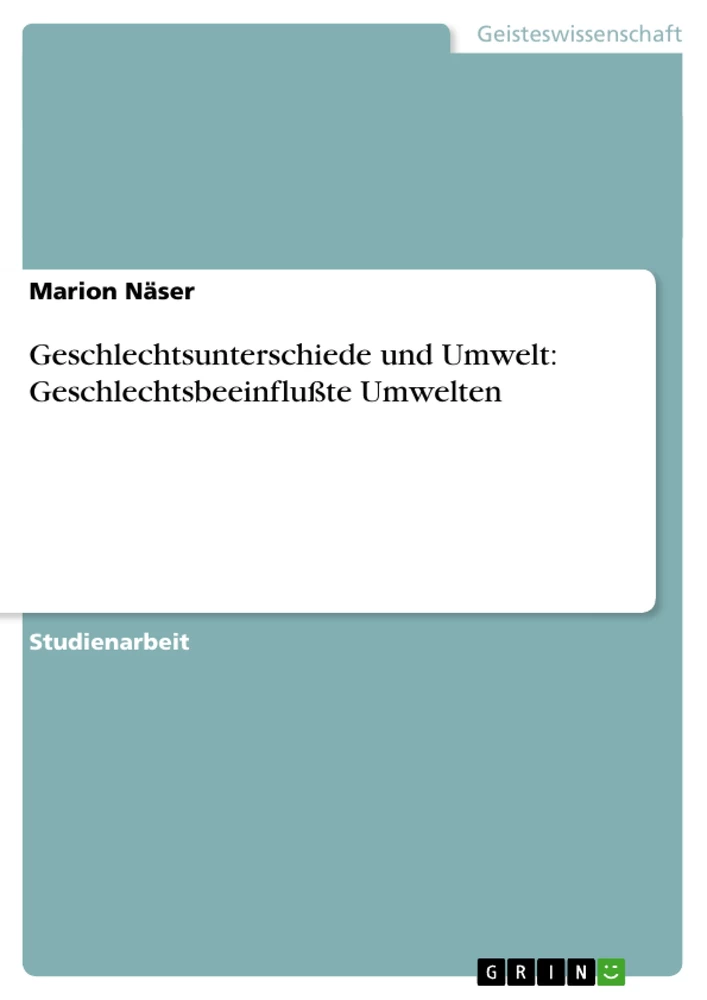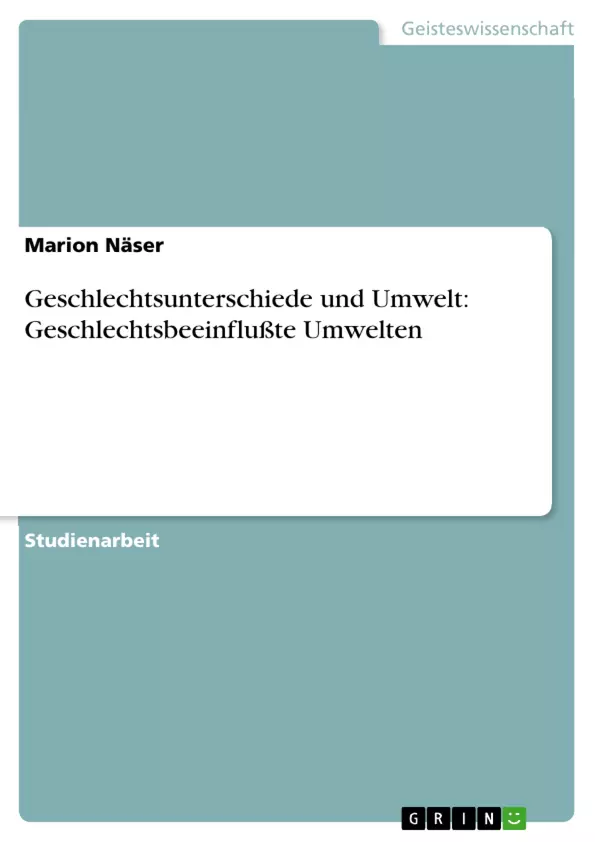Diese Untersuchung befaßt sich mit den Zusammenhängen zwischen der Fähigkeit zur mimischen Kommunikation von Emotionen und individuellen Unterschieden wie Persönlichkeitseigenschaften und Geschlechterunterschieden.
Die Methodik des Experimentes richtete sich nach dem Versuchsdesign von Buck (1972).
Emotionales Bildmaterial aus 7 Kategorien (z. B. Trauer, Ekel, Freude) wurde 32 jugendlichen Vpn (16 Männer, M, 16 Frauen, F) dargeboten. Die Vpn gaben auf einer Ratingskala Gefallen und Intensität der Empfindung beim Betrachten des jeweiligen Dias an. Per Videokamera wurde die Mimik der Vpn in einen anderen Raum übertragen, wo andere Vpn Gefallen und Empfindung des Senders sowie die Zugehörigkeit des jeweiligen Dias zu einer bestimmten Kategorie ebenfalls anhand einer Ratingskala beurteilen sollten.
Jede Vp fungierte im Rahmen des Versuches einmal als Sender und einmal als Empfänger. Es ergaben sich bei den zufällig zugeordneten Sender-Empfänger-Paaren vier Geschlechtskombinationen: FF, FM, MF und MM.
Die Vpn füllten im Rahmen des Versuches Persönlichkeitsfragebögen zu Empathie, Emotionaler Intensität, Extraversion, Neurotizismus und sozialer Erwünschtheit aus.
Signifikante Geschlechterunterschiede in der mimischen Kommunikation von Emotionen konnten nicht nachgewiesen werden, ebenso keine signifikanten Korrelationen zwischen den erhobenen Persönlichkeitseigenschaften und der Empfängergenauigkeit.
Hinsichtlich der betreffenden Persönlichkeitseigenschaften und der Sendergenauigkeit korrelierte das Übereinstimmungsmaß „Gefallen“ signifikant positiv mit emotionaler Intelligenz und das Übereinstimmungsmaß „Empfinden“ signifikant positiv mit emotionaler Intelligenz und negativ mit sozialer Erwünschtheit (SDS-CM).
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Das Elternhaus
- 1.1 Allgemeines
- 1.2 Indirektes Lernen von den Eltern
- 1.2.1 Geschlechtsstereotypen der Eltern
- 1.2.2 Interaktion der Eltern mit den Kindern
- 1.2.2.1 Spiel mit den Kindern
- 1.2.2.2 Gewalt gegen Kinder
- 1.2.2.3 Eltern von geschlechtsatypischen Kindern
- 1.3 Direktes Lernen von den Eltern: Rollenverteilung der Eltern
- 1.3.1 Hoher Anteil des Vaters an der Erziehung
- 1.3.2 Abwesenheit des Vaters
- 1.3.3 Berufstätigkeit der Mutter
- 1.4 Studie zum Einfluß des Elternhauses auf die Geschlechtsrollenorientierung
- 2. Interaktion mit Spielkameraden
- 2.1 Geschlechtertrennung - Warum Jungen und Mädchen nicht gerne miteinander spielen
- 2.2 Verstärkung geschlechtsspezifischen Verhaltens bei Spielkameraden
- 3. Die Arbeitswelt
- 3.1 Reaktion von Jungen und Mädchen auf Wettkampfsituationen
- 3.2 Aufgabenpräferenzen
- 3.3 Selbsteinschätzung, Leistungsvergleiche und Leistungsmotivation
- 3.4 Unterschiede in Beruf und Einkommen
- 4. Hintergründe und Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Referat befasst sich mit den Auswirkungen geschlechtsbeeinflußter Umwelten auf die Entwicklung von Geschlechtsunterschieden in Einstellungen und Verhalten. Es untersucht, wie die Erziehung innerhalb der Familie, die Interaktion mit Spielkameraden und die Arbeitswelt diese Unterschiede beeinflussen.
- Einfluss des Elternhauses auf die Entwicklung von Geschlechtsidentität, Geschlechtsstereotypen und Geschlechtsrollenidentität
- Bedeutung der Interaktion mit Spielkameraden für die Verstärkung geschlechtsspezifischen Verhaltens
- Reaktionen von Jungen und Mädchen auf Wettkampfsituationen und Unterschiede in Aufgabenpräferenzen
- Selbsteinschätzung, Leistungsvergleiche und Leistungsmotivation im Zusammenhang mit geschlechtsbeeinflußten Umwelten
- Unterschiede in Beruf und Einkommen als Ausdruck geschlechtsbeeinflußter Umwelten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Fokus des Referats auf die Auswirkungen geschlechtsbeeinflußter Umwelten auf Geschlechtsunterschiede in Einstellungen und Verhalten. Es werden die drei zentralen Bereiche Erziehung innerhalb der Familie, Interaktion mit Spielkameraden und Arbeitswelt als Untersuchungsgegenstand definiert.
Kapitel 1 befasst sich mit dem Einfluss des Elternhauses auf die Entwicklung von Geschlechtsidentität, Geschlechtsstereotypen und Geschlechtsrollenidentität. Es werden sowohl direkte als auch indirekte Lerntheorien diskutiert und die Bedeutung elterlicher Vorbilder sowie der Einfluss von Erziehungsmethoden auf die Entwicklung des Kindes beleuchtet.
Kapitel 2 untersucht die Interaktion mit Spielkameraden und die Rolle dieser Interaktion in der Verstärkung geschlechtsspezifischen Verhaltens. Es werden die Gründe für die Geschlechtertrennung beim Spielen und die Mechanismen der Vermittlung von geschlechtsspezifischen Verhaltensmustern durch Spielkameraden diskutiert.
Kapitel 3 beleuchtet die Auswirkungen der Arbeitswelt auf die Entwicklung von Geschlechtsunterschieden. Es analysiert die Reaktion von Jungen und Mädchen auf Wettkampfsituationen, Unterschiede in Aufgabenpräferenzen sowie die Rolle von Selbsteinschätzung, Leistungsvergleichen und Leistungsmotivation im Kontext der Arbeitswelt.
Schlüsselwörter
Geschlechtsunterschiede, Geschlechtsbeeinflußte Umwelten, Elternhaus, Spielkameraden, Arbeitswelt, Geschlechtsidentität, Geschlechtsstereotypen, Geschlechtsrollenidentität, Interaktion, Lernen, Erziehung, Wettkampfsituationen, Aufgabenpräferenzen, Selbsteinschätzung, Leistungsvergleiche, Leistungsmotivation, Beruf, Einkommen.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst das Elternhaus die Geschlechtsrollen?
Eltern vermitteln Geschlechtsidentität sowohl direkt durch Rollenverteilung als auch indirekt durch Interaktion, Spielzeugwahl und eigene Stereotypen.
Welchen Einfluss haben Spielkameraden auf geschlechtsspezifisches Verhalten?
Spielkameraden verstärken oft geschlechtstypisches Verhalten durch soziale Belohnung oder Ablehnung, was zur frühen Geschlechtertrennung beim Spielen führt.
Wie reagieren Jungen und Mädchen unterschiedlich auf Wettkampf?
Studien zeigen oft Unterschiede in der Leistungsmotivation und Selbsteinschätzung unter Wettbewerbsdruck, die teilweise durch Umweltfaktoren geprägt sind.
Was bedeutet "indirektes Lernen" von den Eltern?
Kinder beobachten das Verhalten und die Interaktionen ihrer Eltern und übernehmen unbewusst deren Einstellungen zu Geschlechtsrollen.
Gibt es Zusammenhänge zwischen Persönlichkeit und mimischer Kommunikation?
Untersuchungen zeigen, dass Übereinstimmung in der Kommunikation von Emotionen positiv mit emotionaler Intelligenz korrelieren kann.
- Quote paper
- M.A. Marion Näser (Author), 1999, Geschlechtsunterschiede und Umwelt: Geschlechtsbeeinflußte Umwelten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/7156