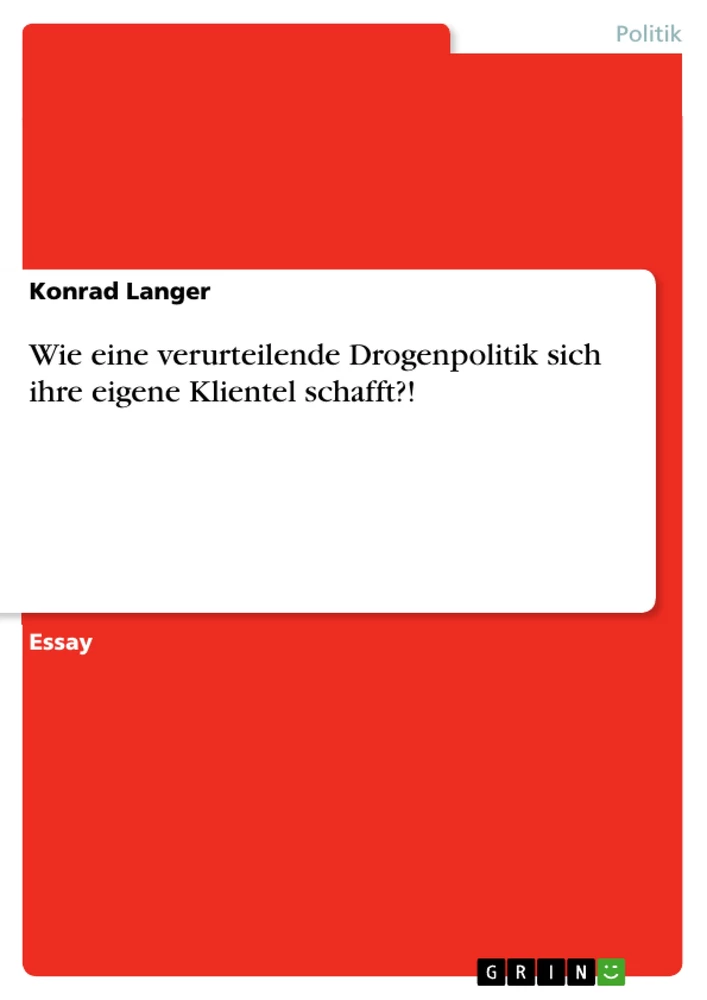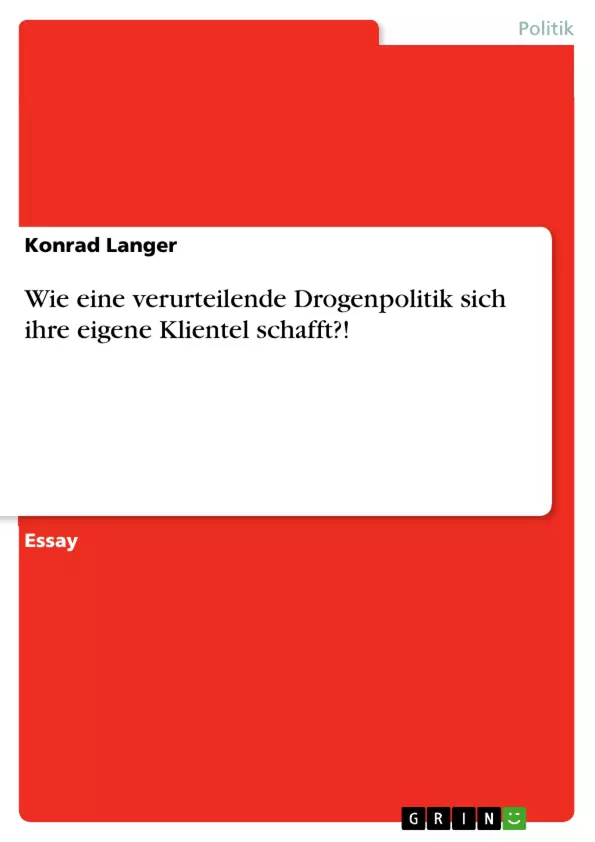Aus der Einleitung:
Immer dann, wenn erschreckende Berichte von Drogentoten oder Statistiken über Beschaffungskriminalität über die Medien in die Öffentlichkeit gelangen, wird der Ruf nach einem expressiv strafenden Umgang mit Drogen und Drogendelinquenten laut. Dieser Ruf erschallt nicht nur an Stammtischen, sondern auch aus Parteizentralen oder Akademikerkreisen. Der Ökonom und Nobelpreisträger Gary Becker forderte in den 1980er und 90er Jahren in Zeitungskolumnen härtere Strafen für Verbrechen, die auf Drogeneinfluss zurückzuführen sind. Gleichzeitig plädiert er aber für die generelle Legalisierung aller Drogen. Dies solle den erwünschten (d.h. kontrollierten und besteuerten) Gebrauch fördern und nebenbei - mithilfe einer Abschreckungswirkung der hohen Strafe - die Kriminalität senken. Abgesehen davon, dass eine solche Generalprävention zwar theoretisch sinnvoll erscheint, empirisch aber bisher keine Evidenz fand, zeigt sich ein weiteres Problem dieses Konzepts – die Delinquenten selbst - woher kommen sie und wohin werden sie nach ihrer Brandmarkung durch das Gesetz gehen? Eine Antwort auf diese Fragen bietet der sog. Labeling Approach (Etikettierungstheorie), welcher unter anderem auf den Ideen des Sozialwissenschaftlers Howard S. Becker beruht....
Inhaltsverzeichnis
- Etikettierungstheorie als Kritik am Strafen?
- Das Gegenteil von gut ist gut gemeint.
- Gibt es eine Gesellschaft ohne Schubladen?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay befasst sich mit der Etikettierungstheorie, die die Folgen der Anwendung von Strafen in Bezug auf ihre negativen individuellen und gesellschaftlichen Konsequenzen beleuchtet. Im Zentrum steht dabei das gestrafte Subjekt und seine Entwicklung in Interaktion mit Gesellschaft und Drogenpolitik.
- Kritik an der konventionellen Strafanwendung im Kontext von Drogenkonsum
- Analyse der Stigmatisierungsprozesse und deren Auswirkungen auf die Selbstwahrnehmung des Individuums
- Die Rolle gesellschaftlicher Normen und deren Konstruktion
- Die Bedeutung von Medien und deren Beitrag zur Stigmatisierung
- Die Frage nach der Möglichkeit einer Gesellschaft ohne Etikettierung
Zusammenfassung der Kapitel
Etikettierungstheorie als Kritik am Strafen?
Der Essay erläutert die grundlegenden Annahmen des Etikettierungsansatzes, der die Entstehung abweichenden Verhaltens nicht aus der Handlung selbst erklärt, sondern aus der Reaktion der Gesellschaft auf dieses Verhalten. Die Normsetzung und -anwendung werden als Prozesse betrachtet, die von Interessen geleitet sind und die Definition von Devianz beeinflussen.
Das Gegenteil von gut ist gut gemeint.
Anhand eines fiktiven Beispiels wird die „Drogenkarriere“ eines Schülers dargestellt, um die Dynamik des Etikettierungsprozesses zu veranschaulichen. Die Darstellung zeigt, wie gut gemeinte Maßnahmen der Eltern und Lehrer durch Stigmatisierung und Kontrolle zu einer Verfestigung des abweichenden Verhaltens führen können.
Gibt es eine Gesellschaft ohne Schubladen?
Der Essay befasst sich mit der Frage, wie man dem Prozess der Etikettierung und Stigmatisierung entgegenwirken kann. Es werden zwei theoretische Möglichkeiten vorgestellt, die aber in der Praxis kaum umsetzbar sind. Die Bedeutung von Medien für die Verbreitung von Vorurteilen und die Produktion von Stigmata wird hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Etikettierungstheorie, Devianz, Drogenpolitik, Stigmatisierung, gesellschaftliche Normen, Medien, Sozialisation, Kontrolle, Kriminalität
Häufig gestellte Fragen
Was besagt die Etikettierungstheorie (Labeling Approach)?
Die Theorie besagt, dass abweichendes Verhalten nicht primär durch die Tat selbst entsteht, sondern durch die Reaktion der Gesellschaft, die das Individuum als „kriminell“ oder „deviant“ etikettiert.
Wie beeinflusst eine Verurteilung die „Drogenkarriere“ eines Menschen?
Durch die Brandmarkung (Stigmatisierung) als Straftäter wird das Selbstbild des Betroffenen verändert. Dies kann dazu führen, dass er sich verstärkt in Subkulturen zurückzieht und das abweichende Verhalten festigt.
Welche Rolle spielen die Medien bei der Stigmatisierung von Drogennutzern?
Medien tragen oft zur Verbreitung von Vorurteilen bei, indem sie erschreckende Einzelfälle hervorheben. Dies verstärkt den gesellschaftlichen Ruf nach härteren Strafen und fördert die Ausgrenzung der Betroffenen.
Kritisiert die Etikettierungstheorie das herkömmliche Strafsystem?
Ja, sie zeigt auf, dass rein expressive Strafen oft kontraproduktiv sind, da sie die Wiedereingliederung erschweren und die Klientel für künftige Delinquenz erst „erschaffen“.
Wer ist Howard S. Becker?
Howard S. Becker ist ein US-amerikanischer Sozialwissenschaftler, auf dessen Ideen die Etikettierungstheorie maßgeblich beruht. Er untersuchte, wie soziale Gruppen Regeln aufstellen und wer als „Außenseiter“ definiert wird.
- Quote paper
- Konrad Langer (Author), 2007, Wie eine verurteilende Drogenpolitik sich ihre eigene Klientel schafft?!, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/71571