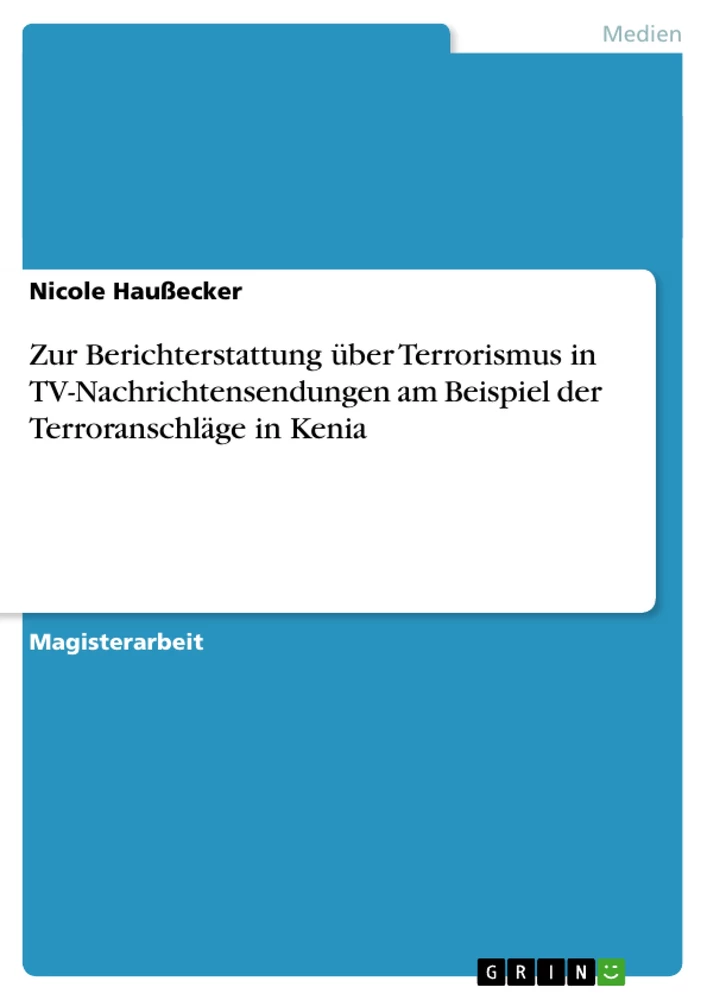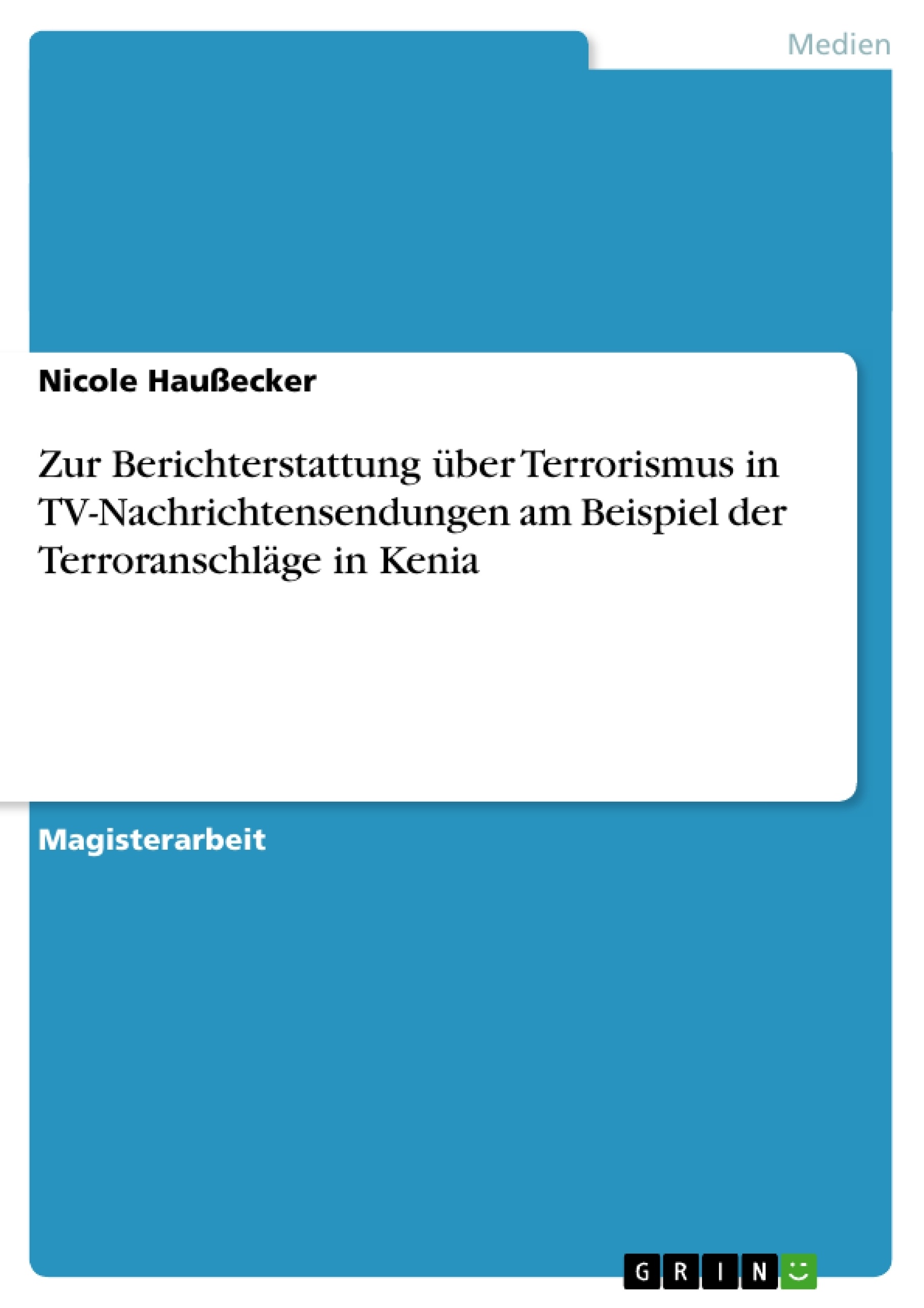Nach der starken Kritik der Medienberichterstattung über den 11.09.2001, werden in der vorliegenden Arbeit theoretische Hintergründe ausgewählter Kritikpunkte betrachtet und an einem weiteren terroristischen Ereignis, den Anschlägen in Kenia am 28.11.2002, inhaltsanalytisch untersucht. Dabei wird vorab die Rolle der Nachrichtenfaktoren für die Selektion und Intensität der Berichterstattung betrachtet. Von besonderem Interesse für die Hauptuntersuchung ist, inwieweit negative Stereotype und/oder Feindbilder bezüglich der islamischen und arabischen Welt sowie Emotionalisierungstendenzen in den Nachrichten vorliegen. Zudem wird das Zusammenspiel von Formen der Emotionalisierung und Stereotypisierungen diskutiert. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen erwartete Tendenzen, natürlich in geringerem Ausmaß als nach dem 11.09.2001. Der Nachrichtenwert des Ereignisses ist anfänglich sehr hoch, jedoch sinkt ab dem dritten Tag die Beachtung deutlich. Das Vorkommen emotionalisierender Mittel wird empirisch bestätigt. Nicht nur emotionale Sprache und Sprechweise, sondern vor allem Formen der expliziten Emotionalisierung sind vertreten. Damit wird die Vermutung bekräftigt, dass die Medien die, mit den terroristischen Ereignissen verbundene, beängstigende Stimmung aufgreifen. Ein direkter islamischer Feindbildaufbau ist zwar in der Berichterstattung nicht zu verzeichnen. Allerdings liegen latente negative Bewertungstendenzen sowie negative Stereotype bezüglich der arabischen und islamischen Welt vor. Eine meist narrativ inszenierte Fixierung auf Bin Laden und Al Qaida erfolgt oberflächlich und vernachlässigt kontextuelle Einordnungen. Trotz der kritischen Stimmen nach dem 11.09.2001 findet der geforderte Wandel in der Terrorismus-Berichterstattung nicht in gewünschtem Ausmaß statt, denn die damals bemängelten Aspekte, wie starke Emotionalisierung, geringe journalistische Reflexion und mangelnde kontextuelle Einordnungen sind weiterhin vorzufinden. Dies lässt sich auf Veränderungen der Nachrichtengebung aufgrund der Kommerzialisierung zurückführen, denn solche Muster sind nicht auf diskursive Verständigung aus, sondern um Marktanteile bemüht. Zudem zeigen weitere Studien, dass sich auch die Salienz von Terrorismus in den Nachrichten seit dem 11.09. verdoppelt hat und eine erhöhte Bedrohungswahrnehmung in der Bevölkerung nicht im Verhältnis zu den tatsächlich stattfindenden Ereignissen steht, so dass die Berichterstattung nach wie vor kritisch beobachtet werden muss.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Teil I: Theoretischer Teil
- Annäherung an das Phänomen Terrorismus
- Entwicklung und Bedeutung des Begriffs
- Definition des Begriffs Terrorismus
- Strukturen des islamistischen Terrorismus
- Stand der Forschung
- Studien und Sichtweisen in der Terrorismusforschung
- Diverse Ansätze und Entwicklungen
- Aktueller Forschungsstand
- Terrorismus und Kommunikation
- Terrorismus als Kommunikationsakt
- Typen der Kommunikation im Terrorismus
- Medien und Terrorismus - eine Symbiose?
- Studien und Sichtweisen in der Terrorismusforschung
- Zur Terrorismus-Berichterstattung
- Selektionskriterien der Nachrichtenproduktion
- Konzept der Nachrichtenfaktoren
- Nachrichtenwertigkeit terroristischer Ereignisse
- Kriterien zur emotionalen Wirkung
- Mittel der Emotionalisierung
- Theoretische Ansätze zum „Spiel“ mit Angst und Unsicherheit
- Stereotype, Vorurteile und Feindbilder
- Unterscheidung von Stereotypen und Vorurteilen
- Theoretische Grundlagen von Feindbildern
- Das Feindbild Islam
- Selektionskriterien der Nachrichtenproduktion
- Annäherung an das Phänomen Terrorismus
- Teil II: Empirische Ergebnisse
- Forschungsfragen und Hypothesen
- Methodisches Design
- Untersuchungsmethode: Inhaltsanalyse
- Auswahl des Untersuchungsmaterials
- Untersuchungsgegenstand
- Auswahl von Sendungen und Beiträgen
- Untersuchungszeitraum
- Untersuchungseinheiten
- Operationalisierung
- Kategoriensystem und Variablen
- Codierung
- Ergebnisse der Untersuchung
- Nachrichtenwert und formale Präsentation des Themas
- Einfluss der Nachrichtenfaktoren auf die Berichterstattung
- Zusammenfassung der Ergebnisse zur ersten Forschungsfrage
- Inhaltliche Präsentation: Einsatz von Emotionalisierung
- Explizite und implizite Emotionen
- Visualisierung von Emotionen
- Emotionalisierung in Sprache und Ton
- Darstellung der Unsicherheit und Gefahr
- Zusammenfassung der Ergebnisse zur zweiten Forschungsfrage
- Inhaltliche Präsentation: negative Stereotype und Feindbilder bezüglich der islamischen und arabischen Welt
- Genauigkeit der Darstellungen von islamistischen Terrorismus
- Feindbildmerkmale
- Auffälligkeiten in Sprache und Bildsprache
- Art der Schuldzuweisung
- Zusammenfassung der Ergebnisse zur dritten Forschungsfrage
- Nachrichtenwert und formale Präsentation des Themas
- Resümee und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die Berichterstattung über Terrorismus in TV-Nachrichtensendungen anhand des Beispiels der Terroranschläge in Kenia. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die mediale Konstruktion von Terrorismus in diesem Kontext zu analysieren.
- Die Bedeutung des Begriffs Terrorismus und seine Entwicklung
- Die Rolle der Medien in der Kommunikation von Terrorismus
- Die Anwendung von Nachrichtenfaktoren in der Berichterstattung über terroristische Ereignisse
- Der Einfluss von emotionalen Elementen auf die Berichterstattung
- Die Entstehung und Verwendung von Stereotypen und Feindbildern in der Berichterstattung über den Islam
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Definition von Terrorismus und einer Analyse der Strukturen des islamistischen Terrorismus. Anschließend wird der aktuelle Forschungsstand in der Terrorismusforschung beleuchtet, wobei ein Schwerpunkt auf den Studien und Sichtweisen zur Rolle der Kommunikation im Terrorismus liegt.
Im weiteren Verlauf der Arbeit werden die Selektionskriterien der Nachrichtenproduktion, insbesondere die Nachrichtenfaktoren, untersucht. Es wird außerdem der Einfluss von emotionalen Elementen auf die Berichterstattung analysiert. Die Arbeit beleuchtet die Verwendung von Stereotypen und Vorurteilen in der Berichterstattung über den Islam und untersucht, wie diese zur Konstruktion von Feindbildern beitragen.
Der empirische Teil der Arbeit beinhaltet eine Inhaltsanalyse von TV-Nachrichtensendungen, die sich mit den Terroranschlägen in Kenia befassen. Die Ergebnisse der Analyse zeigen, wie die Medien Terrorismus konstruieren und welche Einflüsse dabei eine Rolle spielen.
Schlüsselwörter
Terrorismus, Medien, Kommunikation, Nachrichtenfaktoren, Emotionalisierung, Stereotype, Feindbilder, Islam, Inhaltsanalyse, TV-Nachrichtensendungen, Kenia.
Häufig gestellte Fragen
Wie selektieren Medien Nachrichten über Terrorismus?
Die Selektion erfolgt nach Nachrichtenfaktoren wie Negativismus, Überraschung, räumliche Nähe und persönlicher Betroffenheit der Zielgruppe.
Welche Rolle spielt Emotionalisierung in der Berichterstattung?
Medien nutzen emotionale Sprache und Bilder, um Aufmerksamkeit zu generieren, was oft zu einer erhöhten Bedrohungswahrnehmung in der Bevölkerung führt.
Werden in TV-Nachrichten Stereotype über den Islam verbreitet?
Untersuchungen zeigen latente negative Stereotype und eine oft oberflächliche Fixierung auf Feindbilder wie Al Qaida, während kontextuelle Einordnungen vernachlässigt werden.
Was war das Besondere an der Berichterstattung über Kenia 2002?
Die Inhaltsanalyse zeigt, dass trotz Kritik nach dem 11. September weiterhin starke Emotionalisierung und mangelnde journalistische Reflexion vorherrschten.
Warum ist Terrorismus für Medien so "attraktiv"?
Terroristische Akte sind oft als Kommunikationsakte konzipiert, die durch ihren hohen Nachrichtenwert und ihre visuelle Wucht hohe Marktanteile versprechen.
- Arbeit zitieren
- M.A. Nicole Haußecker (Autor:in), 2003, Zur Berichterstattung über Terrorismus in TV-Nachrichtensendungen am Beispiel der Terroranschläge in Kenia, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/71580