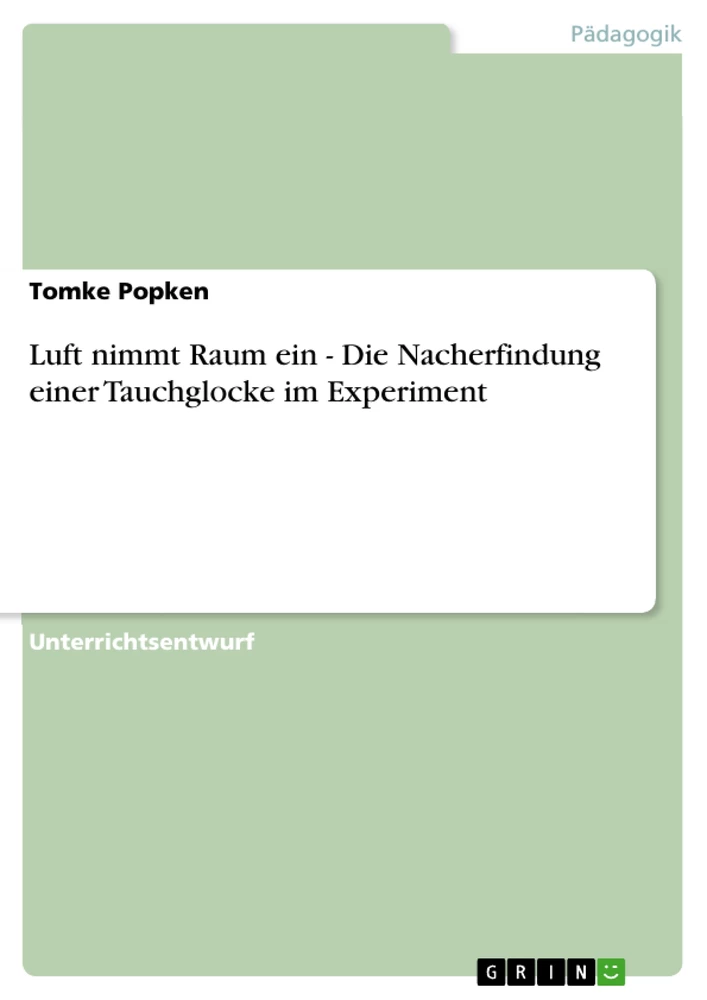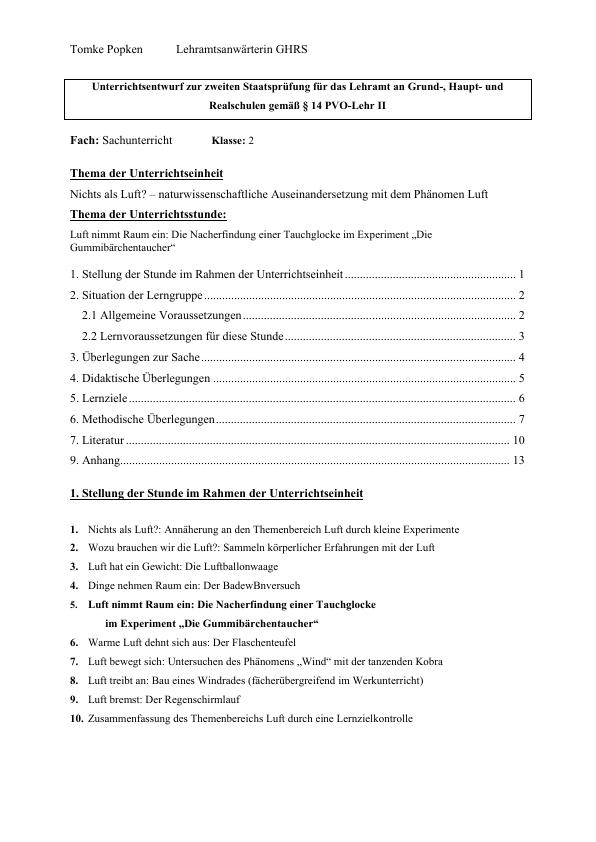Seit Dezember unterrichte ich die Klasse im Fach Sachunterricht mit drei Wochenstunden eigenverantwortlich. Die Lerngruppe setzt sich aus 22 Schülern1(11 Mädchen, 11 Jungen) im Alter von 8 bis 9 Jahren zusammen. A und B wurden aus den dritten Klassen zurück gestellt. A ist seit dem in der Klasse. B besucht seit Beginn des zweiten Schulhalbjahres die Klasse. Beide Kinder wurden freundlich aufgenommen und sind schon weitgehend in die Klassengemeinschaft integriert. Das Arbeitsverhalten der Lerngruppe lässt sich als interessiert und motiviert bezeichnen. Fast alle Schüler beteiligen sich gerne und rege am Unterrichtsgeschehen. In der Klasse herrscht im Allgemeinen ein angenehmes, freundliches Sozialklima. Auch mir gegenüber verhalten sie sich freundlich und aufgeschlossen.
Besonders leistungsstark im Fach Sachunterricht sind C, D, E, F, G und H. Alle sechs Kinder beteiligen sich mit qualitativ hochwertigen Beiträgen und bringen zum Teil erstaunliches Vorwissen mit. Als eher leistungsschwach sind I und B einzustufen. Beiden Schülerinnen fallen das selbstständige Erarbeiten von Inhalten oder Arbeitsaufträgen und das Kombinieren von Sachverhalten schwer. Darum erhalten sie oft differenzierte Arbeitsblätter mit zusätzlichen Beispielen oder Angaben. In Phasen, in denen Gruppenarbeit angesetzt ist, teile ich die Gruppen so ein, dass I und B Unterstützung von Seiten ihrer Mitschüler erhalten können, ohne sich auf den Leistungen der anderen Schüler auszuruhen. Insgesamt ist die Lerngruppe relativ unruhig, was auch auf die hohe Anzahl konzentrationsschwacher Schüler zurückzuführen ist. Der Unruhe begegne ich mit klar aufeinander aufbauenden Phasen, dabei lege ich ein besonderes Augenmerk auf einen motivierenden Einstieg und die Einhaltung der Rituale wie den Regenstab zur Beendigung der Arbeitsphase oder Symbolkarten zur Erinnerung an Melde-und Sprechregelungen.
An dieser Stelle möchte ich ausführlicher auf das Verhalten von J, K, E, F und L eingehen. J ist häufig unkonzentriert, stört den Unterricht durch Zwischenrufe und arbeitet langsam und oberflächlich. Meist gelingt es allerdings, ihn durch direkte Ansprache, klare Ansagen und Motivation wieder auf das Unterrichtsgeschehen zurückzuführen. Durch Elterngespräche und darauf folgende häusliche Übungsphasen gelingt es J derzeit immer besser, sein Arbeitstempo zu erhöhen und sich gezielt zu konzentrieren.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Stellung der Stunde im Rahmen der Unterrichtseinheit
- 2. Situation der Lerngruppe
- 2.1 Allgemeine Voraussetzungen
- 2.2 Lernvoraussetzungen für diese Stunde
- 3. Überlegungen zur Sache
- 4. Didaktische Überlegungen
- 5. Lernziele
- 6. Methodische Überlegungen
- 7. Literatur
- 9. Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Unterrichtsentwurf zielt darauf ab, das Phänomen Luft für Zweitklässler auf naturwissenschaftliche Weise erfahrbar und verständlich zu machen. Die Stunde „Luft nimmt Raum ein“ ist Teil einer umfassenderen Unterrichtseinheit zum Thema Luft. Die Schüler sollen durch Experimente und Beobachtungen ein tieferes Verständnis für die Eigenschaften von Luft entwickeln.
- Experimenteller Zugang zum Thema Luft
- Raumbeanspruchung von Luft
- Verknüpfung von Theorie und Praxis
- Förderung des naturwissenschaftlichen Denkens
- Differenzierte Lernangebote für unterschiedliche Leistungsniveaus
Zusammenfassung der Kapitel
1. Stellung der Stunde im Rahmen der Unterrichtseinheit: Dieses Kapitel beschreibt den Kontext der Unterrichtsstunde innerhalb der gesamten Einheit "Nichts als Luft?". Es skizziert den Ablauf der Einheit von der anfänglichen Annäherung an das Thema Luft über verschiedene Experimente bis hin zur abschließenden Lernzielkontrolle. Die Stunde "Luft nimmt Raum ein" wird als ein zentraler Bestandteil präsentiert, der das Verständnis der Schüler für die Raumbeanspruchung von Luft vertiefen soll. Die vorangehenden Experimente bereiten die Schüler auf die Komplexität des Gummibärchentaucher-Experiments vor.
2. Situation der Lerngruppe: Dieses Kapitel gibt einen detaillierten Überblick über die Zusammensetzung und die Besonderheiten der Lerngruppe. Es werden sowohl die Stärken als auch die Schwächen einzelner Schüler beschrieben, wobei ein Schwerpunkt auf den individuellen Bedürfnissen von Schülern mit Konzentrationsschwierigkeiten oder ADHS liegt. Die Beschreibung der Lerngruppe dient dazu, den methodischen Ansatz der Stunde zu rechtfertigen und die Notwendigkeit differenzierter Lernangebote zu unterstreichen. Die verschiedenen Strategien des Lehrers zur Bewältigung von Störfaktoren im Unterricht werden ebenfalls erläutert.
3. Überlegungen zur Sache: Dieser Abschnitt bietet einen wissenschaftlichen Hintergrund zum Thema Luft. Er erläutert die Zusammensetzung der Atmosphäre, die Eigenschaften von Luft (z.B. Dichte, Gewicht, Bewegung) und deren Bedeutung für Mensch, Tier und Pflanze. Besonders hervorgehoben wird die Tatsache, dass Luft, obwohl unsichtbar, Raum einnimmt und andere Stoffe verdrängen kann. Dieser wissenschaftliche Kontext liefert die Grundlage für das Verständnis des zentralen Experiments der Unterrichtsstunde.
4. Didaktische Überlegungen: In diesem Kapitel werden die didaktischen Entscheidungen des Lehrers bezüglich der Unterrichtsstunde begründet. Es wird auf die niedersächsischen Rahmenrichtlinien und den Perspektivrahmen Sachunterricht der GDSU Bezug genommen, um die Eignung des Themas für die zweite Klasse zu rechtfertigen. Die didaktische Reduktion der komplexen Thematik wird erläutert, und die bereits vorhandenen Vorkenntnisse der Schüler werden berücksichtigt. Die Entscheidung, das Thema bereits in der zweiten Klasse zu behandeln, wird durch die Leistungsfähigkeit der Lerngruppe und den didaktischen Ansatz des entdeckenden Lernens begründet.
Schlüsselwörter
Luft, Experimente, Sachunterricht, Zweite Klasse, Raum, Gummibärchentaucher, Naturwissenschaften, Lernziele, Didaktik, Differenzierung, Konzentration, ADHS.
Häufig gestellte Fragen zum Unterrichtsentwurf "Luft nimmt Raum ein"
Was ist der Inhalt des Unterrichtsentwurfs?
Der Unterrichtsentwurf beschreibt eine Unterrichtsstunde zum Thema Luft für die zweite Klasse. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel, und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf einem experimentellen Zugang zum Thema, insbesondere auf dem Nachweis, dass Luft Raum einnimmt.
Welche Kapitel umfasst der Entwurf?
Der Entwurf gliedert sich in die Kapitel: Stellung der Stunde im Rahmen der Unterrichtseinheit, Situation der Lerngruppe, Überlegungen zur Sache, Didaktische Überlegungen, Lernziele (explizit nicht im Beispieltext aufgeführt, aber impliziert), Methodische Überlegungen (ebenfalls implizit), Literatur (nicht im Beispieltext aufgeführt) und Anhang (nicht im Beispieltext aufgeführt).
Was ist das Hauptziel der Unterrichtsstunde?
Das Hauptziel ist es, den Zweitklässlern das Phänomen Luft auf naturwissenschaftliche Weise erfahrbar und verständlich zu machen. Die Schüler sollen durch Experimente (wie z.B. das Gummibärchentaucher-Experiment) ein Verständnis für die Raumbeanspruchung von Luft entwickeln.
Wie wird das Thema didaktisch umgesetzt?
Der Entwurf beschreibt einen experimentellen und handlungsorientierten Ansatz. Die didaktischen Überlegungen beziehen sich auf die niedersächsischen Rahmenrichtlinien und den Perspektivrahmen Sachunterricht der GDSU. Es wird auf die Berücksichtigung der Vorkenntnisse der Schüler und die Differenzierung für unterschiedliche Leistungsniveaus eingegangen, insbesondere für Schüler mit Konzentrationsschwierigkeiten oder ADHS. Der Ansatz des entdeckenden Lernens wird hervorgehoben.
Welche Aspekte der Lerngruppe werden berücksichtigt?
Der Entwurf berücksichtigt die Zusammensetzung und die individuellen Besonderheiten der Lerngruppe, inklusive der Stärken und Schwächen der einzelnen Schüler. Besondere Aufmerksamkeit wird den Bedürfnissen von Schülern mit Konzentrationsschwierigkeiten oder ADHS gewidmet, und es werden Strategien zur Bewältigung von Störfaktoren im Unterricht erläutert.
Welchen wissenschaftlichen Hintergrund bietet der Entwurf?
Der Entwurf erläutert die Zusammensetzung der Atmosphäre und die Eigenschaften von Luft (Dichte, Gewicht, Bewegung) und deren Bedeutung. Der Schwerpunkt liegt auf der Raumbeanspruchung von Luft und der Fähigkeit, andere Stoffe zu verdrängen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Entwurf?
Schlüsselwörter sind: Luft, Experimente, Sachunterricht, Zweite Klasse, Raum, Gummibärchentaucher, Naturwissenschaften, Lernziele, Didaktik, Differenzierung, Konzentration, ADHS.
Wie ist die Stunde in den Gesamtkontext der Unterrichtseinheit eingebunden?
Die Stunde "Luft nimmt Raum ein" ist Teil einer umfassenderen Unterrichtseinheit zum Thema Luft ("Nichts als Luft?"). Sie baut auf vorherigen Experimenten auf und bereitet auf spätere Lerninhalte vor. Die Stunde dient dem vertieften Verständnis der Raumbeanspruchung von Luft.
- Citation du texte
- Tomke Popken (Auteur), 2005, Luft nimmt Raum ein - Die Nacherfindung einer Tauchglocke im Experiment, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/71648