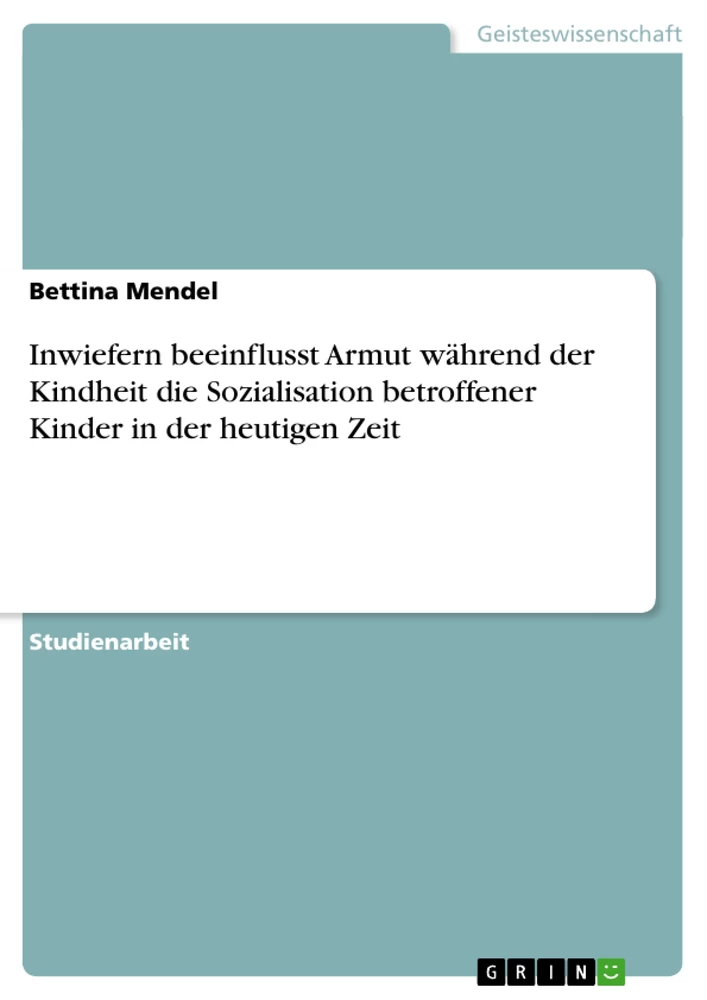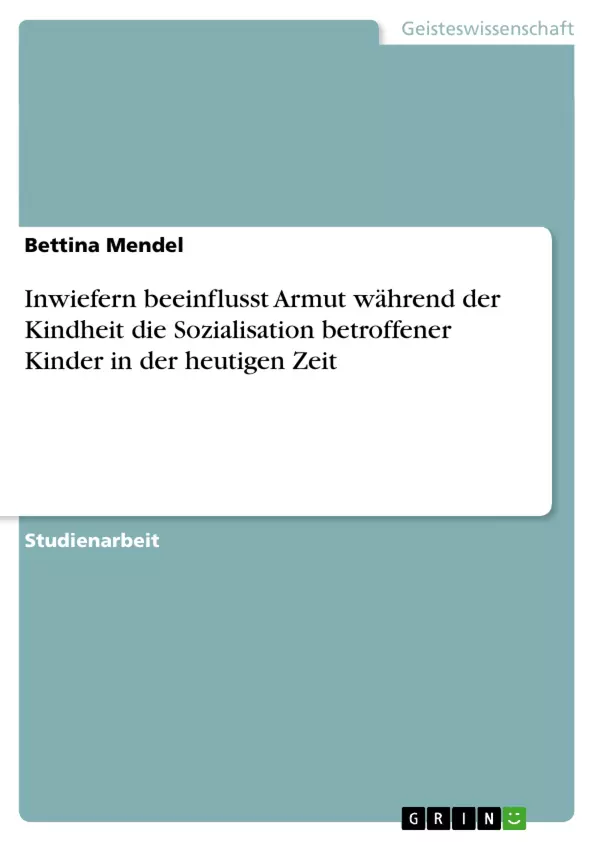“Despite half a century of considerable economic growth and large increases in per capita income, child poverty is still prevalent in the world’s most advanced countries. […] While there are more than a million children in Germany depending on social transfer benefit payments (BMA 2001), little is known about child poverty and its dynamics. There is a growing literature dealing with poverty among the German population at large, […] but only a few studies specifically addressing children.” Dieses Zitat, welches aus einer Anfang März 2006 veröffentlichten Studie der UNICEF stammt, macht deutlich, welch defizitäre Umstände momentan in der Bundesrepublik Deutschland herrschen, und dies nicht nur bezogen auf die allgemeine Armutslage. Es ist kennzeichnend für eine typische Haltung der heutigen Gesellschaft, die dazu neigt, Randthemen zu verdrängen oder sie erst gar nicht als thematisierenswert anzusehen. Zwar werden häufig offen ersichtliche Problemlagen mit den zur Verfügung stehenden (vorwiegend materiellen) Mitteln bekämpft; allerdings wird dabei leicht übersehen, dass diese meist nur die Auswirkungen ursprünglicher Probleme darstellen. Der Fall der stetig wachsenden Kinderarmut stellt ein aktuelles Beispiel dar. Wie bereits im Zitat aufgegriffen, werden in Deutschland viel Geld und Interessen in das immer brisanter werdende Thema Armut investiert - nicht zuletzt aufgrund der letzten Gesetzesänderung in bezug auf das SGB (Hartz IV). Das scheinbar neue Problem der Kinderarmut im Speziellen rückt stark in den Hintergrund: „’Kindheit in Deutschland’, sagte noch 1998 die damalige Bundesfamilienministerin Claudia Nolte (CDU), ’ist eine gute Kindheit.’ Ihr Parteikollege Friedrich Bohl hielt es gar für unverantwortlich, überhaupt von Kinderarmut in Deutschland zu sprechen.“ 2 Es wird nicht ausreichend genug beachtet, um nicht zu sagen vernachlässigt, was die Ergebnisse der UNICEF-Studie eindrücklich belegen. Nach ihr hat sich die Zahl der Kinder in Deutschland, die in Armut leben müssen, seit 1990 verdoppelt, und auch die Zukunftsprognosen sagen einen rasanten Anstieg voraus. Wie aus der folgenden Grafik deutlich wird, beziehen Kinder in der sogenannten mittleren Kindheit am häufigsten Sozialhilfe, weshalb sich die folgende Arbeit vorwiegend auf diese Altersphase (das Grundschulalter und darüber hinausgehend bis 14 Jahre) bezieht. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsbestimmungen
- Verschiedene Konzepte der Armut
- Der Ressourcen-Ansatz (monetäre Dimension)
- Der Lebenslagen-Ansatz (nicht-monetäre Dimension)
- Kindheit in ihrem heutigen Kontext
- Subjekt- bzw. lebensweltorientierte Kinderforschung
- Sozialisationsinstanzen und psychosoziales Befinden
- Kindliche Benachteiligung – die Ursachen
- Lebenslagen und Risikofaktoren
- Altersspezifische Entwicklungsaufgaben
- Strukturen kindlicher Benachteiligung
- Benachteiligung und Kompensation
- Stark- und Mehrfachbenachteiligungen
- Kindliche Sozialisation – die Auswirkungen
- Sozialisatorische Grundlagen
- Direkte Auswirkungen und psychosoziale Folgen
- Kindliche Bewältigung – die Strategien
- Anforderungen an den Umgang
- Auf Bewältigung zielende Strategien
- Elterliche Strategien: reduktiv, adaptiv, konstruktiv
- Substrategien
- Problembezogene Bewältigungsmuster
- Schutzfaktoren
- Schluss
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit befasst sich mit dem Thema der Kinderarmut in Deutschland und analysiert, inwieweit Armut während der Kindheit die Sozialisation betroffener Kinder in der heutigen Zeit beeinflusst. Sie untersucht die defizitären Lebenslagen von Kindern in Armut, die Auswirkungen und Risiken, sowie die daraus entstehenden Sozialisationsprobleme. Darüber hinaus werden kindliche Bewältigungsstrategien und Schutzfaktoren im Kontext der Armutssituation beleuchtet.
- Begriffliche Klärung von Armut und ihre unterschiedlichen Dimensionen
- Analyse der Auswirkungen von Armut auf die Sozialisation von Kindern
- Untersuchung von kindlichen Bewältigungsstrategien im Umgang mit Armut
- Identifizierung von Schutzfaktoren, die den negativen Folgen von Armut entgegenwirken können
- Diskussion von Handlungsmöglichkeiten für die Soziale Arbeit im Kontext der Kinderarmut
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung der Arbeit verdeutlicht die Relevanz des Themas Kinderarmut und stellt die Problemstellung in den Kontext aktueller gesellschaftlicher Diskurse. Es wird deutlich, dass das Thema Kinderarmut in Deutschland häufig vernachlässigt wird, obwohl es sich um ein wachsendes Problem handelt. Die Arbeit konzentriert sich dabei auf die Auswirkungen der Armut auf die Sozialisation betroffener Kinder im Grundschulalter und darüber hinaus.
Das Kapitel „Begriffsbestimmungen“ befasst sich mit verschiedenen Konzepten von Armut. Es werden der Ressourcen-Ansatz, der Lebenslagen-Ansatz und die Unterscheidung zwischen absoluter und relativer Armut erläutert. Außerdem wird der aktuelle Kontext der Kindheit in Deutschland beleuchtet, inklusive der Bedeutung von lebensweltorientierter Kinderforschung und der verschiedenen Sozialisationsinstanzen, die auf das psychosoziale Befinden von Kindern Einfluss nehmen.
Im Kapitel „Kindliche Benachteiligung – die Ursachen“ werden Lebenslagen und Risikofaktoren beleuchtet, die Kinder in Deutschland benachteiligen. Außerdem werden alterspezifische Entwicklungsaufgaben und die Strukturen kindlicher Benachteiligung analysiert. Die Themen Benachteiligung und Kompensation sowie Stark- und Mehrfachbenachteiligungen werden dabei besonders beleuchtet.
Schlüsselwörter
Kinderarmut, Sozialisation, Lebenslagen, Risikofaktoren, Benachteiligung, Kompensation, Bewältigungsstrategien, Schutzfaktoren, Soziale Arbeit
Häufig gestellte Fragen
Wie wirkt sich Kinderarmut auf die Sozialisation aus?
Armut führt oft zu defizitären Lebenslagen, die das psychosoziale Befinden, die Bildungschancen und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben einschränken.
Was ist der Unterschied zwischen dem Ressourcen- und dem Lebenslagen-Ansatz?
Der Ressourcen-Ansatz misst Armut rein monetär (Einkommen). Der Lebenslagen-Ansatz berücksichtigt auch nicht-monetäre Faktoren wie Wohnsituation, Gesundheit und soziale Kontakte.
Welche Altersgruppe ist in Deutschland besonders von Armut betroffen?
Studien zeigen, dass Kinder in der "mittleren Kindheit" (Grundschulalter bis ca. 14 Jahre) am häufigsten auf Sozialleistungen angewiesen sind.
Welche Bewältigungsstrategien entwickeln arme Familien?
Es gibt reduktive (Einschränkung), adaptive (Anpassung) und konstruktive Strategien, mit denen Eltern und Kinder versuchen, die Folgen der Armut zu kompensieren.
Was sind Schutzfaktoren gegen die negativen Folgen von Armut?
Wichtige Schutzfaktoren sind ein stabiles soziales Umfeld, individuelle Resilienz der Kinder und unterstützende Angebote der Sozialen Arbeit.
- Quote paper
- Bettina Mendel (Author), 2006, Inwiefern beeinflusst Armut während der Kindheit die Sozialisation betroffener Kinder in der heutigen Zeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/71702