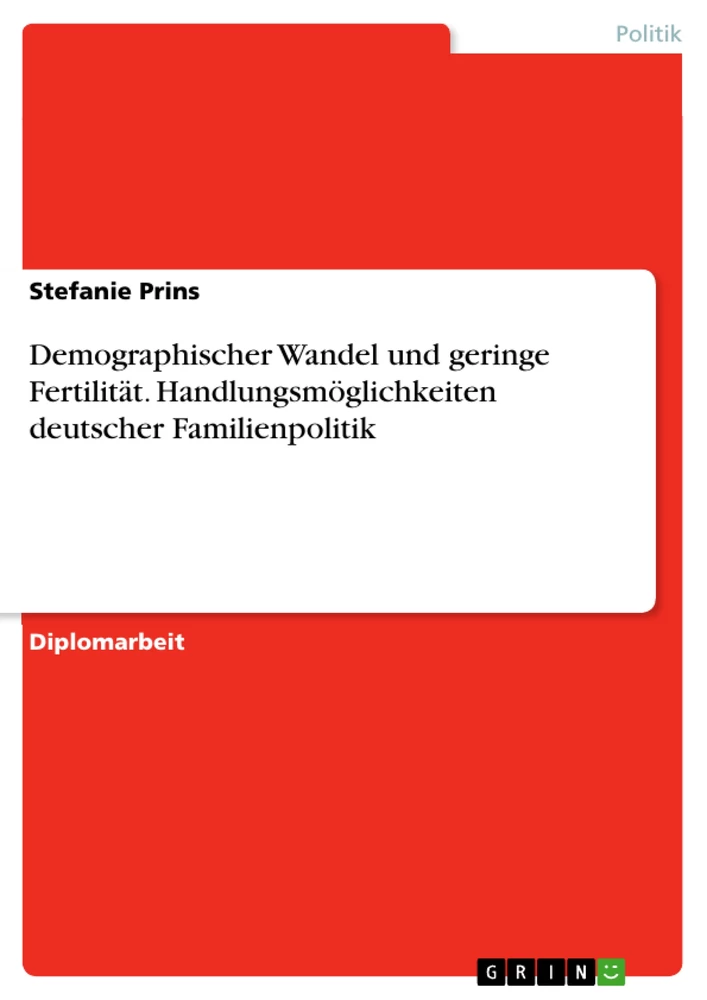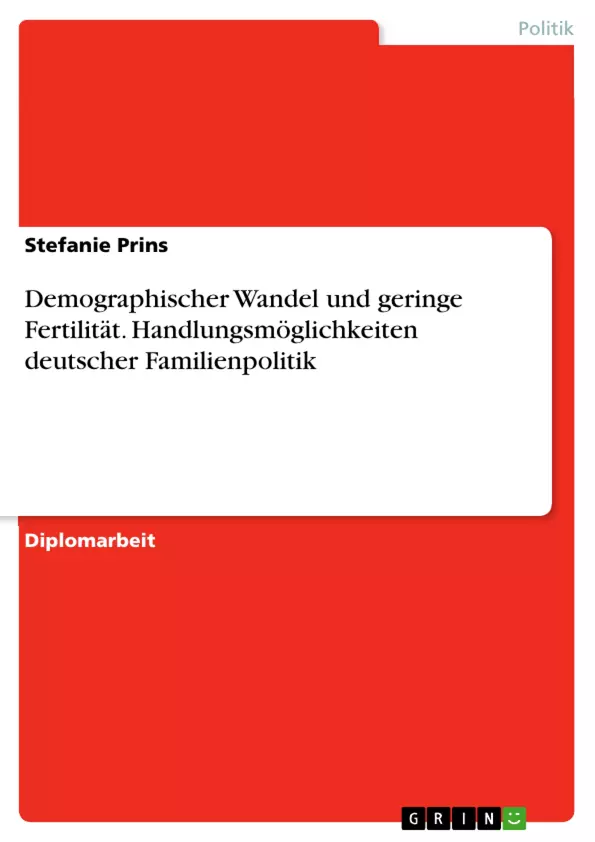In Deutschland, so wie in anderen europäischen Staaten, gibt es immer weniger Kinder. Aufgrund dieser Beobachtung ist in den Medien sogar gelegentlich vom „Aussterben der Deutschen“ zu lesen. Ob diese provokante Aussage zutrifft, mag dahin gestellt sein. Tatsache ist aber, dass die Fertilitätsraten seit den 1970er Jahren, zumindest in Westdeutschland, immer niedriger geworden sind. Ich untersuche in dieser Arbeit daher den demographischen Wandel mit seinen Folgen und Ursachen und wie die Familienpolitiker in Deutschland damit umgehen sollten. Wie im Titel der Arbeit angesprochen, werde ich dabei versuchen, Handlungsempfehlungen für die deutschen Familienpolitiker aufzustellen.
Es werden folgende Forschungsfragen untersucht:
1.Warum sind die deutschen Geburtenraten so niedrig?
2. Wie ist es möglich, diese wieder zu erhöhen?
Auch mit umfassenden Reformen innerhalb der Familienpolitik kann eine Erhöhung der Geburten nur mit gesellschaftlicher Akzeptanz der Maßnahmen erreicht werden. Das heißt, dass es trotz umfassender, staatlicher Maßnahmen möglich ist, keine nennenswerten Effekte auf die Geburtenraten zu erhalten. Dies ist dann der Fall, wenn die den Maßnahmen zugrunde liegenden Werte und Normen in der Bevölkerung nicht oder erst nach langer Gewöhnungsphase angenommen werden. Ein Beispiel soll dies verdeutlichen: Die Vätermonate bei der Elternzeit sollen dafür sorgen, dass mehr Väter die Erziehungsverantwortung übernehmen als es bis zum jetzigen Zeitpunkt der Fall ist. Ob mit Einführung des Elterngeldes die Väter in verstärktem Maße dazu gebracht werden das Angebot der Elternzeit anzunehmen, wird auch davon abhängig sein wie ein Hausmann gesellschaftlich akzeptiert wird. Werden Elternzeit nehmende Männer als „Pantoffelhelden“ abgestempelt oder dafür bewundert, dass sie den Beruf unterbrechen, um sich ihrem Nachwuchs zu widmen? Zum Zeitpunkt der Arbeit kann darüber noch keine Aussage gemacht werden, weil gesellschaftliche Normen und Veränderungen einen langen Prozess durchmachen, um sich in der Gesellschaft zu verfestigen. Es wird aber die Frage beantwortet, wie bestehende gesellschaftliche Normen und Werte auch die Fertilitäten eines Landes beeinflussen können. Dies wird besonders an einem internationalen Vergleich zwischen Frankreich, Schweden, Italien und Deutschland deutlich.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Teil 1 Demographie
- Kapitel 1 Demographische Situation
- 1.1 Definition Demographie
- 1.2 Demographische Daten
- 1.3 Internationaler Vergleich
- 1.4 Effekte des demographischen Wandels
- Kapitel 2 Auswirkungen
- 2.1.1 Auswirkungen auf die gesetzliche Krankenversicherung (GKV)
- 2.1.2 Auswirkungen auf die gesetzliche Rentenversicherung (GRV)
- 2.1.3 Auswirkungen auf die gesetzliche Pflegeversicherung (GPV)
- 2.2 Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und die Wirtschaft
- 2.3 Auswirkungen auf die Kommunen
- Kapitel 1 Demographische Situation
- Zwischenfazit 1
- Teil 2 Forschungsfrage 1: Wieso sind die deutschen Geburtenraten so niedrig?
- Kapitel 3 Gründe für geringe Fertilitäten
- 3.1 Sozialer Wandel
- 3.2 Wirtschaft
- 3.3 Schlechte Kinderbetreuungsmöglichkeiten
- 3.4 Kinder als öffentliches Gut durch Einführung der GRV
- 3.5 ,,Hotel Mama"
- 3.6 Mehrdimensionale Kontextgebundenheit und Wunschbiographie
- Kapitel 3 Gründe für geringe Fertilitäten
- Zwischenfazit 2
- Teil 3 Forschungsfrage 2: Wie können die Geburtenraten wieder erhöht werden?
- Kapitel 4 Definitionen
- 4.1 Definition von Familie
- 4.2 Definition von Politik
- 4.3 Definition von Familienpolitik
- Kapitel 5 Notwendigkeit, Aufgaben und Ziele von Familienpolitik
- Kapitel 6 Maßnahmendarstellung
- 6.1 Normen des Ehe-, Familien-, Jugend- und Mutterschutzrechts
- 6.2 Familienlastenausgleich (FLA), Familienleistungsausgleich
- 6.2.1 Steuerliche Absetzbarkeit
- 6.2.2 Kindergeld
- 6.2.3 Kinderzuschlag
- 6.3 Erziehungsgeld
- 6.4 Erziehungsurlaub/ Elternzeit
- 6.5 Erziehungsjahre
- 6.6 Bereich sozialer Sicherung
- 6.6.1 Hinterbliebenenrente
- 6.6.2 Familienleistungen im Rahmen der GKV
- 6.7 Bereich Wohnen
- 6.7.1 Wohngeld
- 6.7.2 Eigenheimzulage
- 6.7.3 Kinderzuschuss bei der Eigenheimzulage
- 6.7.4 Bausparförderung/Wohnungsbauprämiengesetz
- 6.7.5 Soziale Wohnraumförderung
- 6.8 Bereich Erziehungshilfen, Ausbildungsförderung
- 6.8.1 Erziehungshilfen
- 6.8.2 Ausbildungsförderung
- 6.9 Sonstiges
- 6.9.1 Das Unterhaltvorschussgesetz
- 6.9.2 Preis- und Tarifermäßigung
- 6.9.3 Förderung der Familienerholung
- 6.10 Zusammenfassung der Maßnahmen
- Kapitel 7 Akteure und Kompetenzen der Familienpolitik
- 7.1 Bund, Länder und Kommunen als öffentliche Träger
- 7.1.1 Kommunen
- 7.1.2 Länder
- 7.1.3 Bund
- 7.2 Nichtöffentliche Träger
- 7.1 Bund, Länder und Kommunen als öffentliche Träger
- Kapitel 8 Bundesdeutsche Familienpolitik in der Chronologie
- 8.1 Ära Wuermeling
- 8.2 Familienminister Heck- leichtes Umdenken
- 8.3 Familienpolitik in der sozial- liberalen Koalition
- 8.4 Christlich-liberale Familienpolitik
- 8.5 Rückblick auf 50 Jahre Familienpolitik
- Kapitel 9 Evaluation der Reichweite der Maßnahmen- die Problematik der Familienpolitik
- 9.1 Das familiale Handlungsumfeld als Entscheidungsindikator
- 9.2 Mangelndes Zusammenwirken von Ziel, Maßnahme und Wirkung
- 9.3 Föderalismus als Reformbremse
- 9.4 Evaluation der Maßnahmen im Hinblick auf Geburtensteigerung
- 9.4.1 Bereich der Rechtsnormen
- 9.4.2 Leistungen des FLAs
- 9.4.3 Maßnahmenpaket Erziehungsgeld, Erziehungsurlaub und Erziehungsjahre
- 9.4.4 Bereich der sozialen Sicherung
- 9.4.5 Bereich Wohnen
- 9.4.6 Bereich Erziehungshilfen/ Ausbildungsförderung
- 9.4.7 Bereich Sonstiges
- Kapitel 10 Familienpolitik und ihre Leistungen im europäischen Vergleich
- 10.1 Kindergeld
- 10.2 Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub
- 10.3 Ehe- und/oder familienbezogene Besteuerung
- 10.4 Kinderbetreuung und Frauenerwerbstätigkeit
- Kapitel 11 Schweden, Frankreich und Italien im Blickpunkt
- 11.1 Schweden- die Leidenschaft zur Gleichstellung
- 11.2 Frankreich- der Blick auf Kinder
- 11.3 Italien- ein Blick in den Spiegel
- 11.4 Vergleich
- 11.5 Zusammenfassung
- Kapitel 12 Reformvorschläge
- 12.1 Hohe finanzielle Unterstützung bei Erwerbsunterbrechung
- 12.2 Ausbau der Kinderbetreuung
- 12.3 Qualitätskontrollen
- 12.4 Einbindung der Kinderbetreuung in den Bildungszweig
- 12.5 Einführung einer Familienkasse
- Kapitel 13 Erörterung der Forschungsfragen
- Kapitel 4 Definitionen
- Demographischer Wandel in Deutschland und seine Folgen
- Gründe für geringe Fertilitäten in Deutschland
- Ziele und Aufgaben der deutschen Familienpolitik
- Maßnahmen der deutschen Familienpolitik zur Steigerung der Geburtenrate
- Evaluation der Effektivität der Familienpolitik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit dem demographischen Wandel am Beispiel geringer Fertilitäten in Deutschland und analysiert Handlungsmöglichkeiten der deutschen Familienpolitik. Ziel der Arbeit ist es, die Ursachen für die niedrigen Geburtenraten in Deutschland zu untersuchen und zu erörtern, wie die Familienpolitik die Geburtenrate wieder erhöhen kann.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den demographischen Wandel in Deutschland einführt und die Forschungsfragen der Arbeit definiert. In Teil 1 werden die demographische Situation in Deutschland und die Auswirkungen des demographischen Wandels auf verschiedene gesellschaftliche Bereiche beleuchtet. Teil 2 analysiert die Ursachen für die niedrigen Geburtenraten in Deutschland. Teil 3 beschäftigt sich mit der Familienpolitik in Deutschland und untersucht deren Maßnahmen und deren Effektivität. Die Arbeit endet mit einem Fazit, das die wichtigsten Ergebnisse zusammenfasst und Empfehlungen für die Zukunft der deutschen Familienpolitik formuliert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Demographischer Wandel, Fertilität, Familienpolitik, Geburtenraten, Familienlastenausgleich, Erziehungsgeld, Erziehungsurlaub, Kinderbetreuung, Deutschland, Europa.
Häufig gestellte Fragen
Warum sinken die Geburtenraten in Deutschland seit den 1970er Jahren?
Gründe sind unter anderem der soziale Wandel, veränderte Rollenbilder, wirtschaftliche Unsicherheiten, mangelnde Kinderbetreuungsmöglichkeiten und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
Welche Auswirkungen hat der demographische Wandel auf die Sozialversicherungen?
Der Wandel belastet die Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung, da immer weniger Beitragszahler für immer mehr Leistungsempfänger aufkommen müssen.
Was ist das Ziel der deutschen Familienpolitik?
Ziel ist es, Familien finanziell zu entlasten, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu fördern und Rahmenbedingungen zu schaffen, die die Entscheidung für Kinder erleichtern.
Welche finanziellen Leistungen bietet der Staat für Familien?
Zu den wichtigsten Leistungen gehören das Kindergeld, das Elterngeld (früher Erziehungsgeld) sowie steuerliche Entlastungen durch den Familienlastenausgleich.
Wie unterscheidet sich die Familienpolitik in Deutschland von Schweden oder Frankreich?
Länder wie Schweden und Frankreich setzen stärker auf einen flächendeckenden Ausbau der Kinderbetreuung und eine stärkere Förderung der Gleichstellung, was dort zu höheren Fertilitätsraten führt.
- Arbeit zitieren
- Diplom Sozialwissenschaftlerin Stefanie Prins (Autor:in), 2006, Demographischer Wandel und geringe Fertilität. Handlungsmöglichkeiten deutscher Familienpolitik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/71762