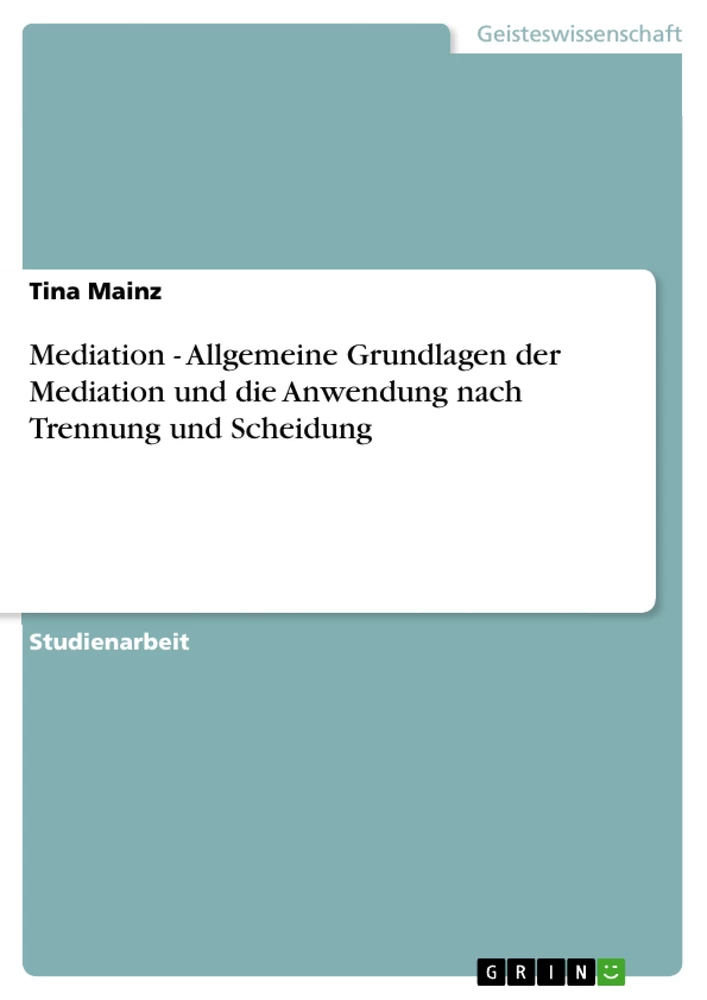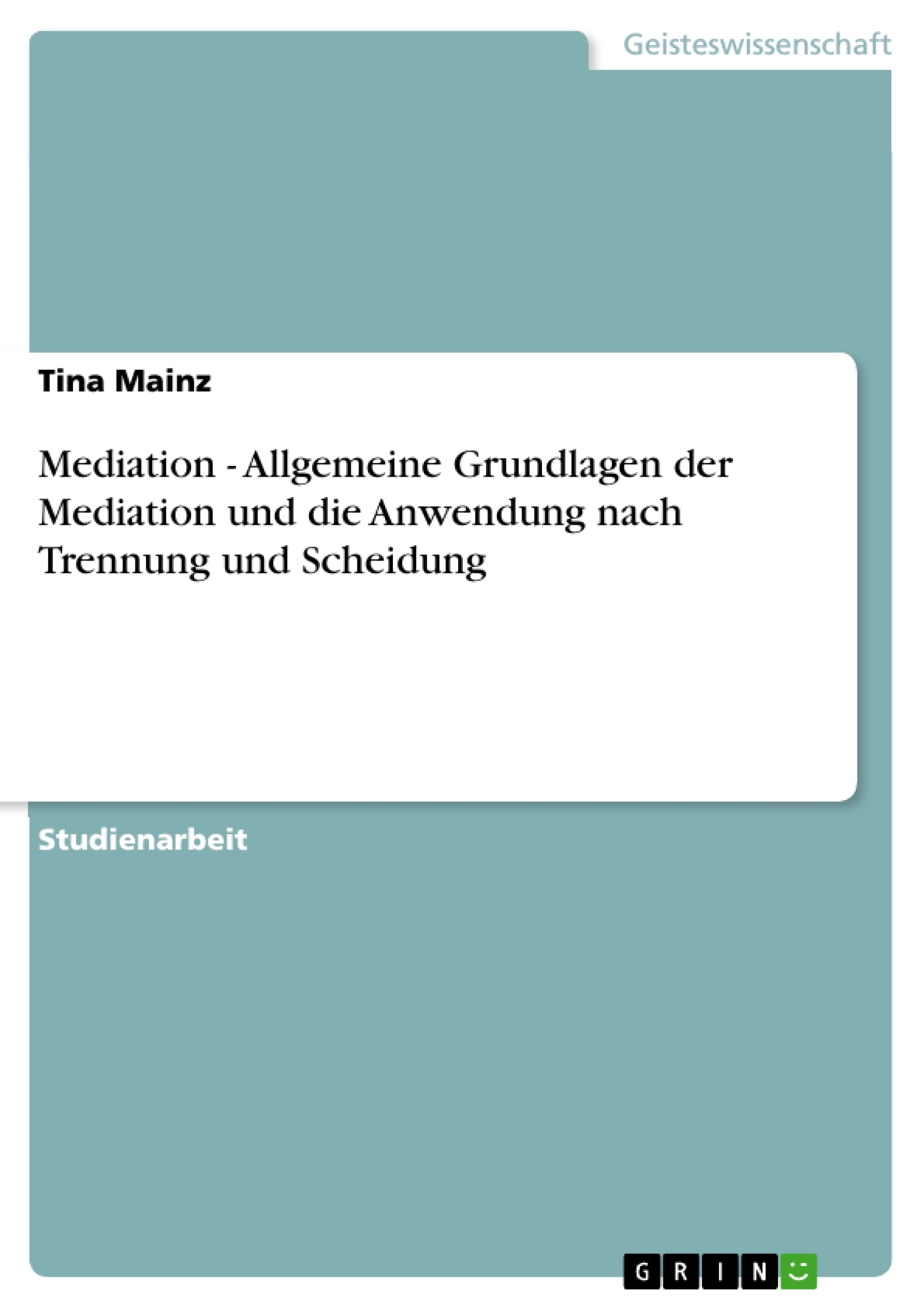Die Mediation wächst immer mehr an Bedeutung. Die Anwendungsfelder werden ständig erweitert. Im Bereich der Sozialen Arbeit bzw. Sozialpädagogik ist diese Methode nicht mehr weg zu denken. Einen ersten theoretischen Einblick konnte ich in einer Veranstaltung zu den Kurs- und Seminarmethoden in der Erwachsenenbildung erhalten. Anhand der Mediation wurde den Teilnehmern eine Seminarmethode erläutert. Dies weckte mein Interesse für die Mediation. Seit wenigen Monaten kann man in Rostock eine Mediationsausbildung absolvieren. Obwohl das Ausbildungsangebot mich sehr reizt, kann ich dies aus finanziellen Gründen zu diesem Zeitpunkt nicht realisieren. Weiterhin konnte ich bei einem Praxiskontakt, bei der Diakonie, weitere Informationen zur Mediation sammeln. Sie bietet Ehe-, Familien-, Lebens- und Erziehungsberatung an. Dabei ist die Bearbeitung von Konflikten eine alltägliche Aufgabe.
Für mich ist es wichtig, dass ich zu erst einen umfangreichen allgemeinen Überblick über die Mediation aufzeige. Als kleinen Exkurs, möchte ich die Mediation bei Scheidung und Trennung anschneiden.
Am Anfang werde ich dazu die Methoden der Sozialen Arbeit kurz vorstellen. Sie sollen verdeutlichen, dass es ein breites Spektrum an Methoden gibt und anschließend speziell die Anwendungsmöglichkeiten der Mediation erläutern. Danach werde ich die Grundlagen der Mediation, die Rolle des Mediators und das Mediationsverfahren beschreiben. Zusätzlich werde ich die Schattenseiten der Mediation nennen und beschreiben, bei welchen Gegebenheiten die Mediation nicht erfolgreich durchgeführt werden kann. Ich hätte gerne anhand von Studien die Vor- und Nachteile der Mediation erläutert. Dies kann ich jedoch nicht realisieren, da mir dazu keine Literatur zur Verfügung steht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Methoden der Sozialen Arbeit
- Das Ziel und die Grundsätze des sozialpädagogischen Handelns
- Die Methoden für die Zielumsetzung
- Die Mediation
- Die Grundlagen der Mediation
- Die Geschichte der Mediation
- Das Ziel der Mediation
- Die Anwendungsfelder der Mediation
- Der Konflikt
- Die Sozialen Konflikte
- Die Konfliktursachen
- Das Konfliktmodell der Mediation
- Der Mediator
- Die Begabungen des Mediators
- Die Tätigkeit des Mediators
- Die Prinzipien der Mediation
- Das Mediationsverfahren
- Die Eingangsphase
- Die Verhandlungsphase
- Die Abschlussphase
- Grenzen der Mediation
- Scheitern der Mediation durch mindestens eine Konfliktpartei
- Scheitern der Mediation aufgrund keiner Konfliktlösung
- Scheitern der Mediation durch den Mediator
- Kritik an der Mediation
- Die Anwendung der Mediation bei Trennung bzw. Scheidung unter Berücksichtigung der Kinder
- Die Auswirkungen der Trennung bzw. Scheidung für das Kind
- Die Mediationsanwendung bei Trennung und Scheidung
- Mediation bei Fragen der elterlichen Verantwortung
- Bei wem werden die Kinder leben und wie wird die konkrete Wohnsituation der Kinder gestaltet?
- Wie werden wichtige Entscheidungen bezüglich der Kinder getroffen?
- Wie gestaltet sich der persönliche Umgang jedes Elternteils mit dem Kind?
- Welche Vorkehrungen werden für besondere Umstände getroffen?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, einen umfassenden Überblick über Mediation zu geben, insbesondere deren Anwendung im Kontext von Trennung und Scheidung unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Kinder. Die Arbeit beleuchtet die Grundlagen der Mediation, die Rolle des Mediators und das Mediationsverfahren selbst. Zusätzlich werden die Grenzen und mögliche Kritikpunkte der Methode betrachtet.
- Grundlagen und Prinzipien der Mediation
- Die Rolle des Mediators im Mediationsprozess
- Anwendung der Mediation bei Trennung und Scheidung
- Auswirkungen von Trennung und Scheidung auf Kinder
- Grenzen und Kritikpunkte der Mediation
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Problematik von Scheidungen, insbesondere die Auswirkungen auf Kinder, und führt in die Thematik der Mediation als alternatives Konfliktlösungsverfahren ein. Der Fokus liegt auf der Bedeutung der Mediation als Methode, die Bedürfnisse der Kinder in den Vordergrund stellt und zu für alle Beteiligten akzeptablen Lösungen führt. Die Autorin erläutert ihren persönlichen Zugang zum Thema und ihre Motivation für die Arbeit.
Die Methoden der Sozialen Arbeit: Dieses Kapitel bietet einen kurzen Überblick über Methoden der Sozialen Arbeit, um die Mediation als eine von vielen möglichen Methoden einzuordnen. Es werden die Ziele und Grundsätze des sozialpädagogischen Handelns sowie verschiedene methodische Ansätze wie Einzelfallhilfe, Gruppenarbeit und Gemeinwesenarbeit erläutert. Die Mediation wird als direkt interventionsbezogene Methode im Kontext der Einzelfall- und Gruppenarbeit positioniert.
Die Grundlagen der Mediation: Hier werden die historischen Wurzeln der Mediation, ihre Ziele und ihre diversen Anwendungsbereiche detailliert dargestellt. Es wird auf die Bedeutung der Freiwilligkeit und der Selbstbestimmung der Konfliktparteien eingegangen. Die Kapitel legt den Grundstein für das Verständnis des Mediationsprozesses.
Der Konflikt: Dieses Kapitel beleuchtet die Natur sozialer Konflikte, deren Ursachen und ein Mediation spezifisches Konfliktmodell. Es werden verschiedene Aspekte von Konflikten untersucht, die für die erfolgreiche Mediation relevant sind, um den Prozess besser zu verstehen.
Der Mediator: Der Abschnitt beschreibt die notwendigen Fähigkeiten und Eigenschaften eines erfolgreichen Mediators, dessen Rolle im Prozess und die ethischen Prinzipien, die die Mediation leiten. Es wird die Bedeutung der Neutralität, des Vertrauens und der Kompetenz des Mediators hervorgehoben.
Das Mediationsverfahren: Dieses Kapitel erläutert den Ablauf des Mediationsverfahrens in seinen Phasen (Eingangsphase, Verhandlungsphase, Abschlussphase). Es beschreibt die einzelnen Schritte und die Rolle des Mediators in jeder Phase, um ein klares Bild des Ablaufs zu schaffen.
Grenzen der Mediation: Hier werden die Umstände diskutiert, unter denen eine Mediation scheitern kann, beispielsweise durch das Nicht-Mitwirken einer Konfliktpartei oder das Fehlen einer tragfähigen Konfliktlösung. Die Rolle des Mediators im Umgang mit solchen Herausforderungen wird ebenfalls thematisiert.
Kritik an der Mediation: Dieses Kapitel widmet sich einer kritischen Auseinandersetzung mit der Methode der Mediation, indem es mögliche Schwächen oder Limitationen aufzeigt. Es dient der umfassenden Betrachtung der Thematik und der Abwägung von Vor- und Nachteilen.
Die Anwendung der Mediation bei Trennung bzw. Scheidung unter Berücksichtigung der Kinder: Dieser Abschnitt analysiert die Auswirkungen von Trennung und Scheidung auf Kinder und zeigt auf, wie die Mediation als Instrument dazu beitragen kann, die negativen Folgen zu minimieren. Spezifische Aspekte der elterlichen Verantwortung werden im Detail betrachtet, wie die Gestaltung der Wohnsituation, die Entscheidungsfindung und den Umgang der Eltern mit dem Kind.
Schlüsselwörter
Mediation, Konfliktlösung, Trennung, Scheidung, Kinder, sozialpädagogisches Handeln, Methoden der Sozialen Arbeit, Mediator, Konfliktmodell, elterliche Verantwortung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Mediation bei Trennung und Scheidung unter Berücksichtigung der Kinder"
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über Mediation, insbesondere ihre Anwendung bei Trennung und Scheidung unter Berücksichtigung der Bedürfnisse von Kindern. Es umfasst ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf den Grundlagen der Mediation, der Rolle des Mediators, dem Mediationsverfahren, seinen Grenzen und möglicher Kritik.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt folgende Themen: Grundlagen und Prinzipien der Mediation, die Rolle des Mediators, Anwendung der Mediation bei Trennung und Scheidung, Auswirkungen von Trennung und Scheidung auf Kinder, Grenzen und Kritikpunkte der Mediation, Methoden der Sozialen Arbeit im Kontext der Mediation, Konfliktanalyse und Konfliktlösung im Rahmen der Mediation, sowie die spezifischen Herausforderungen der Mediation bei Fragen der elterlichen Verantwortung (Umgangsrecht, Sorgerecht, Wohnsituation der Kinder).
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument ist in Kapitel unterteilt, beginnend mit einer Einleitung und einem Überblick über die Methoden der Sozialen Arbeit. Es folgt eine detaillierte Erläuterung der Grundlagen der Mediation, des Konflikts, des Mediators und des Mediationsverfahrens. Es werden explizit die Grenzen und Kritikpunkte der Mediation diskutiert und abschließend die Anwendung der Mediation bei Trennung und Scheidung unter Berücksichtigung der Kinder und deren Bedürfnisse betrachtet. Jedes Kapitel wird zusammengefasst.
Welche Zielsetzung verfolgt das Dokument?
Das Dokument zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis von Mediation zu vermitteln, insbesondere im Kontext von Trennung und Scheidung. Es möchte die Bedeutung der Mediation für das Wohl der Kinder hervorheben und die verschiedenen Aspekte des Prozesses, von den Grundlagen bis zu den möglichen Herausforderungen, klar darstellen.
Wer ist die Zielgruppe dieses Dokuments?
Das Dokument richtet sich an Personen, die sich für Mediation interessieren, insbesondere im Kontext von Trennung und Scheidung. Dies können Studierende der Sozialen Arbeit, Angehörige der Justiz, Mediatorinnen und Mediatoren, aber auch Eltern sein, die sich über die Möglichkeiten der Mediation informieren möchten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Mediation, Konfliktlösung, Trennung, Scheidung, Kinder, sozialpädagogisches Handeln, Methoden der Sozialen Arbeit, Mediator, Konfliktmodell, elterliche Verantwortung.
Welche Phasen umfasst das Mediationsverfahren?
Das Mediationsverfahren umfasst drei Phasen: die Eingangsphase (Vorbereitung und Klärung), die Verhandlungsphase (Austausch und Lösungsfindung) und die Abschlussphase (Vereinbarung und Dokumentation).
Welche Grenzen und Kritikpunkte werden an der Mediation angesprochen?
Das Dokument thematisiert das mögliche Scheitern der Mediation aufgrund von Nicht-Mitwirken einer Partei, dem Fehlen einer tragfähigen Lösung oder Fehlern des Mediators. Allgemeine Kritikpunkte an der Methode werden ebenfalls diskutiert, ohne diese spezifisch zu benennen.
Wie werden die Bedürfnisse der Kinder bei der Mediation berücksichtigt?
Die Bedürfnisse der Kinder stehen im Mittelpunkt des Abschnitts zur Anwendung der Mediation bei Trennung und Scheidung. Es werden konkrete Fragen der elterlichen Verantwortung wie Wohnsituation, Entscheidungsfindung und Umgang der Eltern mit dem Kind detailliert behandelt.
Wo finde ich mehr Informationen zu den Methoden der Sozialen Arbeit?
Das Dokument bietet einen kurzen Überblick, verweist aber nicht auf weiterführende Literatur zu den Methoden der Sozialen Arbeit. Weitere Informationen können durch Recherche in einschlägiger Fachliteratur gefunden werden.
- Quote paper
- Tina Mainz (Author), 2007, Mediation - Allgemeine Grundlagen der Mediation und die Anwendung nach Trennung und Scheidung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/71775