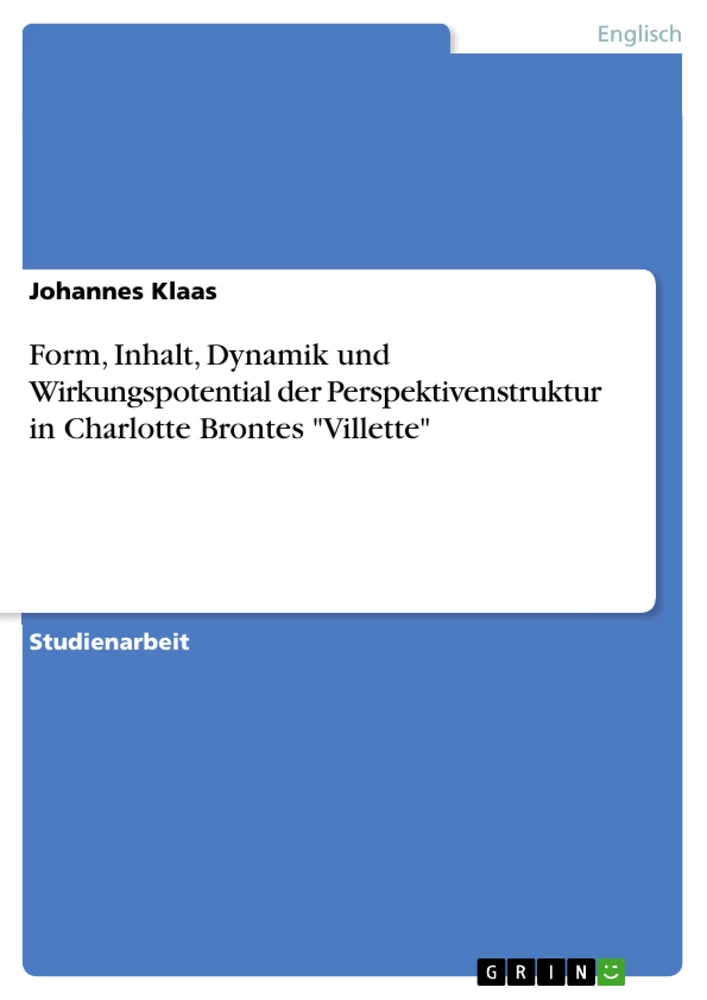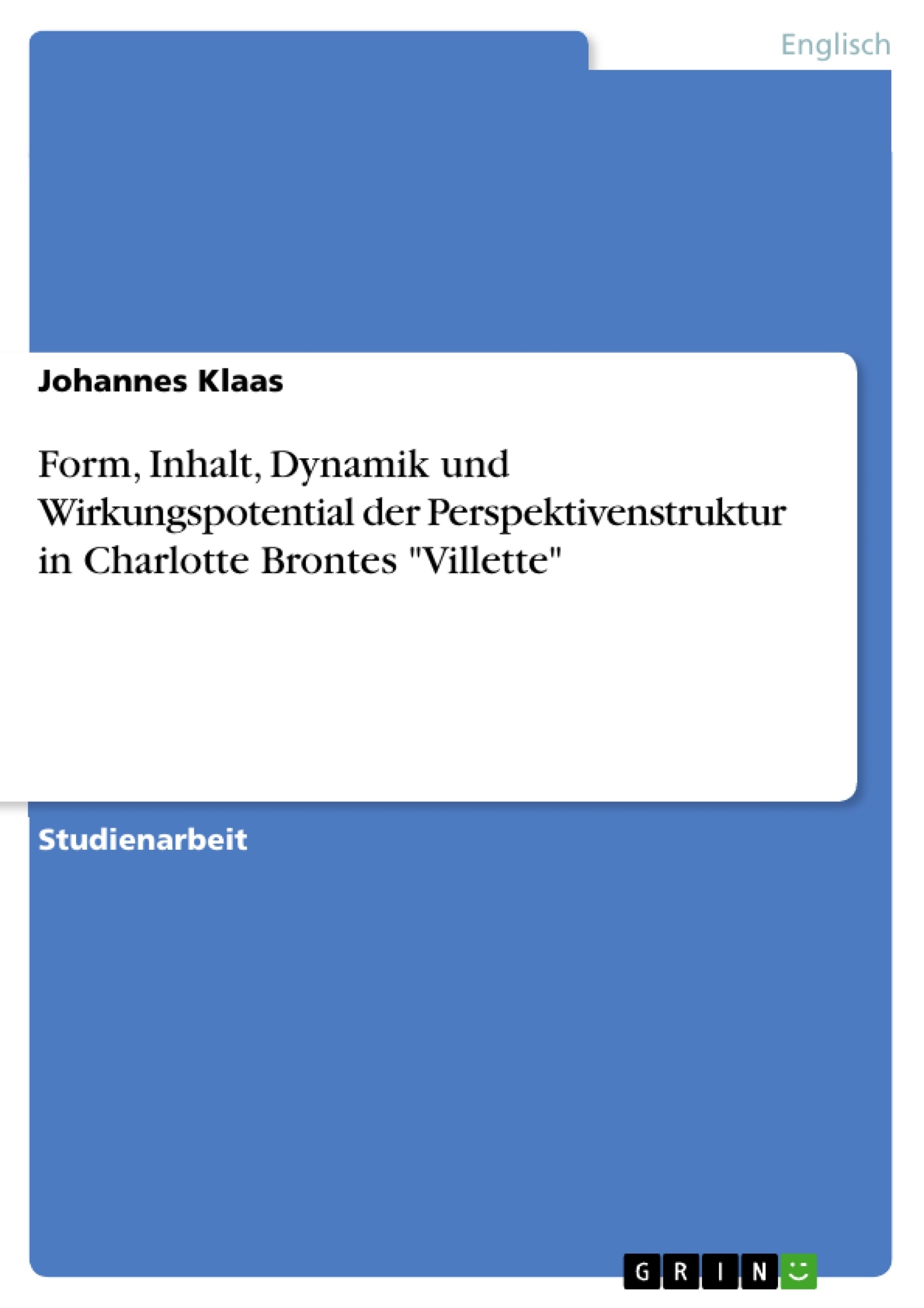Charlotte Brontës Roman Villette (1853) ist dominiert von der Wirklichkeitssicht der Erzählerin Lucy Snowe, die als autodiegetische Erzählinstanz retrospektiv die Entwicklung ihres Lebens beschreibt. Dabei entfaltet sie detailliert ihre eigene Perspektive sowie die Perspektive der Figuren, die ihr auf ihrem Lebensweg begegnen. Diese Arbeit wird die Entwicklung der Perspektive Lucy Snowes sowie die der anderen Figuren auf inhaltliche und formale Aspekte hin untersuchen. Aus Gründen des beschränkten Umfangs dieser Arbeit sollen nur die Perspektiven Mme Becks, M. Pauls und Grahams einer detaillierten Analyse unterzogen werden. Die im Rahmen der Besprechung der Figurenperspektiven ausgelassenen Perspektiven finden jedoch Eingang in die Überlegungen zur Perspektivenstruktur im dritten Teil dieser Arbeit.
Die Perspektivenstruktur eines Textes ist ein auf der übergeordneten Kommunikationsebene N3 anzusiedelndes Phänomen. Sie konstituiert sich durch „die Beziehung aller Figurenperspektiven zueinander und durch deren Verhältnis zur Erzählerperspektive“. Die Perspektivenstruktur ist somit mehr als nur „die Summe aller Teile, denn sie erfaßt modellhaft die strukturellen Verhältnisse zwischen allen Einzelperspektiven“. Die Kommunikationsebene N3 ist ein abstraktes Konstrukt, das von Nünning als „die Summe aller strukturellen Kontrast- und Korrespondenzrelationen, die sich durch Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen textuellen Elementen auf N1 und N2 ergeben“ beschrieben wird. Es ist also ein „virtuelle[s] System“ , da die Beziehungen, die zwischen den verschiedenen textuellen Elementen bestehen, erst von den Rezipienten durch die Auseinandersetzung mit dem Gesamttext erzeugt werden können. Aus diesem Grund stellt die Ebene N3 so etwas wie die Schnittstelle zwischen Text und Rezipienten dar. Bevor jedoch Aussagen über die Perspektivenstruktur des Textes gemacht werden können, müssen die verschiedenen textuellen Elemente analysiert werden. Eine Analyse der Einzelperspektiven wird deshalb den ersten Teil dieser Arbeit ausmachen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einzelperspektiven in Villette
- Lucy Snowe
- Parameter der Perspektivenentwicklung Lucys
- Beschreibung der Welt in Bretton als Projektion der Wünsche und Sehnsüchte Lucys
- Selbständigkeit und Eigenverantwortung durch Isolation
- Implizite Selbstcharakterisierung Lucys durch Auseinandersetzung mit den Perspektiven der anderen Figuren
- Miss Marchmont
- Ginevra Fanshawe
- Figurenperspektiven
- Mme Beck
- Perspektiveninhalte
- Art der Darstellung der Perspektive
- Dynamik der Perspektive
- M. Paul
- Perspektiveninhalte
- Dynamik der Perspektive
- Art der Darstellung der Perspektive
- Perspektiveninhalte und Dynamik der Perspektive John Graham Brettons
- Perspektivenstruktur
- Selektion und Kombination von Figurenperspektiven
- Grad der Ausgestaltung der Erzählerperspektive
- Grad der Integrativität der Einzelperspektiven
- Wirkungspotential der Perspektivenstruktur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der Perspektive der Erzählerin Lucy Snowe sowie der anderen Figuren in Charlotte Brontës Roman Villette (1853). Der Fokus liegt auf der Analyse der Perspektiveninhalte und -dynamik, wobei die Perspektive von Mme Beck, M. Paul und Graham im Detail betrachtet werden. Die Arbeit analysiert die Perspektivenstruktur des Textes als ein komplexes Phänomen, das durch die Beziehungen zwischen allen Figurenperspektiven und deren Verhältnis zur Erzählerperspektive entsteht.
- Entwicklung der Perspektive Lucy Snowes
- Analyse der Perspektiven von Mme Beck, M. Paul und Graham
- Die Perspektivenstruktur als übergeordnetes Phänomen
- Die Beziehung zwischen Figurenperspektiven und Erzählerperspektive
- Der Einfluss der Perspektivenstruktur auf die Wirkung des Textes
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Roman Villette und seine dominierende Perspektive der Erzählerin Lucy Snowe vor. Die Arbeit untersucht, wie diese Perspektive die Welt des Romans, die Beziehungen der Figuren und die Entwicklung des Bewusstseins von Lucy Snowe prägt.
Im zweiten Kapitel werden die Einzelperspektiven der Figuren, insbesondere die von Lucy Snowe, untersucht. Die Analyse fokussiert auf die Beschreibung der Welt in Bretton aus Lucys Perspektive und die Auswirkungen der Isolation auf ihre Selbständigkeit und Eigenverantwortung. Es wird zudem analysiert, wie Lucy sich durch die Auseinandersetzung mit den Perspektiven anderer Figuren, wie Miss Marchmont und Ginevra Fanshawe, selbst charakterisiert. Die Kapitel 2.2.1 und 2.2.2 widmen sich dann den Perspektiven von Mme Beck und M. Paul und analysieren die Inhalte, die Dynamik und die Darstellung ihrer Perspektiven.
Das dritte Kapitel betrachtet die Perspektivenstruktur des Romans als ein komplexes Ganzes. Es untersucht die Selektion und Kombination von Figurenperspektiven, den Grad der Ausgestaltung der Erzählerperspektive und die Integrativität der Einzelperspektiven.
Das vierte Kapitel analysiert das Wirkungspotenzial der Perspektivenstruktur. Es befasst sich mit den Möglichkeiten, die die Perspektivenstruktur eröffnet, um Spannung, Empathie und Identifikation beim Leser zu erzeugen und die Handlung des Romans zu strukturieren.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Aspekten der Romananalyse, insbesondere mit den Konzepten der Perspektive, der Perspektivenstruktur und der Erzählform. Die Analyse von Villette fokussiert auf die autodiegetische Erzählform, die Darstellung von Figurenperspektiven, die Entwicklung des Bewusstseins der Erzählerin und die Auswirkungen der Perspektivenstruktur auf die Gestaltung und Wirkung des Romans.
Häufig gestellte Fragen
Wie ist die Perspektivenstruktur in Charlotte Brontës „Villette“ aufgebaut?
Der Roman wird von der autodiegetischen Erzählerin Lucy Snowe dominiert. Die Struktur ergibt sich aus der Beziehung ihrer retrospektiven Sicht zu den Perspektiven anderer Figuren.
Wer ist Lucy Snowe als Erzählinstanz?
Lucy Snowe ist eine autodiegetische Erzählerin, das heißt, sie ist gleichzeitig die Hauptfigur ihrer eigenen Geschichte und blickt rückblickend auf ihre Entwicklung zurück.
Wie charakterisiert sich Lucy Snowe selbst?
Ihre Charakterisierung erfolgt oft implizit durch die Art und Weise, wie sie andere Figuren (wie Mme Beck oder Ginevra Fanshawe) wahrnimmt und deren Perspektiven kommentiert.
Welche Rolle spielt die Isolation für die Protagonistin?
Die Isolation zwingt Lucy zu Selbstständigkeit und Eigenverantwortung, prägt aber auch ihre oft distanzierte und beobachtende Perspektive auf ihre Umwelt.
Was bewirkt die Perspektivenstruktur beim Leser?
Sie schafft ein hohes Wirkungspotenzial für Spannung und Empathie, da der Leser die Welt fast ausschließlich durch Lucys subjektives und oft gefiltertes Bewusstsein erlebt.
- Arbeit zitieren
- Johannes Klaas (Autor:in), 1997, Form, Inhalt, Dynamik und Wirkungspotential der Perspektivenstruktur in Charlotte Brontes "Villette", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/717