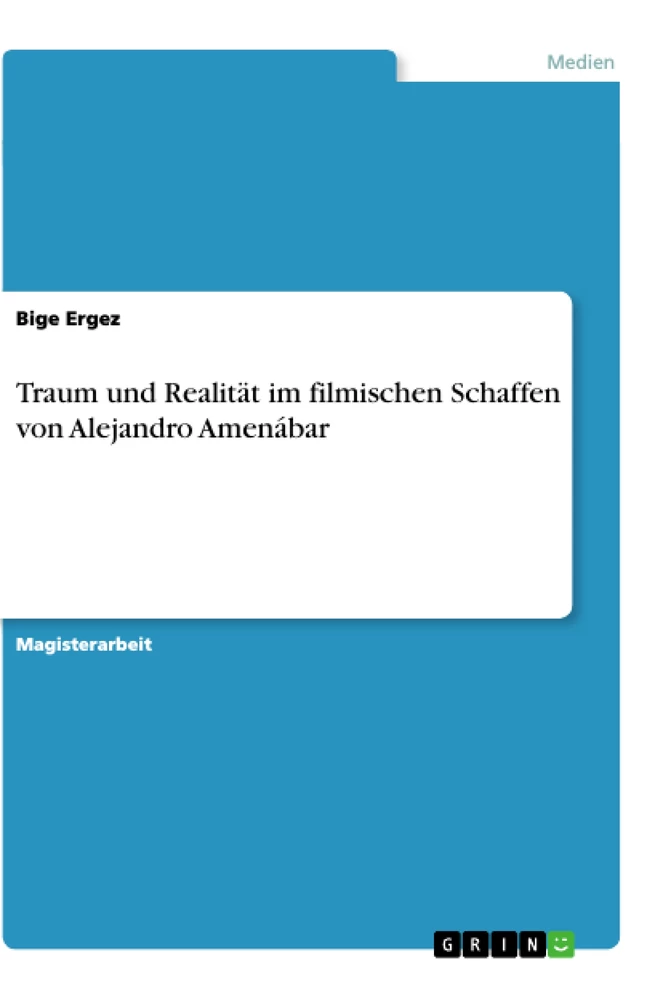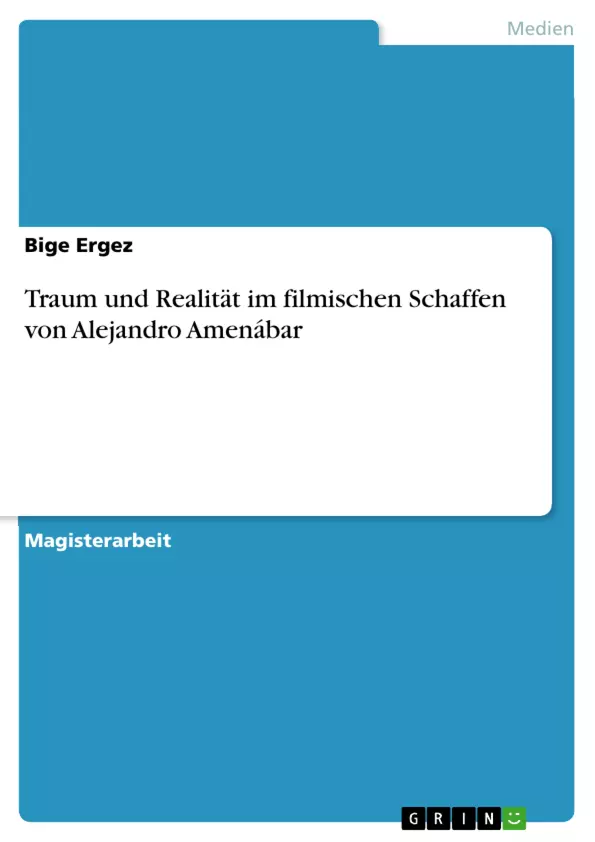In seinem um 380 v. Chr. entstandenen „Höhlengleichnis“ versetzt Platon seine Höhlenbewohner in eine finstere Höhle hinein, in der diese sich seit ihrer Kindheit befinden. Sie sind an Hals und Schenkeln gefesselt, mit dem Rücken zum Licht und nehmen lediglich Schatten der Außenwelt wahr. Dieses Szenario bildet aufgrund der begrenzten Wahrnehmungsfähigkeit, die Platon seinen Höhlenbewohnern zuschreibt, die Essenz vieler medientheoretischer Überlegungen. Platons Idee von den Höhlenbewohnern, die die Schattenbilder für die Realität halten, da sie nichts anderes wahrnehmen, findet sich aktuell in der gegenwärtigen Medienkritik wieder. Überträgt man Platons „Höhlengleichnis“ auf die heutige Welt, stellt diese nur ein Abbild, einen Schatten der Wirklichkeit dar.
Die Höhle Platons veranschaulicht medienkritisch betrachtet das Modell moderner Gesellschaften. Die Individuen der Gegenwart blicken ebenso wie die Höhlenbewohner auf bloße Abbilder. Die gegenwärtige Welt besteht zu einem wesentlichen Teil aus medial vermittelten Bildern. Aus einer wahrnehmungsästhetischen Perspektive heraus treibt diese epochale Bilderflut die Menschen sukzessive zur Erkenntnisunfähigkeit voran. Die Welt avanciert durch die kinematographisch, digital und virtuell erzeugten Abbilder zu einer Scheinwelt. Aus dem skizzierten Szenario Platons lässt sich erkennen, dass die Vorstellung, die sinnliche Wahrnehmung entspreche der Wirklichkeit, bereits zu Platons Lebzeiten ihre Glaubwürdigkeit verloren hatte. In der gegenwärtigen Zeit wird dieser Zweifel an der Sinneswahrnehmung radikalisiert – bedingt durch die digitale Revolution. Die Bilderwelten werden ubiquitär. Fiktion und Wirklichkeit fusionieren; die Realitätssphären der realen Welt und der medialen Bilderwelt vermischen sich. Die Wirklichkeit wird heute nicht mehr beschrieben, sondern rekonstruiert.
Dieser Rekonstruktion von Wirklichkeit widmet sich der chilenisch-spanische Regisseur Alejandro Amenábar. Die Dichotomie zwischen Traum und Realität prägt leitmotivisch die Gesamtstruktur und Narration zwei seiner Filme. Genau mit dem beschriebenen Phänomen setzt sich die vorliegende Arbeit auseinander. Das Wesen der Realität und ihre Interferenzen und Grenzüberschreitungen mit dem Traum in Amenábars Filmen werden im Folgenden einer wahrnehmungsästhetischen Analyse unterworfen. Sein Film „Abre los Ojos“ bildet dabei den Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Wahrnehmung im Wandel
- 3 Zur Dichotomie Traum – Realität
- 3.1 Surrealismus
- 3.1.1 Zur Entstehung des Surrealismus
- 3.1.2 Spielformen des surrealistischen Films
- 3.2 Jorge Luis Borges
- 3.2.1 Borges und Fiktionen
- 3.2.2 Traum und Realität in Borges' Werk
- 3.3 Traum
- 3.3.1 Traumdiskurs – Traumästhetik
- 3.3.2 Traum und Film
- 4 Alejandro Amenábar
- 4.1 Abre los Ojos
- 4.1.1 Abre los Ojos
- 4.1.2 Synopsis
- 4.1.3 Traum und Realität: Eine intertextuelle Analyse der Symbolik
- 4.1.4 Cyberspace – Eine Wirklichkeitsprothese?
- 4.2 Wahrnehmungsästhetische Elemente
- 4.3 Reflexionen zu Amenábars Werk
- 5 Abschließende Überlegungen
- 6 Quellennachweis
- 6.1 Primärliteratur
- 6.2 Sekundärliteratur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung von Traum und Realität in den Filmen von Alejandro Amenábar, insbesondere in "Abre los Ojos". Ziel ist es, die wahrnehmungsästhetischen Aspekte seiner Werke zu analysieren und die Frage nach der Fragwürdigkeit der Realität in einer von medial vermittelten Bildern geprägten Welt zu beleuchten. Der Surrealismus als künstlerische Bewegung und das Werk von Jorge Luis Borges dienen als theoretische Bezugspunkte.
- Die Ambivalenz von Traum und Realität im Film
- Die Rolle des Surrealismus in der Darstellung von Wahrnehmung
- Die Wahrnehmungsästhetik in Amenábars Filmen
- Der Einfluss medial vermittelter Bilder auf das Realitätsverständnis
- Borges' literarische Auseinandersetzung mit Traum und Realität
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beginnt mit einem Zitat von Dietmar Kamper, das sich auf Platons Höhlengleichnis bezieht und die Problematik der Wahrnehmung in einer von Bildern geprägten Welt thematisiert. Sie führt in die Thematik der Arbeit ein, indem sie den Zweifel an der Sinneswahrnehmung im digitalen Zeitalter hervorhebt und die Filme von Alejandro Amenábar als Fallbeispiel für die Auseinandersetzung mit der Dichotomie von Traum und Realität präsentiert. Die Arbeit konzentriert sich auf Amenábars Film "Abre los Ojos" und untersucht dessen wahrnehmungsästhetische Aspekte.
2 Wahrnehmung im Wandel: Dieses Kapitel untersucht die grundlegenden Veränderungen der Wahrnehmungsgewohnheiten im Kontext der medialen Bilderflut. Es diskutiert, wie die medial kommunizierte Realität die Definition des Realitätsbegriffs prägt und wie die Unterscheidung zwischen Schein und Sein durch Digitalisierung und Virtualisierung zunehmend erschwert wird. Das Kapitel betont die zunehmende Vermischung von Fiktion und Wirklichkeit in der modernen Gesellschaft.
3 Zur Dichotomie Traum – Realität: Dieses Kapitel analysiert die Dichotomie von Traum und Realität, zunächst durch die Auseinandersetzung mit dem Surrealismus und seinen stilistischen Mitteln. Es beleuchtet die Entstehung des Surrealismus und seine Spielformen im Film, insbesondere im spanischen Raum. Anschließend wird das Werk von Jorge Luis Borges untersucht, seine Verwendung des Traums als Metapher und seine literarische Auseinandersetzung mit den Grenzbereichen von Traum und Realität. Abschließend wird der Traum aus kulturwissenschaftlicher Perspektive betrachtet, unter Einbezug des Traumdiskurses und der besonderen Beziehung von Traum und Film.
4 Alejandro Amenábar: Dieses Kapitel analysiert die wahrnehmungsästhetischen Elemente in den Filmen von Alejandro Amenábar. Der Schwerpunkt liegt auf "Abre los Ojos", das detailliert untersucht und nach wahrnehmungsästhetischen Aspekten analysiert wird. Die Darstellung von Traum und Realität in Amenábars filmischem Schaffen wird anhand dieses Films dargelegt und durch die Analyse weiterer Filme präzisiert. Das Kapitel beleuchtet, warum Amenábar in seinen Filmen das Trügerische der Wahrnehmung betont und die Fragwürdigkeit der Realität hervorhebt.
Schlüsselwörter
Wahrnehmung, Realität, Traum, Surrealismus, Alejandro Amenábar, Abre los Ojos, Jorge Luis Borges, Medien, Digitalisierung, Virtualisierung, Wahrnehmungsästhetik, Fiktion, Film.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse von Traum und Realität in den Filmen Alejandro Amenábars
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Darstellung von Traum und Realität in den Filmen von Alejandro Amenábar, insbesondere in "Abre los Ojos". Sie untersucht die wahrnehmungsästhetischen Aspekte seiner Werke und beleuchtet die Frage nach der Fragwürdigkeit der Realität in einer von medial vermittelten Bildern geprägten Welt.
Welche theoretischen Bezugspunkte werden verwendet?
Der Surrealismus als künstlerische Bewegung und das Werk von Jorge Luis Borges dienen als theoretische Bezugspunkte für die Analyse. Die Arbeit bezieht sich auch auf den Traumdiskurs und die Traumästhetik.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Ambivalenz von Traum und Realität im Film, die Rolle des Surrealismus in der Darstellung von Wahrnehmung, die Wahrnehmungsästhetik in Amenábars Filmen, den Einfluss medial vermittelter Bilder auf das Realitätsverständnis und Borges' literarische Auseinandersetzung mit Traum und Realität.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Einleitung, ein Kapitel zur Wahrnehmung im Wandel, ein Kapitel zur Dichotomie Traum-Realität (mit Unterkapiteln zu Surrealismus, Borges und dem Traum selbst), ein Kapitel zu Alejandro Amenábar (mit Fokus auf "Abre los Ojos"), abschließende Überlegungen und einen Quellennachweis.
Welche Aspekte von "Abre los Ojos" werden analysiert?
Die Analyse von "Abre los Ojos" konzentriert sich auf die wahrnehmungsästhetischen Aspekte des Films, die Darstellung von Traum und Realität, die Symbolik und die Frage nach der Wirklichkeitsprothese im Cyberspace.
Welche Rolle spielt der Surrealismus in der Arbeit?
Der Surrealismus dient als wichtiger theoretischer Bezugspunkt, indem seine stilistischen Mittel und seine Darstellung von Wahrnehmung im Kontext der Analyse der Dichotomie Traum-Realität untersucht werden.
Welche Bedeutung hat Jorge Luis Borges für die Arbeit?
Das Werk von Jorge Luis Borges, insbesondere seine literarische Auseinandersetzung mit Traum und Realität und seine Verwendung des Traums als Metapher, wird als theoretischer Bezugspunkt herangezogen.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die abschließenden Überlegungen der Arbeit fassen die Ergebnisse der Analyse zusammen und bieten eine umfassende Betrachtung der Thematik. (Der genaue Inhalt der Schlussfolgerungen ist aus der Zusammenfassung der Kapitel nicht detailliert ersichtlich.)
Welche Kapitel enthält die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet Kapitel zu: Einleitung, Wahrnehmung im Wandel, Die Dichotomie Traum-Realität (inkl. Surrealismus, Borges, und Traum), Alejandro Amenábar (inkl. Abre los Ojos und Wahrnehmungsästhetik), Abschließende Überlegungen und Quellennachweis.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Wahrnehmung, Realität, Traum, Surrealismus, Alejandro Amenábar, Abre los Ojos, Jorge Luis Borges, Medien, Digitalisierung, Virtualisierung, Wahrnehmungsästhetik, Fiktion, Film.
- Quote paper
- Bige Ergez (Author), 2006, Traum und Realität im filmischen Schaffen von Alejandro Amenábar, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/71870