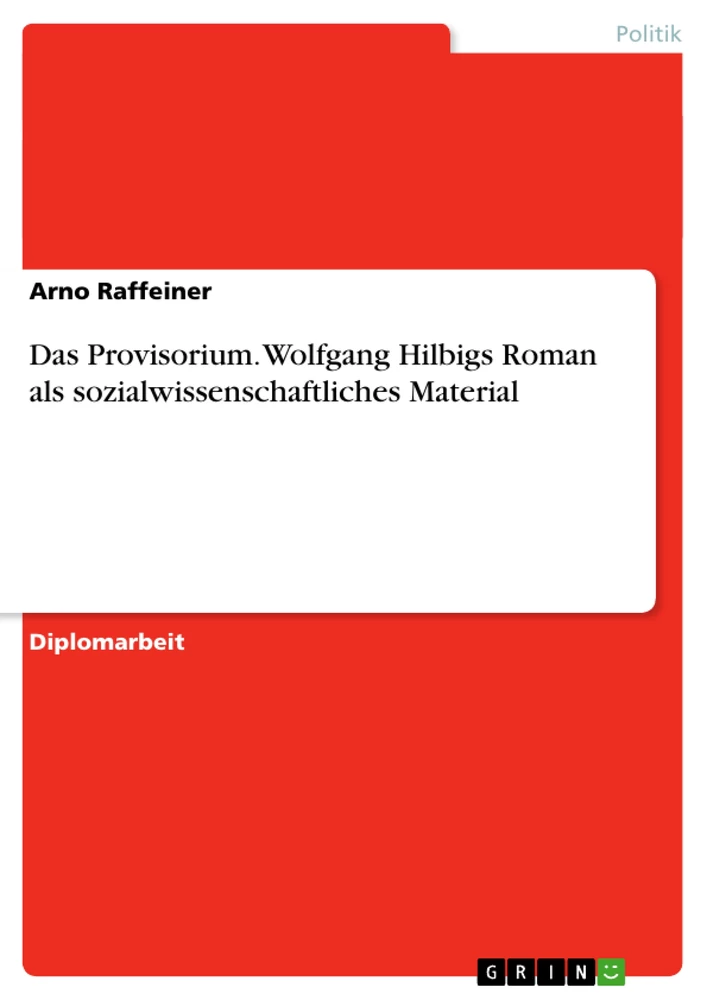Die Idee, hier einen literarischen Text als Material für eine politikwissenschaftliche
Untersuchung zu verwenden, hat zweifellos mit meiner zweiten Studienrichtung
Germanistik zu tun. Im Laufe des Studiums ist es mir nur vereinzelt gelungen, meinem
persönlichen Interesse an einer grundsätzlichen Verbindung der beiden Bereiche Politik
und Literatur im gewünschten Maße nachzugehen. Auch wenn eine solche Verbindung
sich oft aufdrängt und teilweise in der Natur der (literarischen) Sache zu liegen scheint,
spielt sie in der konkreten politik- und auch der literaturwissenschaftlichen
Forschungspraxis kaum eine Rolle. Ich wende hier also einen etwas unüblichen,
interdisziplinären Ansatz an, um die sozialwissenschaftliche Relevanz von belletristischer
Literatur und ihre Ergiebigkeit auch für die Politikwissenschaft zu erproben
beziehungsweise zu demonstrieren.
Als nicht ganz problemlos, aber sehr spannend und interessant hat sich das selbständige
Ausarbeiten des theoretischen Instrumentariums erwiesen, da nicht auf allgemein bekannte
Rezepte zurückgegriffen werden konnte. In einer Patchwork-artigen Konstruktion habe ich
daher verschiedene Herangehensweisen rezipiert, mir theoretische Begriffe entliehen, sie
miteinander in Verbindung gebracht und mir so ein eigenes theoretisch-methodisches
Gerüst zurecht gezimmert. Das Ergebnis wird in einem ersten grundlegenden Abschnitt zu
Literatur und Politik vorgestellt.
War ursprünglich noch die Untersuchung mehrerer Texte aus dem OEuvre von
Wolfgang Hilbig geplant, so habe ich mich schließlich doch für die Konzentration auf ein
wesentliches und aktuelles Werk entschieden, dessen politischer und historischer
Hintergrund überdies ganz eindeutig feststeht. An Hilbigs drittem Roman Das Provisorium
wird dafür eine eingehende Untersuchung unternommen, in der auch vermehrt ganz
konkret am Text gearbeitet wird: Dem zentralen Abschnitt der Textanalyse wird im
Rahmen dieser Arbeit viel Platz eingeräumt.
Auf die übrigen Werke Wolfgang Hilbigs wird selbstverständlich Bezug genommen,
und ebenso habe ich versucht, auch weitere literarische Texte anderer AutorInnen als
ergänzende Quellen mit einzubeziehen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkung
- I. Literatur und Politik
- 1. Der literarische als politologischer Text
- 2. Auffassung des Politischen: enger und weiter Politikbegriff
- 3. Wissenschaft und Literatur
- 4. Literatur und Wirklichkeit
- a) Literatur als Als-ob-Welt
- b) Soll und Ist. Die ideologische Wirklichkeit in der DDR.
- 5. Zur Frage der Methode
- II. Wolfgang Hilbig als Politologe
- 1. Biografie und Werk
- 2. Hilbigs Prosa als sozialwissenschaftliches Material?
- III. Textanalyse: Das Provisorium
- 1. Zum Inhalt
- 2. Die besondere Erzählsituation des Textes
- 3. Thematische Ebene der Textwirklichkeit
- a) Fremdheit, Orientierungslosigkeit, Selbstzerstörung…
- b) Osten Westen
- c) Der "Schrecken" der Vergangenheit
- d) DDR: Determinismus, Nicht-Existenz, Aggression
- e) Konsumkritik als Kritik des Westens
- f) Literatur als Vergleichsfeld der beiden deutschen Gesellschaften
- 4. Exkurs: Sozialwissenschaftliche DDR-Forschung in der Bundesrepublik
- 5. Subjektive Dimension der Textwirklichkeit: zwischenmenschliche Beziehungen
- a) Die soziale Relevanz der Machtgefüge
- b) C.s Verhältnis zu Frauen und seine Liebesunfähigkeit
- c) Soziale Auflösung
- IV. Fazit
- 1. Ergebnisse der Textanalyse
- a) Osten und Westen: verschiedene Gleiche
- b) Getrennt vereint?
- c) Die Krise der Gesellschaft
- d) Der literarische Text und die Wende: Chronik oder Erklärungsansatz?
- e) Das Provisorium als Wende-Roman?
- 2. Literatur als politikwissenschaftliches Material. Eine Bilanz des Ansatzes
- 1. Ergebnisse der Textanalyse
- Literatur
- 1. Primärliteratur
- 2. Sekundärliteratur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht Wolfgang Hilbigs Roman "Das Provisorium" aus politikwissenschaftlicher Perspektive. Ziel ist es, die sozialwissenschaftliche Relevanz von belletristischer Literatur und ihre Ergiebigkeit für die Politikwissenschaft zu belegen.
- Der literarische Text als politologisches Material
- Die politische und ideologische Wirklichkeit in der DDR
- Die Auswirkungen der deutschen Wiedervereinigung auf die Gesellschaft
- Das Verhältnis zwischen Osten und Westen
- Die Rolle von Literatur als Vergleichsfeld zwischen den beiden deutschen Gesellschaften
Zusammenfassung der Kapitel
Die Vorbemerkung erläutert die Idee, einen literarischen Text als Material für eine politikwissenschaftliche Untersuchung zu verwenden. Die Einleitung führt in die Thematik „Literatur und Politik“ ein, beleuchtet verschiedene Perspektiven auf den Politischen Begriff und untersucht das Verhältnis von Wissenschaft und Literatur.
Der zweite Abschnitt widmet sich Wolfgang Hilbig als Autor und seiner Biografie sowie der Frage, ob seine Prosa als sozialwissenschaftliches Material betrachtet werden kann. Die dritte Sektion beinhaltet eine tiefgehende Textanalyse von "Das Provisorium", inklusive der Beschreibung des Inhalts, der Erzählsituation und der thematischen Ebenen, wie Fremdheit, Orientierungslosigkeit und Selbstzerstörung, sowie dem Verhältnis zwischen Ost und West.
Schlüsselwörter
Diese Arbeit beschäftigt sich mit Themen wie der deutsch-deutschen Geschichte, der politischen Kultur der DDR, der Wendezeit, den Folgen der Wiedervereinigung, sowie der Frage, ob und wie Literatur als politikwissenschaftliches Material genutzt werden kann. Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Literatur als Als-ob-Welt, DDR-Forschung, Transformationsliteratur, Fremdheit, Orientierungslosigkeit, Selbstzerstörung, Machtgefüge, sozialer Wandel.
Häufig gestellte Fragen
Kann Literatur als sozialwissenschaftliches Material dienen?
Ja, die Arbeit nutzt Wolfgang Hilbigs Roman "Das Provisorium", um die Ergiebigkeit belletristischer Texte für die politikwissenschaftliche Forschung zu demonstrieren.
Was thematisiert der Roman "Das Provisorium"?
Der Roman behandelt die Erfahrungen eines DDR-Schriftstellers im Westen, die Orientierungslosigkeit zwischen den Systemen und die Folgen der Wiedervereinigung.
Wie wird das Verhältnis von Ost und West im Text analysiert?
Die Arbeit untersucht Motive wie Fremdheit, Konsumkritik im Westen und den Determinismus sowie die "Nicht-Existenz" in der DDR-Vergangenheit.
Was versteht man unter Literatur als "Als-ob-Welt"?
Es beschreibt die Fähigkeit der Literatur, Realität fiktional zu spiegeln und dadurch tieferliegende soziale und psychologische Wahrheiten greifbar zu machen.
Ist "Das Provisorium" ein typischer Wende-Roman?
Die Arbeit prüft, ob der Text eher als Chronik der Ereignisse oder als tiefergehender Erklärungsansatz für die gesellschaftliche Krise der Wendezeit zu sehen ist.
- Quote paper
- Arno Raffeiner (Author), 2002, Das Provisorium. Wolfgang Hilbigs Roman als sozialwissenschaftliches Material, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/7189