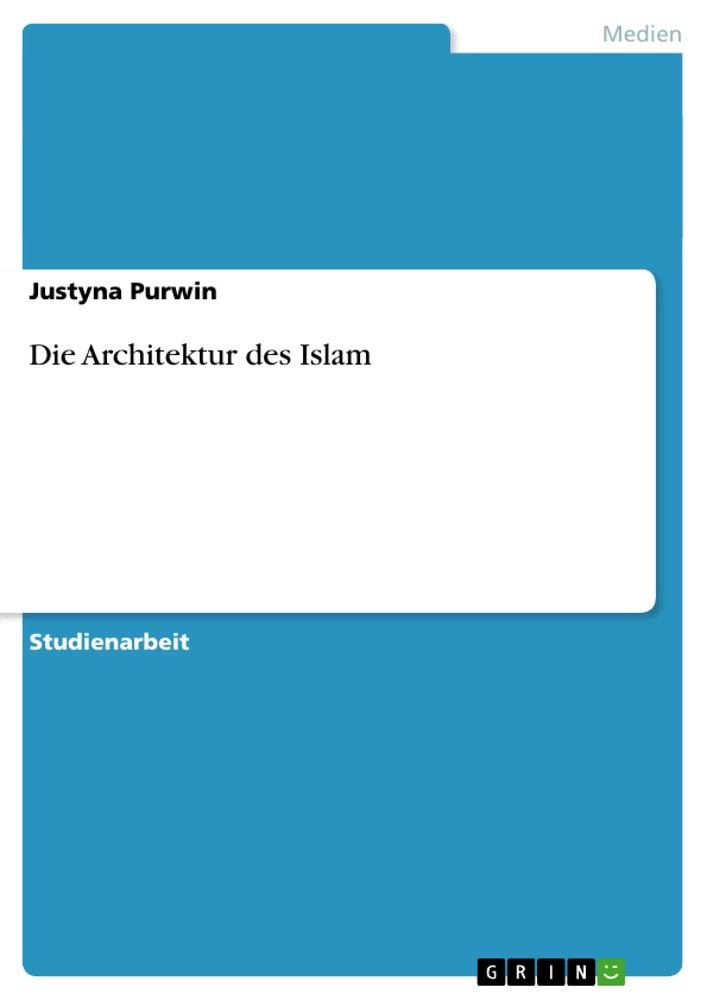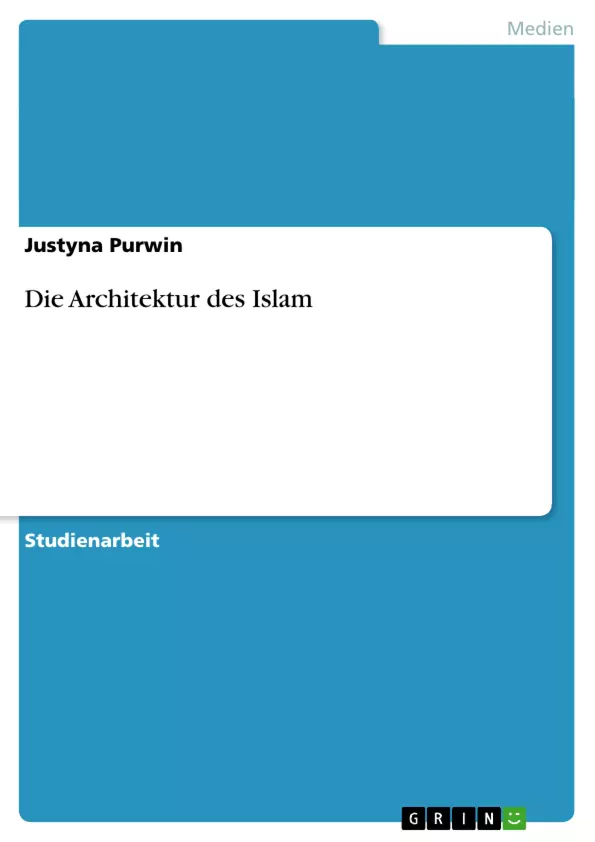Das Verständnis für die islamische Kunst leidet in Europa unter vielen Vorurteilen. Eine gängige Meinung ist, dass die islamische Kultur keinen Vorschritt wie die europäische Zivilisation erbracht hat. Man begegnet auch der Ansicht, dass die Kunst des Islams, weil sie weitgehend auf realistische Nachbildung verzichtet, keine Gehalte aufweist. Die auffallende Enthaltsamkeit dieser Kunst ist ein Resultat einer Vorstellung, dass die Wirklichkeit die unsichtbare, sich überall manifestierende Macht des einen Gottes ist, die nicht zu fassen ist. Bei der islamischen Kunst geht es nicht um die Darstellung der alltäglichen Realität in ihren verschiedenen subjektiven Ansichten sondern um die Anstrebung eines kontemplativen Zustandes, aus dem sich dem Menschen jene Einheit der Schöpfung erschließt, die im Bild selbst nicht darstellbar ist.1 Das Ziel meiner Hausarbeit ist die Vorurteile gegenüber der islamischen Kunst abzubauen und ein besseres Verständnis für diese Kunst zu schaffen. Ich konzentriere mich Hauptsächlich auf der Architektur, da ich der Meinung bin, dass das eigentliche Wesen der islamischen Kunst anhand ihrer Architektur ermessen werden kann. In der Architektur sind auch die für die traditionelle islamische Kultur charakteristischen Haltungen und Formen am meisten greifbar. Die islamische Architektur wurde durch eine Vielzahl von Einflüssen geprägt, zu denen vor allem die Geschichte, Religion und kulturelle Unterschiede gehörten. Um die Architektur des Islam zu analysieren ist es zunächst notwendig diese Einflussbereiche zu erläutern. Im zweiten Kapitel werde ich also die geschichtliche Entwicklung der islamischen Architektur schildern. Das dritte Kapitel ist den kulturellen und gesellschaftlichen Voraussetzungen gewidmet. Des Weiteren behandle ich die Thematik des islamischen Raumdenkens und in den Kapiteln fünf und sechs beschreibe die architektonischen Formen des Palast- und Gartenbaus. Daraufhin widme ich mich dem islamischen Bilderverbot und stelle die drei wichtigsten Ausdrucksformen der bildenden Kunst Islams vor: die Kalligraphie, das Ornament und die Arabeske.
=
1 Bianca, Stefano: Hofhaus und Paradiesgarten. Architektur und Lebensformen in der islamischen Welt. C.H. Beck: München, 1991. S. 253
Inhaltsverzeichnis
- Einführung.
- Die geschichtliche Entwicklung der islamischen Architektur ( 661-1500) .
- Kulturelle und Gesellschaftliche Voraussetzungen.....
- Der Raum
- Das Zelt.
- Das Haus
- Die Siedlung (,,Kasbas“)
- Die Stadt..
- Residenzen und Paläste
- Der Garten ........
- Bilderverbot........
- Die Kalligraphie
- Das Ornament....
- Schlussbetrachtung .......
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit zielt darauf ab, Vorurteile gegenüber der islamischen Kunst abzubauen und ein besseres Verständnis für diese Kunst zu schaffen. Der Fokus liegt dabei auf der Architektur, da die Autorin der Meinung ist, dass das eigentliche Wesen der islamischen Kunst anhand ihrer Architektur ermessen werden kann.
- Geschichtliche Entwicklung der islamischen Architektur
- Kulturelle und gesellschaftliche Voraussetzungen der islamischen Architektur
- Der Raum in der islamischen Architektur
- Residenzen und Paläste in der islamischen Architektur
- Das Bilderverbot in der islamischen Kunst
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Vorurteile gegenüber der islamischen Kunst und die besondere Bedeutung der Architektur für das Verständnis dieser Kunstform.
Kapitel zwei beleuchtet die Anfänge der islamischen Architektur in der Zeit der Umaiyadendynastie (661-750) und zeichnet die Entwicklung der Moschee- und Palastbauten nach. Es werden auch die charakteristischen Merkmale der damaligen Architektur, wie das geometrische Ornament, erörtert.
Kapitel drei befasst sich mit den kulturellen und gesellschaftlichen Voraussetzungen, die die islamische Architektur prägten.
Kapitel vier untersucht das Raumdenken in der islamischen Kultur und analysiert verschiedene Raumtypen wie das Zelt, das Haus und die Stadt.
Kapitel fünf und sechs widmen sich der Architektur von Palästen und Gärten, die typische Elemente der islamischen Baukunst darstellen.
Kapitel sieben beleuchtet das Bilderverbot in der islamischen Kunst und präsentiert die wichtigsten Ausdrucksformen, wie die Kalligraphie, das Ornament und die Arabeske.
Schlüsselwörter
Islamische Architektur, Moschee, Palast, Ornament, Kalligraphie, Arabeske, Bilderverbot, Raumdenken, Umaiyaden, Geschichte, Kultur, Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptmerkmale der islamischen Architektur?
Charakteristisch sind geometrische Ornamente, Kalligraphie, Arabesken sowie eine spezifische Raumgestaltung in Moscheen, Palästen und Gärten.
Warum spielt das Bilderverbot im Islam eine Rolle für die Kunst?
Das Bilderverbot führte dazu, dass sich die islamische Kunst statt auf realistische Abbildungen auf abstrakte Formen wie Ornamente und Schriftkunst (Kalligraphie) konzentrierte.
Welche Bedeutung hat der Garten in der islamischen Kultur?
Der Garten gilt oft als Abbild des Paradieses und ist ein zentrales Element der Palastarchitektur, das Ruhe und Kontemplation fördern soll.
Was versteht man unter dem Begriff „Kasbas“?
Kasbas sind traditionelle befestigte Siedlungen oder Burgviertel, die ein wesentlicher Bestandteil der islamischen Stadt- und Raumplanung sind.
Welche Einflüsse prägten die Architektur der Umaiyaden?
Die Architektur wurde durch geschichtliche Entwicklungen, religiöse Anforderungen und die Verschmelzung verschiedener kultureller Traditionen der Region geprägt.
- Quote paper
- Justyna Purwin (Author), 2006, Die Architektur des Islam, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/72005