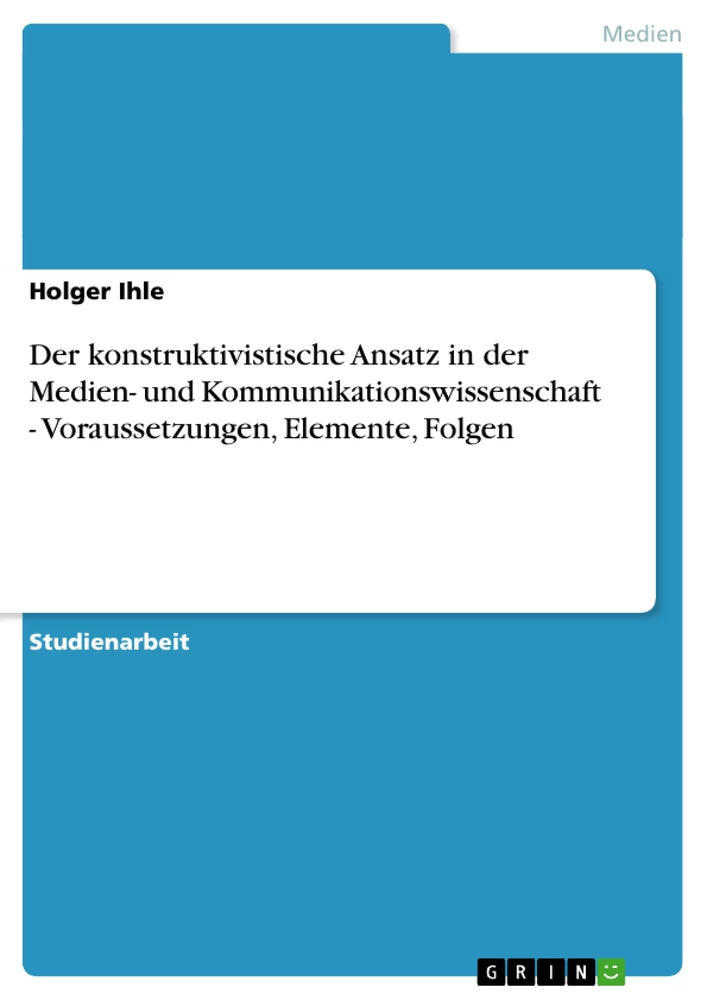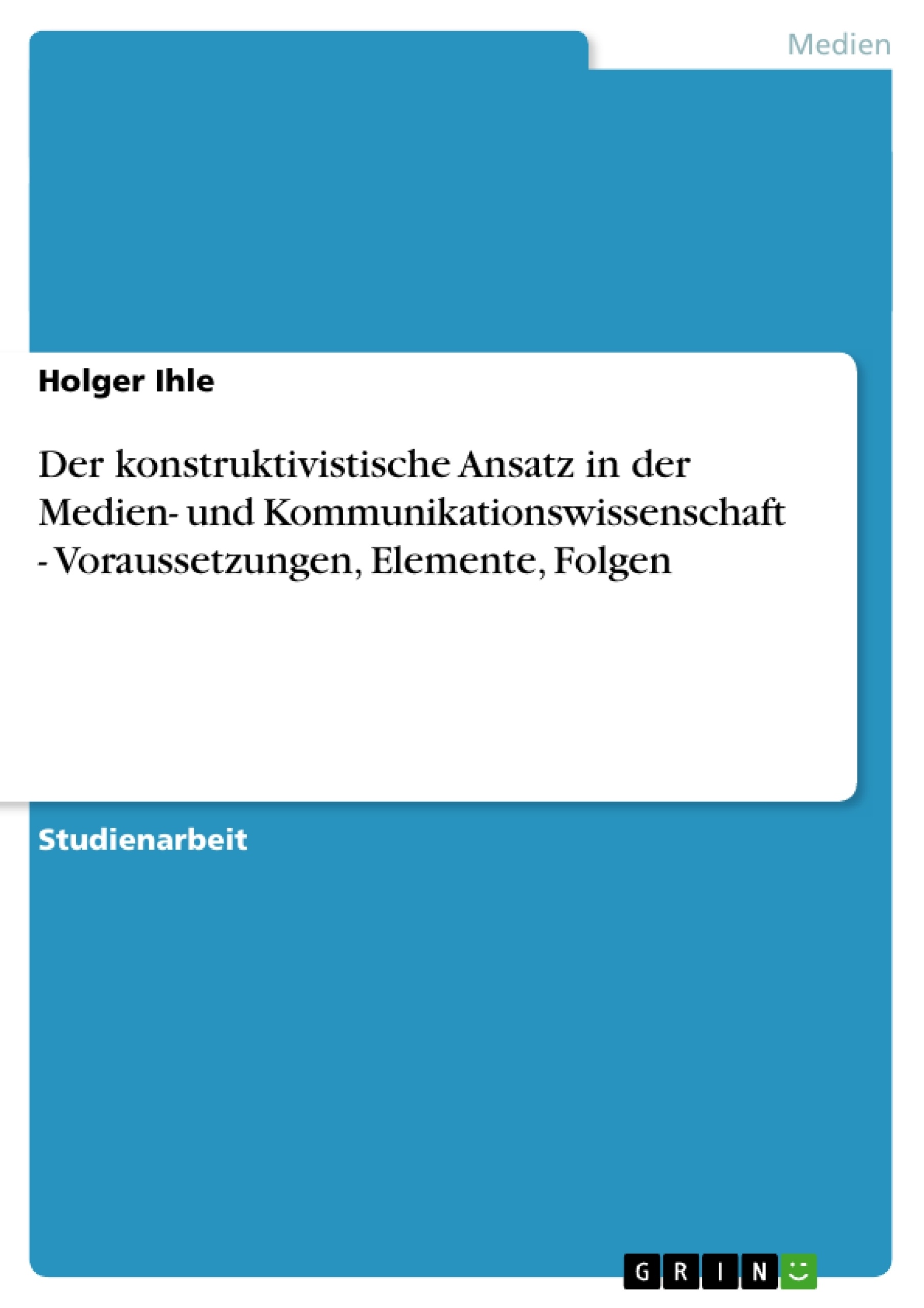Der Konstruktivismus ist in den letzten dreißig Jahren innerhalb der Medien- und Kommunikationswissenschaft zunehmend populärer geworden. Das liegt nicht zuletzt daran, dass unter dessen Grundannahmen die als zunehmend zirkulär erscheinenden Medienwirkungen eine weiter reichende Bedeutungsdimension erhalten, als mit einem einfachen realistischen Modell, in dem Medieninhalte als Abbild ‚der Realität‘ gelten. Medieninhalte können damit als eigener sinnproduzierender Teil von Wirklichkeit verstanden werden. Jedoch hat diese erkenntnistheoretische Sichtweise eine zweite Seite. Nicht nur die MedienrezipientInnen werden im Sinne des Konstruktivismus durch ihre Umwelt entscheidend geprägt. Auch die MedienproduzentInnen und letztlich auch die MedienforscherInnen können die als objektiv gedachte Wirklichkeit nur als kognitives Konstrukt wahrnehmen, das entscheidend durch das Subjekt geprägt wird. Insbesondere im Rahmen der Medienwirkungsforschung, wo verschiedene Messinstrumente zum Nachweis bestimmter Medienwirkungen angewandt werden entsteht damit ein hermeneutischer Zirkel. Gemessen werden kann nicht die Wirklichkeit, sondern nur ein Wirklichkeitskonstrukt. Jedes Messergebnis ist dabei bereits bestimmt durch das Messinstrument, das notwendigerweise nur einen Ausschnitt der Wirklichkeit erfassen kann. Da bereits diese Wirklichkeit durch das Subjekt ‚ForscherIn‘ bestimmt ist kann schlechterdings von einer empirischen Erfassung der Realität keine Rede sein. Der Konstruktivismus operiert mit den Begriffen der Wirklichkeit erster und der Wirklichkeit zweiter Ordnung. Aus wissenschaftstheoretischer Sicht muss hier die Beobachtung erster und die Beobachtung zweiter Ordnung hinzutreten. ForscherInnen, die sich auf die Suche nach den Konstruktionsmechanismen des Publikums begeben sind also BeobachterInnen zweiter Ordnung. Aus radikal konstruktivistischer Sicht ist dies auch die einzige Möglichkeit der Erkenntnis, da die Wirklichkeit erster Ordnung nur mit deren Wahrnehmung, nicht aber mit ihrem Objekt abgeglichen werden kann (vgl. Schmidt 1990: 50).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundpositionen des Konstruktivismus
- Wissen
- Neurobiologische Prämissen
- Soziale Prämissen
- Konstruktivismus in der Kommunikationswissenschaft
- Konsequenzen des Konstruktivismus für die Medienwirkungsforschung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den konstruktivistischen Ansatz in der Medien- und Kommunikationswissenschaft. Ziel ist es, die Grundannahmen des Konstruktivismus zu erläutern und dessen Konsequenzen für die Medienwirkungsforschung aufzuzeigen. Die Arbeit beleuchtet die Wechselwirkung zwischen Subjekt und Objekt, die Rolle der Wahrnehmung und die Herausforderungen für empirische Forschung.
- Der Konstruktivismus als erkenntnistheoretische Grundlage
- Wirklichkeitskonstruktion und Erfahrung
- Der Einfluss des Konstruktivismus auf die Medienwirkungsforschung
- Die Rolle von Wahrnehmung und Messinstrumenten
- Beobachtung erster und zweiter Ordnung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die zunehmende Popularität des Konstruktivismus in der Medien- und Kommunikationswissenschaft ein. Sie argumentiert, dass der Konstruktivismus eine weiterreichende Bedeutungsdimension für Medienwirkungen bietet als realistische Modelle. Die Arbeit betont die kognitiven Konstrukte sowohl bei Rezipienten als auch Produzenten und Forschern, was zu einem hermeneutischen Zirkel in der Medienwirkungsforschung führt, da nur Wirklichkeitskonstrukte, nicht die Realität selbst, gemessen werden können. Der Begriff der Wirklichkeit erster und zweiter Ordnung sowie die Rolle des Beobachters werden eingeführt.
Grundpositionen des Konstruktivismus: Dieses Kapitel kontrastiert den Realismus mit dem Idealismus und positioniert den Konstruktivismus als eine alternative Perspektive. Der Konstruktivismus ersetzt den Begriff der Wirklichkeit durch "Erfahrungswirklichkeit", wobei empirische Fakten als auf Regelmäßigkeiten in der Erfahrung basierende Konstrukte verstanden werden. Der Begriff der Viabilität von Wirklichkeitskonstrukten und das Thomas-Theorem werden eingeführt, um die Wechselwirkung zwischen Wahrnehmung und Handeln zu betonen.
Wissen: Dieses Kapitel definiert Wissen neu im konstruktivistischen Kontext. Wissen wird nicht als Abbildung der objektiven Realität, sondern als Handlungsstrategie des Subjekts zur Anpassung an die Welt verstanden. Der Fokus liegt auf der Brauchbarkeit und Nützlichkeit von Wissen für das Individuum.
Neurobiologische Prämissen: Dieses Kapitel erweitert den Fokus auf die biologischen Voraussetzungen der menschlichen Wahrnehmung. Die biologische Beschaffenheit der Sinnesorgane prägt die Wahrnehmung und limitiert die Reize, die auf das Gehirn einwirken. Dies unterstreicht die konstruktive Natur der Wirklichkeit. Die Arbeit differenziert zwischen dem Fokus auf Wissen und Sein im Konstruktivismus.
Schlüsselwörter
Konstruktivismus, Medienwirkungsforschung, Wirklichkeitskonstruktion, Wahrnehmung, Erfahrungswirklichkeit, Viabilität, Hermeneutischer Zirkel, Beobachtung erster und zweiter Ordnung, Wissen, Medienrezeption, Medienproduktion.
Häufig gestellte Fragen zum Konstruktivismus in der Medien- und Kommunikationswissenschaft
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den konstruktivistischen Ansatz in der Medien- und Kommunikationswissenschaft. Sie erläutert die Grundannahmen des Konstruktivismus und zeigt dessen Konsequenzen für die Medienwirkungsforschung auf. Ein Schwerpunkt liegt auf der Wechselwirkung zwischen Subjekt und Objekt, der Rolle der Wahrnehmung und den Herausforderungen für empirische Forschung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt unter anderem den Konstruktivismus als erkenntnistheoretische Grundlage, Wirklichkeitskonstruktion und Erfahrung, den Einfluss des Konstruktivismus auf die Medienwirkungsforschung, die Rolle von Wahrnehmung und Messinstrumenten sowie Beobachtung erster und zweiter Ordnung. Es wird ein Vergleich zwischen Realismus und Idealismus gezogen und der Begriff der "Erfahrungswirklichkeit" eingeführt. Die neurobiologischen Prämissen der Wahrnehmung und die Definition von Wissen im konstruktivistischen Kontext werden ebenfalls beleuchtet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet Kapitel zu Einleitung, Grundpositionen des Konstruktivismus, Wissen, Neurobiologischen Prämissen, Sozialen Prämissen (obwohl der Inhalt zum letzten Punkt im gegebenen Auszug fehlt), Konstruktivismus in der Kommunikationswissenschaft und Konsequenzen des Konstruktivismus für die Medienwirkungsforschung. Die Einleitung führt in die Thematik ein und betont die Bedeutung des Konstruktivismus für das Verständnis von Medienwirkungen. Die weiteren Kapitel vertiefen die einzelnen Aspekte des Konstruktivismus und dessen Implikationen.
Wie wird Wissen im konstruktivistischen Kontext definiert?
Im konstruktivistischen Kontext wird Wissen nicht als Abbildung der objektiven Realität verstanden, sondern als Handlungsstrategie des Subjekts zur Anpassung an die Welt. Der Fokus liegt auf der Brauchbarkeit und Nützlichkeit von Wissen für das Individuum.
Welche Rolle spielt die Wahrnehmung?
Die Wahrnehmung spielt eine zentrale Rolle, da sie die Grundlage für die Konstruktion der Wirklichkeit bildet. Die biologische Beschaffenheit der Sinnesorgane prägt die Wahrnehmung und limitiert die Reize, die auf das Gehirn einwirken. Dies unterstreicht die konstruktive Natur der Wirklichkeit. Die Arbeit betont auch die Herausforderungen, die die subjektive Natur der Wahrnehmung für empirische Forschung mit sich bringt.
Was ist der "hermeneutische Zirkel" im Kontext dieser Arbeit?
Der hermeneutische Zirkel beschreibt die Herausforderung, dass in der Medienwirkungsforschung nur Wirklichkeitskonstrukte, nicht die Realität selbst, gemessen werden können. Dies liegt an den kognitiven Konstrukten bei Rezipienten, Produzenten und Forschern.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die relevanten Schlüsselwörter umfassen Konstruktivismus, Medienwirkungsforschung, Wirklichkeitskonstruktion, Wahrnehmung, Erfahrungswirklichkeit, Viabilität, Hermeneutischer Zirkel, Beobachtung erster und zweiter Ordnung, Wissen, Medienrezeption und Medienproduktion.
Was ist der Unterschied zwischen Realismus und Konstruktivismus in dieser Arbeit?
Die Arbeit kontrastiert den Realismus, der von einer objektiven Realität ausgeht, mit dem Konstruktivismus. Der Konstruktivismus ersetzt den Begriff der Wirklichkeit durch "Erfahrungswirklichkeit", wobei empirische Fakten als auf Regelmäßigkeiten in der Erfahrung basierende Konstrukte verstanden werden.
Was ist der Begriff "Viabilität" im Kontext des Konstruktivismus?
Der Begriff der Viabilität von Wirklichkeitskonstrukten beschreibt, wie gut ein bestimmtes Wirklichkeitskonstrukt für das Individuum funktioniert und ihm hilft, sich in der Welt zurechtzufinden. In Verbindung mit dem Thomas-Theorem wird betont, dass die wahrgenommene Wirklichkeit auch dann Auswirkungen hat, wenn sie nicht der "objektiven" Realität entspricht.
Welche Bedeutung hat die Unterscheidung zwischen Beobachtung erster und zweiter Ordnung?
Die Unterscheidung zwischen Beobachtung erster und zweiter Ordnung hebt die Rolle des Beobachters und die damit verbundene Subjektivität in der Wahrnehmung und Interpretation von Ereignissen hervor. Beobachtung erster Ordnung bezieht sich auf die direkte Wahrnehmung, während Beobachtung zweiter Ordnung die Reflexion über die eigene Wahrnehmung umfasst.
- Citation du texte
- M.A. Holger Ihle (Auteur), 2007, Der konstruktivistische Ansatz in der Medien- und Kommunikationswissenschaft - Voraussetzungen, Elemente, Folgen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/72028