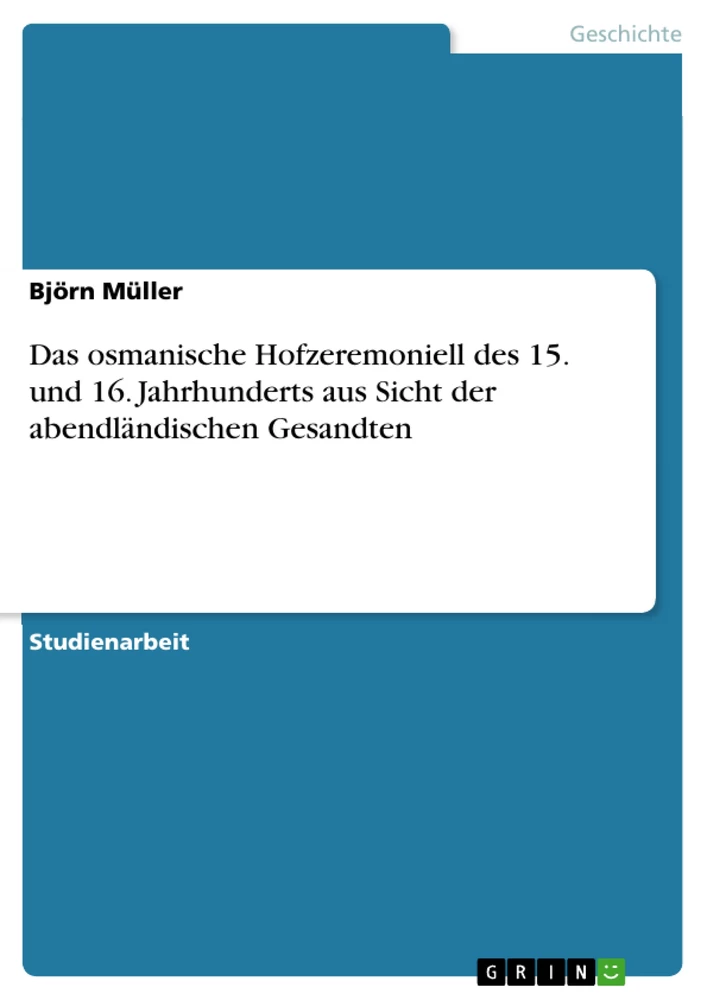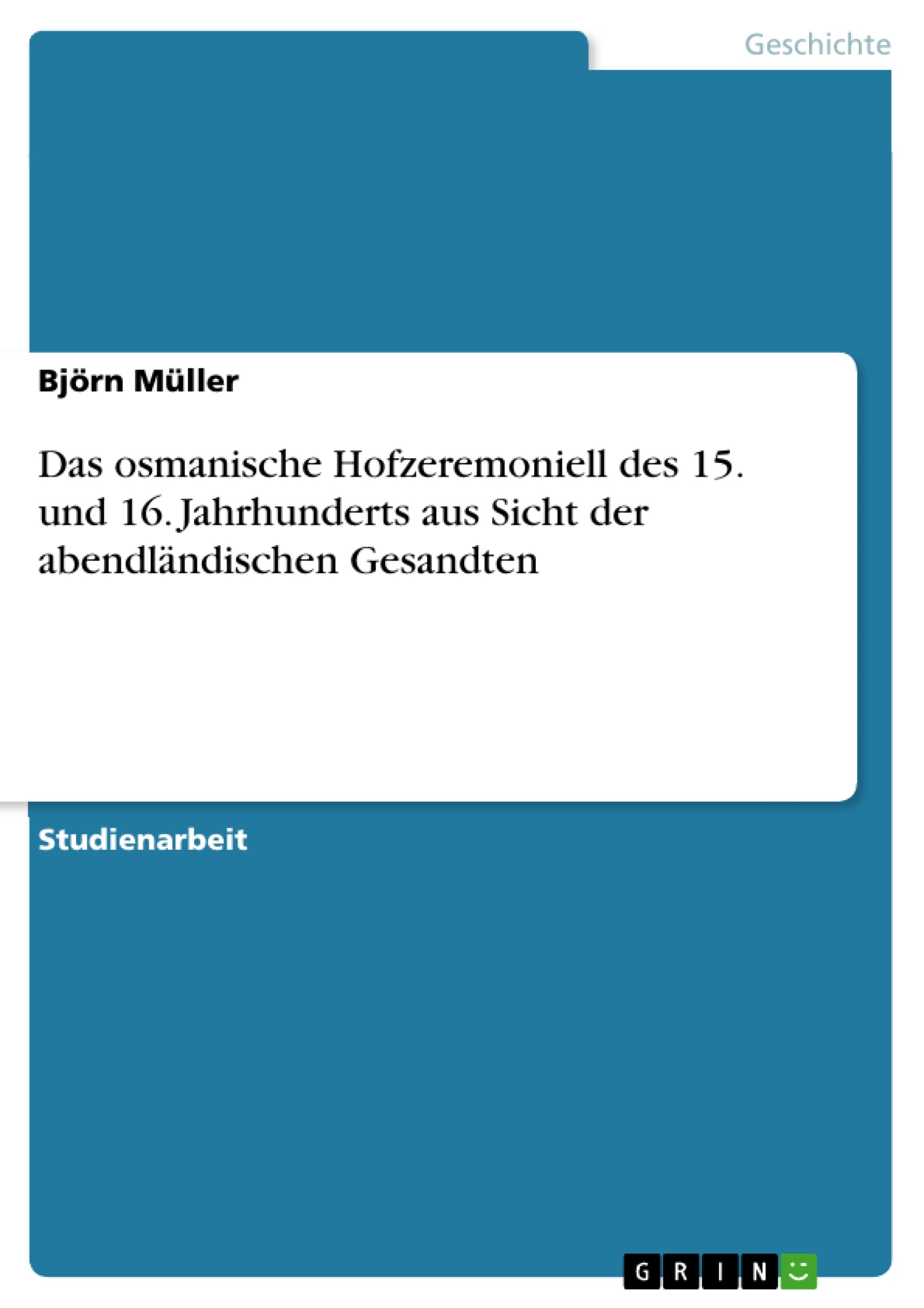Das Leben am Hof des osmanischen Sultans stellte sich für viele Generationen im Abendland Lebender äußerst geheimnisvoll dar und bot so eine Grundlage für zahlreiche Spekulationen. Sagenhafte Geschichten rankten sich um das Leben am Hofe des Sultans. Die Berichte solcher, welche dort eine Zeit lang verbracht und wieder heimkehrten, trugen nicht immer zur Entmystifizierung der dortigen Lebensart bei. Denn wie könnte sich ein Herrscher noch geheimnisvoller gebärden, als wenn er, in seinem herrlichen und für Europäer durch seine Exotik fast schon märchenhaften Palast, nur hinter einem für den Besucher nicht durchsichtigem Gitter anwesend war?1 Dieses, und weitere für den abendländischen Besucher nicht ohne weiteres zu verstehende Bräuche führten zu der eben erwähnten Mystifizierung des osmanischen Hofes. Das osmanische Hofzeremoniell fand im 16. Jahrhundert seine endgültige Gestalt.2 Angestoßen durch Mehmeds Qânûnnâme und der Konzeption seiner Herrschaft als Weltherrschaft sowie ihm als Nachfolger der oströmischen Kaiser3 führte die Entwicklung zu einer immer weiter fortschreitenden Entrückung des Sultans. Diese Entwicklung des Hofzeremoniells wurde in früheren Zeiten immer wieder verkannt. Eine Folge dieser Ansicht war, dass man lange davon ausging, dass die Osmanen ihr Zeremoniell allein vom Byzantinischen Reich übernommen hätten.4 Ganz in dieser Tradition verhaftet, schreibt Franz Babinger in seinem Buch „Mehmed der Eroberer“: „Unzweifelhaft an byzantinische Vorbilder anknüpfend, wurde sowohl am Hof als auch in der Beamtenschaft eine Zeremonialordnung entwickelt, die ebenfalls von Mehmed II. in allen Punkten bestimmt ward.“5 Vor allem Konrad Dilger hat durch seine Arbeit „Untersuchungen zur Geschichte des osmanischen Hofzeremoniells im 15. und 16. Jahrhundert“ Überlegungen angestoßen, welche die Selbstständigkeit des osmanischen Hofzeremoniells betonen. Neben Dilger hat sich Gülru Necipoglu in Form einer Monographie der Thematik des osmanischen Zeremoniells angenommen. Allerdings liegt Necipoglus Schwerpunkt auf der Architektur der Palastanlagen. In der Forschung nimmt die Thematik des Hofzeremoniells nur eine Randstellung ein. Sind die beiden eben genannten Werke doch die einzigen zur Thematik.
==
1 Dernschwam 1986, S. 64
2 Dilger 1967, S. 1
3 Faroqhi 2004, S. 41
4 Dilger 1967, S. 1
5 Babinger 1987, S. 474
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Der Eintritt in den Serây
- Die Audienz beim Sultan
- Der Empfangssaal ('Arżodasï)
- Das Betreten des Audienzraumes
- Das Führen der Gesandten
- Der Handkuss und die Verbeugung
- Das Aufstehen und Entgegenkommen des Sultans
- Das Sitzen und Stehen vor dem Sultan
- Die Kopfbedeckung
- Der Wortwechsel zwischen dem Sultan und den Gesandten
- Der Thron des Sultans
- Das Geschenkwesen
- Die Bewirtung im Serây
- Das Gastmahl für die Gesandten
- Die Abhubregelung
- Die Großen des Reiches und andere Untergebene des Sultans
- Die Handhaltung und das Niederschlagen der Augen
- Die Alqïš
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das osmanische Hofzeremoniell des 15. und 16. Jahrhunderts aus der Perspektive abendländischer Gesandter. Ziel ist es, die Wahrnehmung und Beschreibung dieses Zeremoniells durch europäische Beobachter zu analysieren und die damit verbundenen Missverständnisse und Mythen zu beleuchten. Die Arbeit stützt sich dabei auf schriftliche Quellen wie Reiseberichte und Gesandtschaftsberichte.
- Die Darstellung des osmanischen Hofes in abendländischen Berichten
- Die Rekonstruktion der Audienzzeremonien am Hof des Sultans
- Die Rolle des Zeremoniells in der Konstruktion des Sultanbildes
- Die Interpretation kultureller Unterschiede und Missverständnisse
- Die Analyse der verwendeten Quellen und deren Limitationen
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung: Die Einführung beleuchtet die geheimnisvolle Wahrnehmung des osmanischen Hofes im Abendland und die damit verbundenen Spekulationen. Sie diskutiert die Entstehung und Entwicklung des osmanischen Hofzeremoniells im 16. Jahrhundert, kritisch die bisherige Forschungslage, welche oft von einer ausschließlichen byzantinischen Beeinflussung ausging, und hebt die Bedeutung des Qânûnnâme Mehmeds II. hervor. Die Arbeit konzentriert sich auf die Perspektive abendländischer Besucher, basierend auf ihren Berichten. Die Quellenlage, bestehend aus Berichten italienischer, französischer und deutscher Beobachter sowie bildlichen Darstellungen, wird ebenfalls beschrieben.
Der Eintritt in den Serây: Dieses Kapitel beschreibt detailliert den Eintritt abendländischer Besucher in den Topkapi-Palast. Es wird der Prozess vom ersten Tor (bab-i hümayun) bis zum zweiten Tor geschildert, wobei die architektonischen Besonderheiten des Palastes, die Wachen und die Atmosphäre in den verschiedenen Höfen im Detail dargestellt werden. Besonderes Augenmerk wird auf die Schilderungen von verschiedenen Besuchern gelegt, die den Ablauf und die Eindrücke beschreiben. Die Beschreibungen unterstreichen den kontrollierten und ritualisierten Zugang zum Sultan.
Schlüsselwörter
Osmanisches Hofzeremoniell, Sultan Mehmed II., Qânûnnâme, Abendländische Gesandte, Reiseberichte, Topkapi-Palast, Audienz, Kulturvergleich, Missverständnisse, Quellenkritik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum osmanischen Hofzeremoniell
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das osmanische Hofzeremoniell des 15. und 16. Jahrhunderts aus der Sicht abendländischer Gesandter. Sie untersucht die Wahrnehmung und Beschreibung dieses Zeremoniells durch europäische Beobachter und beleuchtet dabei Missverständnisse und Mythen.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf schriftliche Quellen wie Reiseberichte und Gesandtschaftsberichte von italienischen, französischen und deutschen Beobachtern. Bildliche Darstellungen werden ebenfalls berücksichtigt.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Darstellung des osmanischen Hofes in abendländischen Berichten, die Rekonstruktion der Audienzzeremonien, die Rolle des Zeremoniells in der Konstruktion des Sultanbildes, die Interpretation kultureller Unterschiede und Missverständnisse sowie die Analyse der verwendeten Quellen und deren Limitationen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit enthält eine Einführung, Kapitel zum Eintritt in den Serây (Topkapi-Palast), zur Audienz beim Sultan (inkl. detaillierter Beschreibungen wie Empfangssaal, Handkuss, Wortwechsel etc.), zum Sultansthron, zum Geschenkwesen, zur Bewirtung im Serây, zu den Großen des Reiches und anderen Untergebenen des Sultans und eine Schlussbemerkung. Jedes Kapitel beschreibt den Ablauf und die Eindrücke der abendländischen Besucher.
Welche Rolle spielt das Qânûnnâme?
Die Arbeit erwähnt die Bedeutung des Qânûnnâme Mehmeds II. und kritisiert die bisherige Forschungslage, die oft von einer ausschließlichen byzantinischen Beeinflussung ausging.
Wie wird der Zugang zum Sultan beschrieben?
Der Eintritt in den Topkapi-Palast wird detailliert beschrieben, vom ersten Tor bis zum zweiten Tor, einschließlich der architektonischen Besonderheiten, der Wachen und der Atmosphäre in den verschiedenen Höfen. Der kontrollierte und ritualisierte Zugang zum Sultan wird hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Osmanisches Hofzeremoniell, Sultan Mehmed II., Qânûnnâme, Abendländische Gesandte, Reiseberichte, Topkapi-Palast, Audienz, Kulturvergleich, Missverständnisse, Quellenkritik.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Wahrnehmung des osmanischen Hofzeremoniells durch europäische Beobachter zu analysieren und die damit verbundenen Missverständnisse und Mythen zu beleuchten.
Welche Kapitelzusammenfassungen werden angeboten?
Es gibt Kapitelzusammenfassungen für die Einführung und das Kapitel "Der Eintritt in den Serây". Diese fassen die Kernaussagen der jeweiligen Kapitel zusammen und geben einen Überblick über deren Inhalt.
- Citar trabajo
- Björn Müller (Autor), 2006, Das osmanische Hofzeremoniell des 15. und 16. Jahrhunderts aus Sicht der abendländischen Gesandten, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/72039