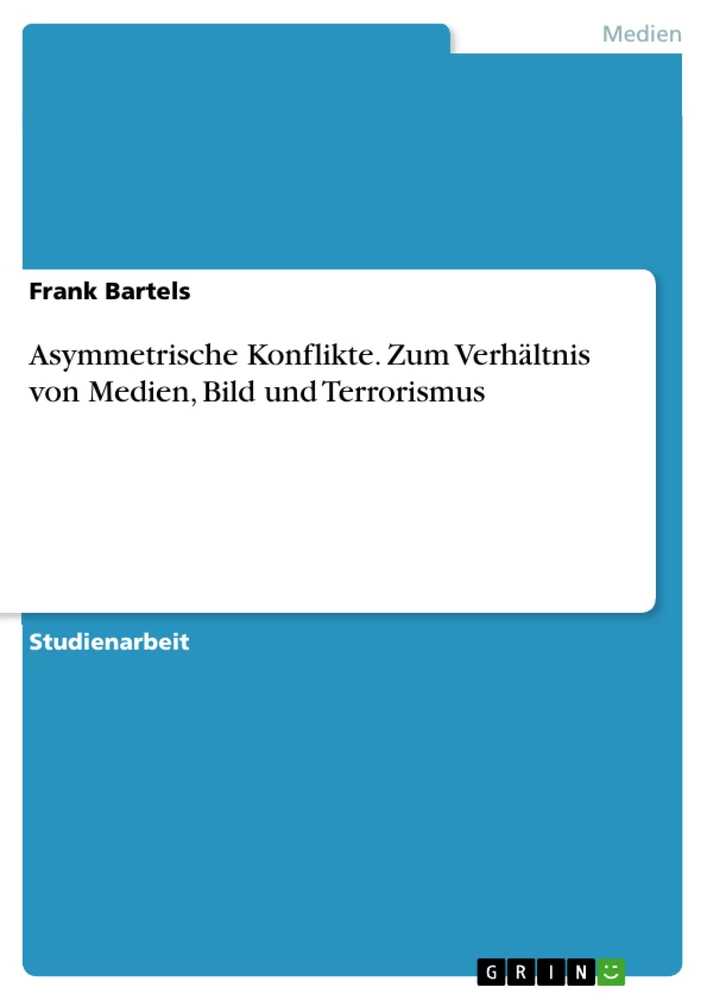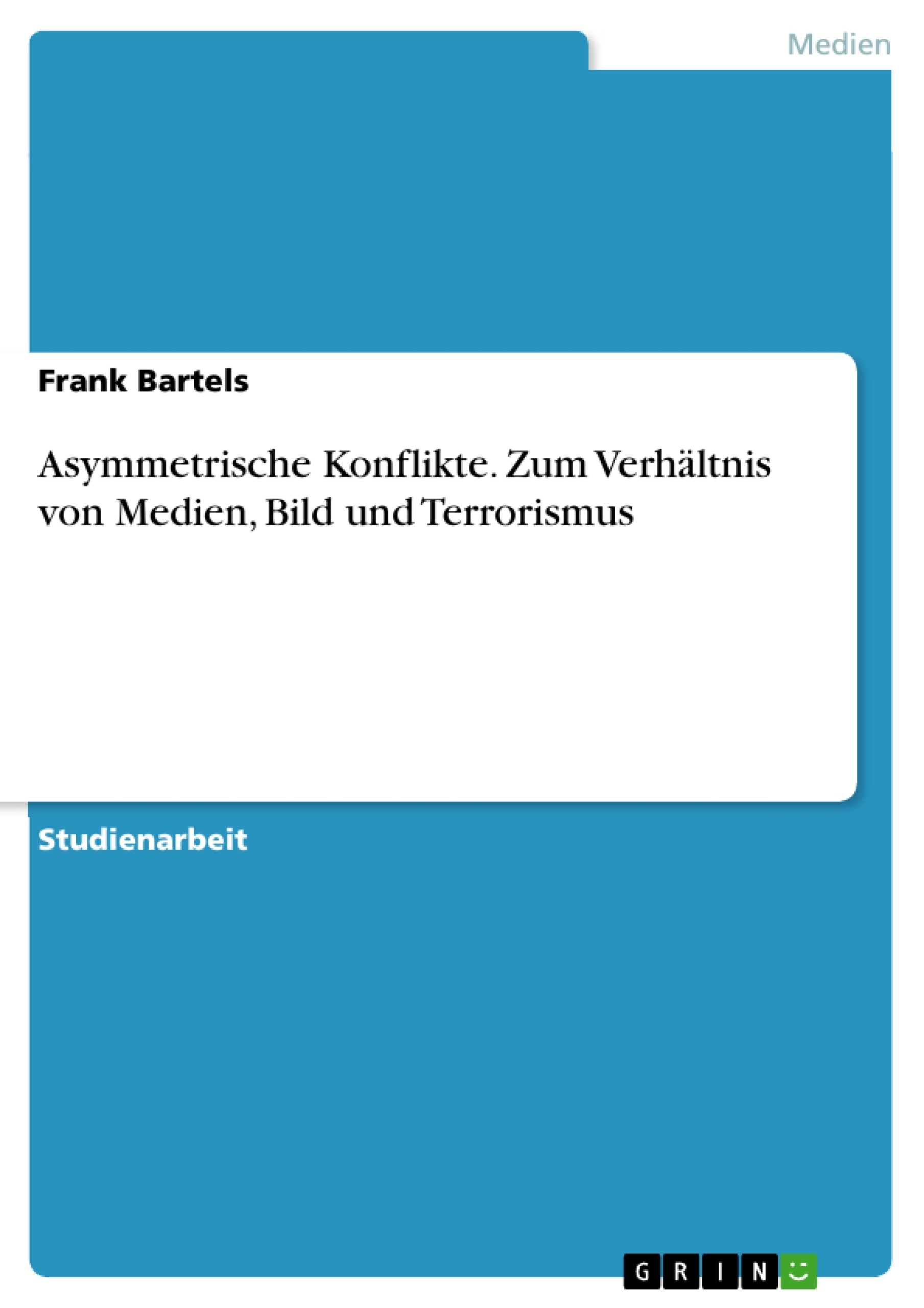Die Zahl der wissenschaftlichen Untersuchungen zum sich wandelnden Terrorismus und dessen Konsequenzen, die, wenngleich auch nur Konstruktionen, wenigstens dem Code Wahr/Unwahr folgen, ist noch immer spärlich und der Diskurs um die ‚neuen Kriege’ noch im Anfangsstadium befindlich. Über die Ereignisse von 9/11, wie über alle damit zusammenhängenden Ereignisse, haben wir primär Kenntnis durch die Massenmedien, denen wir aufgrund unseres Wissens über ihre Arbeitsweisen jedoch kaum vertrauen, geschweige denn ihre Realitätskonstruktion als Basis wissenschaftlicher Aussagen anerkennen können. Sind die Medien möglicherweise essentieller Bestandteil terroristischer Strategien, wie Waldmann behauptet oder können sie sich ihrerseits dieser aufgezwungenen Komplizenschaft entziehen? Ferner soll die Visualisierung realer Geschehnisse innerhalb der Terrorismusberichterstattung thematisiert und kritisch hinterfragt werden, wobei der Blickwinkel gezielt auf das Verhältnis von Produktion und Rezeption der Bilder, sowie auf die Konstruktion visueller Symbole gelenkt werden soll. Die Konzentration liegt dabei auf den Anschlägen von 9/11, die aufgrund der Besonderheit der Ereignisse auch in den Medien eine außergewöhnliche Rolle einnahmen. Zum Ende dieser Arbeit soll eine kritische Betrachtung der Massenmedien im Umgang mit dem Terrorismus stehen und neue Arten im Umgang der Medien mit dem Terrorismus diskutiert und bewertet werden. Aspekte der (Selbst-) Inszenierung und Mystifizierung einzelner Personen, wie beispielsweise der Baader-Meinhof-Komplex der siebziger Jahre oder aktuell Osama Bin Laden, als das ‚personifizierte Böse’, sind aufgrund der Komplexität des Gesamtthemas nicht Bestandteil dieser Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zur Begrifflichkeit
- Definition einer asymmetrischen Kriegs- und Weltordnung
- Das Bild als Waffe in asymmetrischen Konflikten
- Metaphern / Bildsprache
- Zeichen, Bilder und Symbole
- Die Wechselwirkung von Bild und Realität
- 9/11 - Zum Verhältnis von Ereignis, Realität und Bild
- Massenmedien und Terrorismus
- Kritik an der Medienberichterstattung
- Die erzwungene Komplizenschaft
- Das Dilemma der Ethik
- Lösungsansätze - Oder die Frage nach Verantwortung
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Rolle der Massenmedien in asymmetrischen Konflikten, insbesondere im Kontext des Terrorismus. Es wird analysiert, inwiefern Medien Bestandteil terroristischer Strategien sind oder sich dieser Komplizenschaft entziehen können. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der kritischen Betrachtung der Visualisierung realer Ereignisse in der Terrorismusberichterstattung und der Konstruktion visueller Symbole.
- Asymmetrische Konflikte und ihre mediale Darstellung
- Das Bild als Waffe im Kontext des Terrorismus
- Die Rolle der Massenmedien in der Konstruktion von Realität und Symbolen
- Medienethik und Verantwortung in der Berichterstattung über Terrorismus
- Analyse der Anschläge vom 11. September 2001 als Fallbeispiel
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die anhaltende Präsenz der Bilder der Anschläge vom 11. September 2001 und deren Bedeutung als Ikonen des vermeintlich Realen. Sie führt die zunehmende Bedeutung von Visualisierung in der Berichterstattung über Krieg und Terrorismus ein und hebt die mangelnde wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesem Thema hervor. Der Fokus liegt auf der Rolle der Massenmedien in asymmetrischen Konflikten und der Frage, ob diese essentieller Bestandteil terroristischer Strategien sind. Die Arbeit konzentriert sich auf die Anschläge von 9/11 als Fallbeispiel.
Zur Begrifflichkeit: Dieses Kapitel definiert den Begriff der asymmetrischen Kriegs- und Weltordnung, ausgehend von Münklers Analyse der Veränderungen in strategischen und politischen Auseinandersetzungen nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Es unterscheidet zwischen symmetrischen und asymmetrischen Konflikten und beschreibt Terrorismus als eine „reinste“ Form asymmetrischer Konfliktaustragung, die sich vom Guerillakampf durch die Zielsetzung unterscheidet: Terroristen wollen nicht den Raum, sondern das Denken besetzen. Die klassische Clausewitzschen Definition des Krieges als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln wird im Kontext asymmetrischer Konflikte hinterfragt.
Das Bild als Waffe in asymmetrischen Konflikten: Dieses Kapitel analysiert die Funktion von Bildern als Waffen in asymmetrischen Konflikten. Es untersucht Metaphern, Bildsprache, Zeichen, Symbole und die Wechselwirkung von Bild und Realität. Der Abschnitt zu 9/11 betrachtet das Verhältnis von Ereignis, Realität und Bild im Kontext der Medienberichterstattung. Der Schwerpunkt liegt auf der Produktion und Rezeption von Bildern und der Konstruktion visueller Symbole, die Deutungs- und Wertmuster transportieren und den Diskurs über den Konflikt beeinflussen.
Massenmedien und Terrorismus: Dieses Kapitel widmet sich der kritischen Betrachtung der Massenmedienberichterstattung über Terrorismus, inklusive der Analyse der erzwungenen Komplizenschaft von Medien und Terroristen. Es thematisiert das ethische Dilemma der Medien im Umgang mit Terrorismus und diskutiert Lösungsansätze und die Frage nach der Verantwortung der Medien. Der Schwerpunkt liegt auf der kritischen Auseinandersetzung mit den Herausforderungen und den Möglichkeiten eines verantwortungsvollen Umgangs der Medien mit dem Thema Terrorismus.
Schlüsselwörter
Asymmetrische Konflikte, Terrorismus, Massenmedien, Bild, Visualisierung, Medienberichterstattung, Realität, Symbole, Medienethik, Verantwortung, 9/11.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Die Rolle der Massenmedien in asymmetrischen Konflikten
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Rolle der Massenmedien in asymmetrischen Konflikten, insbesondere im Kontext des Terrorismus. Sie analysiert, inwieweit Medien Bestandteil terroristischer Strategien sind oder sich dieser Komplizenschaft entziehen können und befasst sich kritisch mit der Visualisierung realer Ereignisse in der Terrorismusberichterstattung und der Konstruktion visueller Symbole. Die Anschläge vom 11. September 2001 dienen als Fallbeispiel.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf asymmetrische Konflikte und ihre mediale Darstellung, das Bild als Waffe im Kontext des Terrorismus, die Rolle der Massenmedien in der Konstruktion von Realität und Symbolen, Medienethik und Verantwortung in der Berichterstattung über Terrorismus sowie eine detaillierte Analyse der Anschläge vom 11. September 2001.
Wie wird der Begriff „asymmetrischer Konflikt“ definiert?
Die Arbeit definiert den Begriff der asymmetrischen Kriegs- und Weltordnung ausgehend von Münklers Analysen. Sie unterscheidet zwischen symmetrischen und asymmetrischen Konflikten und beschreibt Terrorismus als eine „reinste“ Form asymmetrischer Konfliktaustragung, die sich vom Guerillakampf durch ihre Zielsetzung unterscheidet: Terroristen wollen nicht den Raum, sondern das Denken besetzen. Die klassische Clausewitzschen Definition des Krieges wird im Kontext asymmetrischer Konflikte hinterfragt.
Welche Rolle spielen Bilder in asymmetrischen Konflikten?
Die Arbeit analysiert die Funktion von Bildern als Waffen in asymmetrischen Konflikten. Sie untersucht Metaphern, Bildsprache, Zeichen, Symbole und die Wechselwirkung von Bild und Realität. Am Beispiel von 9/11 wird das Verhältnis von Ereignis, Realität und Bild in der Medienberichterstattung beleuchtet. Der Schwerpunkt liegt auf der Produktion und Rezeption von Bildern und der Konstruktion visueller Symbole, die Deutungs- und Wertmuster transportieren und den Diskurs über den Konflikt beeinflussen.
Wie wird die Medienberichterstattung über Terrorismus kritisch betrachtet?
Die Arbeit befasst sich kritisch mit der Massenmedienberichterstattung über Terrorismus, einschließlich der Analyse der erzwungenen Komplizenschaft von Medien und Terroristen. Sie thematisiert das ethische Dilemma der Medien im Umgang mit Terrorismus und diskutiert Lösungsansätze und die Frage nach der Medienverantwortung. Der Schwerpunkt liegt auf den Herausforderungen und Möglichkeiten eines verantwortungsvollen Umgangs der Medien mit dem Thema Terrorismus.
Welche Rolle spielen die Anschläge vom 11. September 2001 in der Arbeit?
Die Anschläge vom 11. September 2001 dienen als Fallbeispiel, um die Thesen der Arbeit zu veranschaulichen. Die anhaltende Präsenz der Bilder von 9/11 und deren Bedeutung als Ikonen des vermeintlich Realen wird in der Einleitung beleuchtet. Die Arbeit analysiert das Verhältnis von Ereignis, Realität und Bild im Kontext der Medienberichterstattung zu 9/11.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Asymmetrische Konflikte, Terrorismus, Massenmedien, Bild, Visualisierung, Medienberichterstattung, Realität, Symbole, Medienethik, Verantwortung, 9/11.
- Arbeit zitieren
- Frank Bartels (Autor:in), 2006, Asymmetrische Konflikte. Zum Verhältnis von Medien, Bild und Terrorismus, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/72358