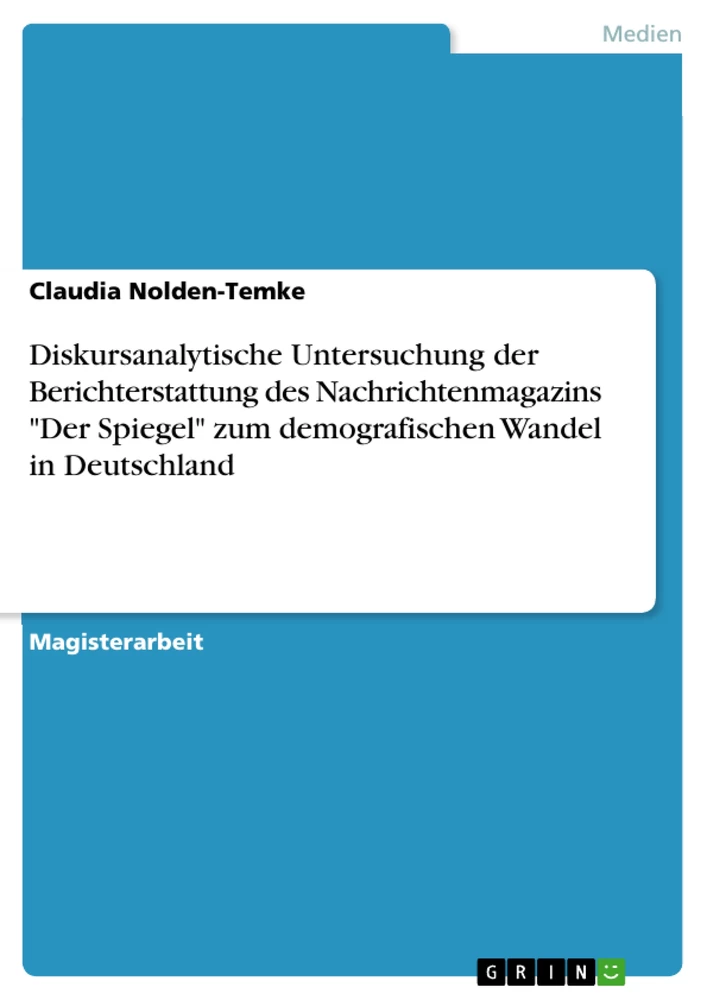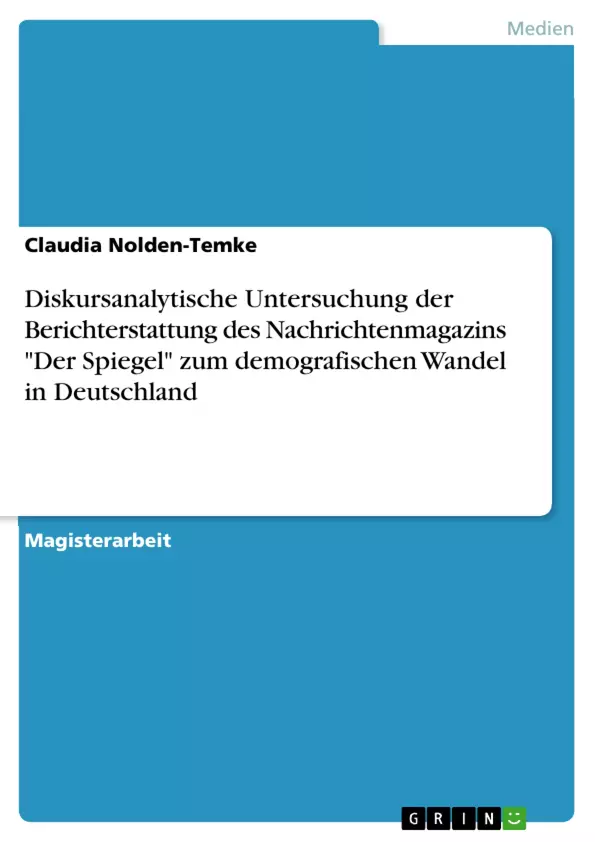Für einen Teil der traditionellen Medienforschung hat die Annahme, dass die Funktion der Medien in der Abbildung von realen Geschehnissen liegt, um diese für nicht beteiligte Rezipienten erfahrbar zu machen, noch heute Gültigkeit. Dieser Auffassung zufolge existiert eine objektiv erfassbare Alltagsrealität, die in ihrer Existenz nur nach dem journalistischen Objektivitätsanspruch passiv beschrieben und abgebildet werden muss, um ein möglichst genaues Abbild der realen Lebenswelt zu erhalten. Hiernach wird die Realität selbst als eine von den Medien unbeeinflusste Größe betrachtet, Medien kommt die Aufgabe zu, der Realität nachfolgend über diese zu informieren.
Im Gegensatz zu dieser abbildtheoretischen Annahme entwickelten sich im Rahmen von konstruktivistischen als auch diskursanalytischen Perspektiven neue medientheoretische Sichtweisen. Realität wird nicht mehr als objektiv erkennbar Vorhandenes, sondern als etwas durch einen sozialen Konstruktionsprozess ständig neu Geschaffenes konzeptualisiert. Die Medien bzw. der Diskurs konstruieren somit eine „Palette unterschiedlicher Realitätsdeutungen mit unterschiedlichen Akzenten aus verschiedenen Perspektiven (...). Es liegt nun beim Publikum, sich daraus (aktiv) eine eigene Realitätsvorstellung zu bilden (...).1 Demzufolge findet eine Beeinflussung der Rezipienten durch die Medien statt, Medien konstruieren subjektive Bedeutung und Realität.
Somit stellt sich die Frage, welche Konstrukte der „Realität“, welche Konstrukte von Themen und Ereignissen durch die Medien geschaffen werden, die unsere Vorstellung, unser Wissen und somit auch unsere Einstellung gegenüber Ereignissen, wie politischen Entscheidungen, Individuen und dem sozialen Miteinander prägen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Erkenntnisinteresse und Untersuchungsgegenstand
- Zentrale Forschungsfragen
- Vorgehensweise der Analyse
- Der demografische Wandel – Charakter und Elemente
- Die demografische Entwicklung in Deutschland
- Demografie und öffentliche Aufmerksamkeit
- Theoretischer Hintergrund
- Diskurstheoretische Perspektive der Wirklichkeitsdeutung oder „Der Spiegel“ ist kein Spiegel der Realität
- Kollektivsymbolik und Bedeutungszuschreibungen
- Die Struktur des Diskurses: Terminologien und Definitionen
- Das Analyseverfahren der kritischen Diskursanalyse
- Methodische Verfahren der kritischen Diskursanalyse
- Die Strukturanalyse
- Der Materialkorpus und das Dossier
- Die Feinanalyse ausgewählter typischer Diskursfragmente
- Die Interpretation des Diskursstranges
- Methodisches Vorgehen dieser Arbeit
- Der Gang der Analyse
- Das untersuchte Medium
- Das Instrumentarium der Strukturanalyse
- Analyse und Auswertung
- Der Demografische Wandel, seine Unterthemen und ihre quantitative Präsenz im Zeitverlauf
- Bewertung des demografischen Wandels und seiner Unterthemen im Zeitverlauf
- Gründe der Ursachen des demografischen Wandels
- Folgen des demografischen Wandels
- Interventionsansätze
- Dargestellte Szenarien - Zusammenfassung
- Die demografische Zeitbombe
- Sonderlasten der Alterung
- Der Zeugungsstreik
- Zuwanderung in Parallelwelten
- Der schleichende Tod - Abwanderung innerhalb Deutschlands
- Elite im Exil - Abwanderung ins Ausland
- Kollektivsymbole und sprachliche Bilder
- Spezialdiskurs der Bevölkerungswissenschaft
- Prognosen, Szenarien und Symbole
- Statistiken und Zahlen
- Zusammenfassende Diskussion und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Analyse der Berichterstattung des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ zum demografischen Wandel in Deutschland im Zeitraum von 2001 bis 2005. Ziel ist es, die Konstruktion von Realität im medialen Diskurs aufzuzeigen und die Verwendung von wissenschaftlichen Aussagen in diesem Prozess zu untersuchen.
- Die Konstruktion von Realität im Mediendiskurs
- Die Verwendung von Kollektivsymbolen in der Berichterstattung
- Die Integration des Spezialdiskurses der Bevölkerungswissenschaft in den Interdiskurs
- Die Rolle des demografischen Wandels in der öffentlichen Debatte
- Die Bewertung von Unterthemen wie Alterung, Fertilität, Zuwanderung und Abwanderung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert das Erkenntnisinteresse und die zentralen Forschungsfragen der Arbeit. Kapitel 2 gibt eine Definition des demografischen Wandels und stellt die demografische Entwicklung in Deutschland sowie die öffentliche Aufmerksamkeit für dieses Thema dar. In Kapitel 3 werden die theoretischen Grundlagen der Analyse, die Diskurstheorie und die kritische Diskursanalyse, erläutert. Kapitel 4 beschreibt das methodische Vorgehen der Analyse, die Auswahl des Materials und die Definition wichtiger Terminologien. Der Hauptteil der Arbeit (Kapitel 5) analysiert die quantitative und qualitative Präsenz des demografischen Wandels in „Der Spiegel“, die Bewertung des Themas und seiner Unterthemen, die Ursachen und Folgen des Wandels sowie die Konzeption von Interventionsansätzen. Kapitel 6 untersucht die Integration des Spezialdiskurses der Bevölkerungswissenschaft in den medialen Interdiskurs und die Verwendung von wissenschaftlichen Aussagen und Kollektivsymbolen. Das abschließende Kapitel 7 fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen, diskutiert diese und gibt einen Ausblick auf weiterführende Fragestellungen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen des demografischen Wandels, der medialen Konstruktion von Realität, der kritischen Diskursanalyse, Kollektivsymbolen, der Integration des Spezialdiskurses der Bevölkerungswissenschaft in den Interdiskurs, der Bewertung des demografischen Wandels und seinen Unterthemen sowie der Konzeptualisierung von Interventionsansätzen.
Häufig gestellte Fragen
Wie konstruiert „Der Spiegel“ die Realität des demografischen Wandels?
Das Magazin nutzt spezifische Kollektivsymbole und sprachliche Bilder, um den Wandel oft als Bedrohungsszenario (z.B. „demografische Zeitbombe“) darzustellen.
Was ist das Ziel einer kritischen Diskursanalyse in diesem Kontext?
Ziel ist es aufzuzeigen, dass Medien keine objektive Realität abbilden, sondern durch Bedeutungszuschreibungen und Selektion eine subjektive Wirklichkeit erschaffen.
Welche Unterthemen des demografischen Wandels werden besonders betont?
Im Fokus stehen die Überalterung der Gesellschaft, der „Zeugungsstreik“ (niedrige Geburtenraten) sowie die Auswirkungen von Zuwanderung und Abwanderung.
Wie wird Wissenschaft im Mediendiskurs instrumentalisiert?
Bevölkerungswissenschaftliche Prognosen und Statistiken werden oft verkürzt oder dramatisiert wiedergegeben, um die Dringlichkeit politischer Interventionsansätze zu untermauern.
Welche Szenarien werden in der Berichterstattung entworfen?
Die Szenarien reichen von der „Sonderlast der Alterung“ über „Zuwanderung in Parallelwelten“ bis hin zur „Elite im Exil“ durch Abwanderung ins Ausland.
- Quote paper
- M.A, Claudia Nolden-Temke (Author), 2006, Diskursanalytische Untersuchung der Berichterstattung des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" zum demografischen Wandel in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/72401