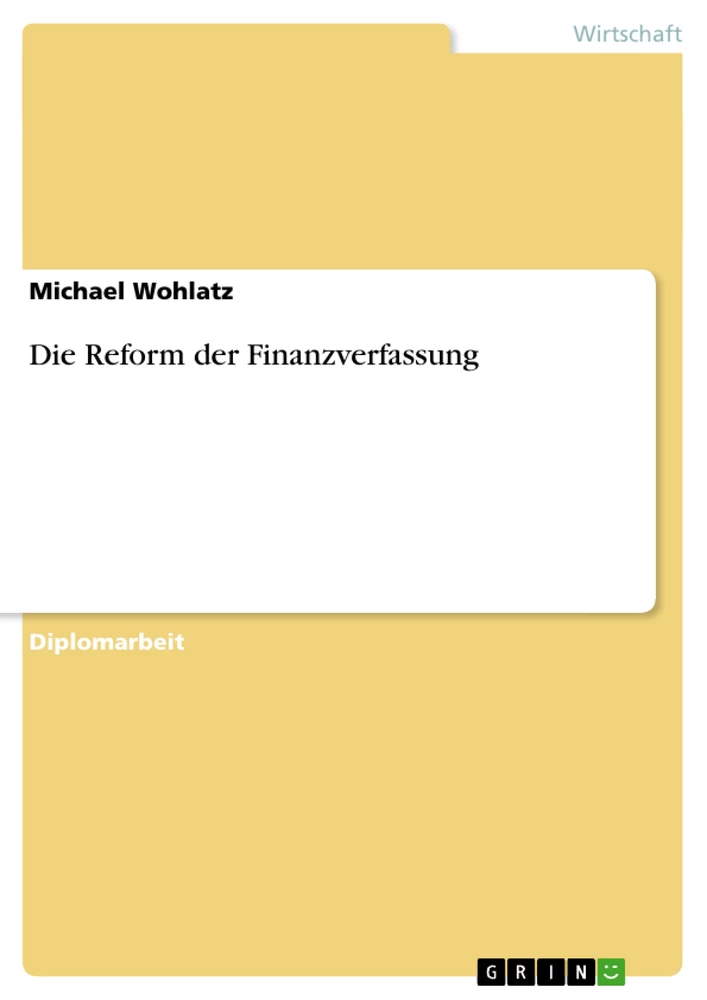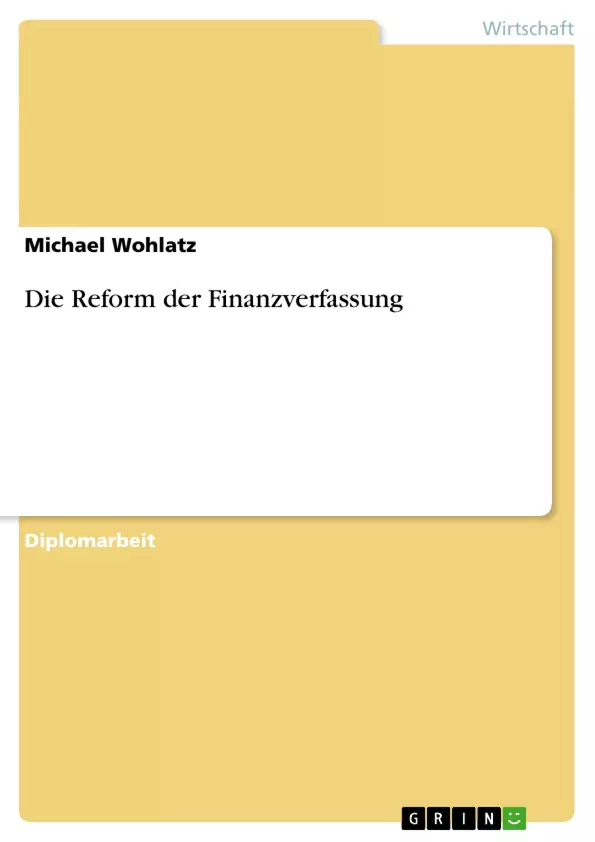Die föderalen Finanzbeziehungen in Deutschland gleichen einem gordischen Knoten. Weitgehende Verflechtungen sowohl auf der Ausgaben- als auch auf der Einnahmenseite haben die bundesstaatliche Finanzverfassung zu einem System entwickeln lassen, dass aus ökonomischer Sicht gekennzeichnet ist durch zahlreiche Ineffizienzen und fragwürdige Detailregelungen. Statt Effizienz und Autonomie in den Vordergrund zu stellen, dominieren unter der Prämisse vereinheitlichter Lebensverhältnisse bundeseinheitliche Regelungen, die weitreichende ökonomische Fehlwirkungen erwarten lassen.
Neben der Wissenschaft hat auch die Politik unlängst die Schwäche der derzeitigen bundesstaatlichen Finanzverfassung erkannt. Während die gemeinsame Kommission von Bundestag und Bundesrat zur Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung im Dezember 2004 zunächst für gescheitert erklärt wurde, flossen im Herbst 2005 die wesentlichen Ergebnisse der Kommissionsberatungen in die Koalitionsverhandlungen der CDU/CSU und SPD ein.
Mit der Verabschiedung des Koalitionsvertrags vom 11. November 2005 verband sowohl die Wissenschaft als auch die gesamte föderale Politikstruktur die Hoffnung, die föderalen Finanzbeziehungen entflechten zu können. Doch während die im Juli 2006 beschlossene Föderalismusreform durchaus zu einer Entflechtung der Entscheidungsprozesse beitrug, blieben die Grundgesetzänderungen im Bereich des Fiskalföderalismus weit hinter den Erwartungen zurück. Die Kritik an der Finanzverfassung bleibt unverändert aktuell: Will man der Politikverflechtungsfalle entkommen, in die die heutige Ausformung des kooperativen Föderalismus geführt hat, bedarf es einer grundsätzlichen Reform der bundesstaatlichen Finanzverfassung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die bundesstaatliche Finanzverfassung – Eine Bestandsaufnahme
- Die Geschichte der Finanzverfassung im Bundesstaat
- Die deutsche Finanzverfassung 2006 – Darstellung der geltenden Regelungen
- Die Verteilung der Auf- und Ausgabenkompetenzen
- Die Verteilung der Steuergesetzgebungskompetenzen
- Die Verteilung der Einnahmen
- Nationaler Stabilitätspakt
- Beurteilung der bestehenden Regelungen zur Finanzverfassung
- Die Verteilung der Auf- und Ausgabenkompetenzen
- Die Verteilung der Steuergesetzgebungskompetenzen
- Die Verteilung der Einnahmen
- Nationaler Stabilitätspakt
- Die Reform der deutschen Finanzverfassung
- Ansatzpunkte für eine Reform der Finanzverfassung
- Ökonomische Anforderungen – Konsequenzen aus der finanzwissenschaftlichen Theorie
- Die Verteilung der Auf- und Ausgabenkompetenzen
- Die Verteilung der Steuergesetzgebungskompetenzen
- Die Verteilung der Einnahmen
- Nationaler Stabilitätspakt
- Kompensation
- Eigene Reformüberlegungen zur Sicherung finanzpolitischer Nachhaltigkeit
- Ansatzpunkte für eine Reform der Finanzverfassung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht die deutsche bundesstaatliche Finanzverfassung und analysiert deren Schwächen aus ökonomischer Perspektive. Die Arbeit identifiziert die Ursachen für die gegenwärtige finanzpolitische Situation und entwickelt Reformvorschläge, die auf eine Stärkung der Länderfinanzautonomie und einen Wettbewerbsföderalismus abzielen.
- Analyse der bestehenden Mischfinanzierungstatbestände
- Kritik an der Dominanz des kooperativen Föderalismus
- Forderung nach einem höheren Maß an Ländersteuerautonomie
- Bewertung der aktuellen Regelungen zum Finanzausgleich
- Entwicklung eines vorbeugenden nationalen Stabilitätspakts zur Sicherung finanzpolitischer Nachhaltigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer historischen Einordnung der bundesstaatlichen Finanzverfassung. Anschließend werden die geltenden Regelungen zur Verteilung von Aufgabenkompetenzen, Steuergesetzgebungskompetenzen und Einnahmen sowie zum nationalen Stabilitätspakt dargestellt. Im zweiten Kapitel werden diese Regelungen einer kritischen Beurteilung unterzogen, wobei vor allem ökonomische Aspekte und die mit dem kooperativen Föderalismus verbundenen Nachteile im Vordergrund stehen. Das dritte Kapitel widmet sich den Reformüberlegungen und beleuchtet die konzeptionellen Eckpunkte einer Neugestaltung der deutschen Finanzverfassung. Hier werden die theoretischen Grundlagen und die wichtigsten Reformansätze vorgestellt, die auf eine Stärkung der Länderfinanzautonomie und eine Neuordnung des Länderfinanzausgleichs abzielen. Darüber hinaus werden die Anforderungen eines nachhaltigen nationalen Stabilitätspakts erläutert. Im vierten Kapitel wird abschließend ein Fazit gezogen und die Bedeutung der Reform der Finanzverfassung für die Stabilität des deutschen Bundesstaates hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themenbereiche Finanzverfassung, Föderalismus, Finanzausgleich, Ländersteuerautonomie, Mischfinanzierungen, Wettbewerb, Nachhaltigkeit und Stabilitätspakt. Der Fokus liegt dabei auf der ökonomischen Analyse der bestehenden Regelungen und der Entwicklung von Reformvorschlägen, die eine stärkere Berücksichtigung der ökonomischen Prinzipien der Subsidiarität und der fiskalischen Äquivalenz gewährleisten sollen.
Häufig gestellte Fragen
Was wird an der aktuellen deutschen Finanzverfassung kritisiert?
Kritisiert werden ineffiziente Mischfinanzierungen, die "Politikverflechtungsfalle" und mangelnde steuerliche Autonomie der Bundesländer.
Was ist die "Politikverflechtungsfalle" im Föderalismus?
Sie beschreibt ein System, in dem sich Bund und Länder gegenseitig blockieren oder zu ineffizienten Kompromissen gezwungen sind, da ihre Entscheidungs- und Finanzkompetenzen zu stark verwoben sind.
Welche Reformziele verfolgt die Diplomarbeit?
Ziele sind die Stärkung der Länderfinanzautonomie, die Einführung von Wettbewerbsföderalismus und die Neuordnung des Länderfinanzausgleichs.
Was ist ein nationaler Stabilitätspakt?
Ein Instrument zur Sicherung finanzpolitischer Nachhaltigkeit, das Bund und Länder zur Einhaltung von Haushaltsdisziplin verpflichtet, um die Stabilität des Gesamtstaates zu wahren.
Warum ist Ländersteuerautonomie wichtig?
Sie ermöglicht es den Ländern, über eigene Einnahmen zu entscheiden, was den Wettbewerb fördert und die Verantwortlichkeit der Landespolitiker gegenüber ihren Wählern stärkt.
- Quote paper
- Michael Wohlatz (Author), 2007, Die Reform der Finanzverfassung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/72448