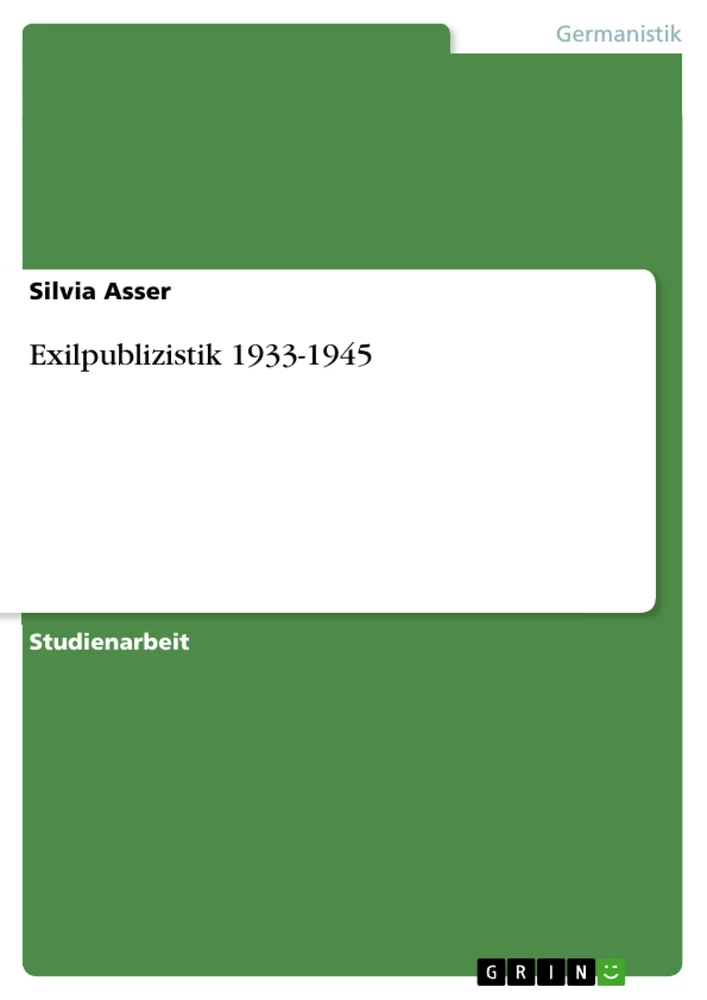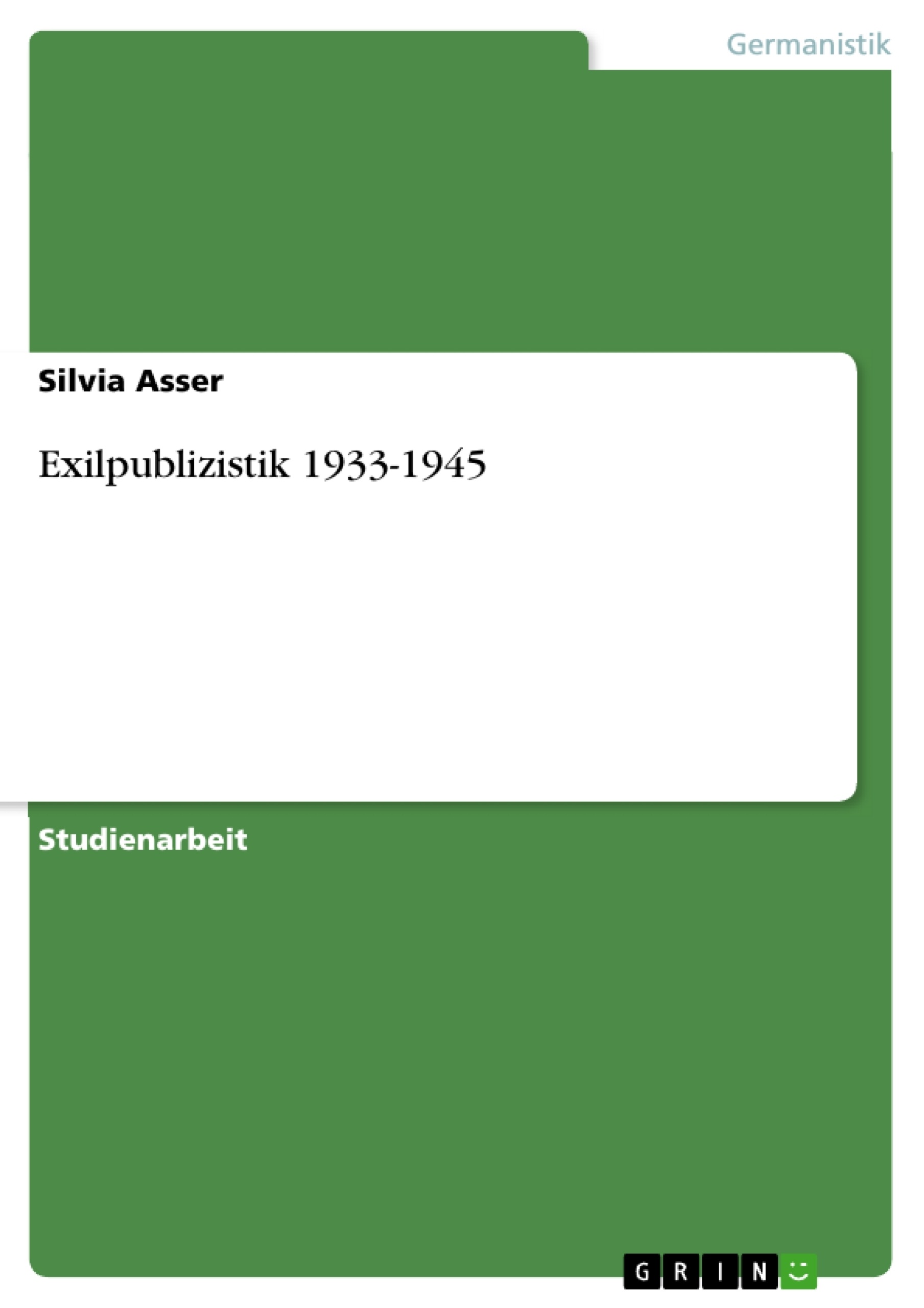Nach einigen allgemeinen Informationen zur Exilliteratur zwischen 1933 und 1945 möchte ich am Beispiel auserwählter Texte aus der oppositionellen Exilzeitung Argentinisches Wochenblatt zeigen, wie literarische Texte, die nicht immer von den betreffenden Dichtern als „politische Waffe“ eingesetzt wurden, politisch interpretiert und explizit politisiert werden können. Auf den ersten Blick wirken die auserwählten Gedichte unpolitisch - sie implizieren lediglich Momente der Ohnmacht und Hilflosigkeit. Durch die zeiträumlichen Verhältnisse und vor allem durch die Veröffentlichung bekommen sie allerdings eine politische Dimension. Literatur als Waffe gegen den Nationalsozialismus.
Zum anderen ist in den Gedichten, die in dieser Zeit entstanden sind, eine Entwicklung festzustellen: Anfangs thematisierten die Gedichte Heimweh und die Hoffnung auf eine Besserung der momentanen Situation und auf eine baldige Rückkehr nach Deutschland und gaben somit Trost und Stärkung in Zeiten von Trauer und Leid. Als sich allerdings eine längere Dauer der Verbannung abzeichnete, waren die Hauptthemen in der Lyrik das erlittene Leid und vor allem Resignation. Alle Hoffnungen auf ein baldiges Ende waren zerschlagen.
Dies gilt es im weiteren Verlauf der Arbeit zu beweisen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Exilliteratur (von 1933 bis 1945)
- Emigration und Presse
- Das Argentinische Wochenblatt als Beispiel
- Lyrik als literarische Form der Exilpublikation
- Die Topoi der Exillyrik
- Die Entwicklung in der Exillyrik
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die politische Interpretation literarischer Texte aus dem oppositionellen Argentinischen Wochenblatt im Exil (1933-1945). Sie zeigt, wie Gedichte, die zunächst unpolitisch erscheinen, durch ihren Kontext und die Veröffentlichung eine politische Dimension erhalten. Der Fokus liegt auf der Entwicklung der Exillyrik und der Rolle der Literatur als Widerstand gegen den Nationalsozialismus.
- Politische Interpretation von scheinbar unpolitischer Lyrik
- Die Rolle des Argentinischen Wochenblatts als oppositionelles Medium
- Entwicklung der Themen in der Exillyrik (von Hoffnung zu Resignation)
- Exil als "Fluch und Gnade zugleich"
- Literatur als Waffe gegen den Nationalsozialismus
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung skizziert die zentrale These der Arbeit: literarische Texte aus dem Exil, insbesondere Gedichte des Argentinischen Wochenblatts, können trotz ihres zunächst unpolitischen Charakters politisch interpretiert werden. Sie beschreibt die anfängliche Hoffnung auf Rückkehr und die spätere Resignation als sich die Dauer des Exils verlängerte, und kündigt die Beweisführung dieser These im weiteren Verlauf der Arbeit an. Die angesprochenen Gefühle von Ohnmacht und Hilflosigkeit werden als implizite politische Aussagen verstanden, die durch den Kontext verstärkt werden.
1. Exilliteratur (von 1933 bis 1945): Dieses Kapitel definiert den Begriff "Exilliteratur" im Kontext des antifaschistischen Widerstands, wobei betont wird, dass es sich nicht nur um explizit politisch-pragmatische Literatur handelt. Es beschreibt die Emigration unzähliger deutscher Dichter ab 1933 und die damit verbundenen Herausforderungen des Exils: Sprachbarrieren, Verlust des Publikums und materielle Not. Es wird die anfängliche Hoffnung auf baldige Rückkehr und die spätere Konfrontation mit der Realität der anhaltenden Nazi-Diktatur hervorgehoben, ein Thema, welches die Entwicklung der Lyrik im Exil prägt.
1.1 Emigration und Presse: Dieses Unterkapitel beleuchtet die Rolle der Emigrantenpresse als Plattform für literarischen Widerstand. Es wird der Wandel von aufklärerischem Journalismus hin zu einer Kommunikationsform beschrieben, die Zuversicht und Hoffnung vermitteln soll. Die zunehmende Verschmelzung von Literatur und Politik wird erläutert, und die Bedeutung der Zeitschriften als „intellektuelles Zentrum“ wird herausgestellt. Die Exilpresse liefert somit Einblicke in die politischen Aktivitäten, die Ohnmacht und die Zerrissenheit der Exilanten.
1.2 Das Argentinische Wochenblatt als Beispiel: Dieses Unterkapitel präsentiert das Argentinische Wochenblatt als wichtiges Beispiel einer oppositionellen Zeitung im Exil. Es hebt die überparteiliche Haltung und das entschiedene Engagement gegen das Hitler-Regime hervor, und unterstreicht die Rolle der Zeitung als wichtiges Organ des antifaschistischen Widerstands.
Schlüsselwörter
Exilliteratur, Argentinisches Wochenblatt, antifaschistischer Widerstand, Lyrik, politische Interpretation, Emigration, Hoffnung, Resignation, Nationalsozialismus, politische Waffe.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Exilliteratur im Argentinischen Wochenblatt (1933-1945)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die politische Dimension scheinbar unpolitischer Lyrik aus dem Argentinischen Wochenblatt, einer oppositionellen Zeitung im Exil (1933-1945). Der Fokus liegt auf der Entwicklung der Exillyrik und ihrer Rolle als Widerstand gegen den Nationalsozialismus.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die politische Interpretation von Gedichten, die Rolle des Argentinischen Wochenblatts als oppositionelles Medium, die Entwicklung der Themen in der Exillyrik (von Hoffnung zu Resignation), das Exil als "Fluch und Gnade zugleich" und die Literatur als Waffe gegen den Nationalsozialismus.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über Exilliteratur (1933-1945) mit Unterkapiteln zu Emigration und Presse sowie dem Argentinischen Wochenblatt als Beispiel, und eine Schlussbetrachtung.
Was ist die zentrale These der Arbeit?
Die zentrale These ist, dass literarische Texte aus dem Exil, insbesondere Gedichte des Argentinischen Wochenblatts, trotz ihres zunächst unpolitischen Charakters politisch interpretiert werden können. Die anfängliche Hoffnung auf Rückkehr und die spätere Resignation werden als implizite politische Aussagen verstanden, die durch den Kontext verstärkt werden.
Welche Rolle spielt das Argentinische Wochenblatt?
Das Argentinische Wochenblatt dient als Fallbeispiel für eine oppositionelle Zeitung im Exil. Es wird als wichtiges Organ des antifaschistischen Widerstands beschrieben, das durch seine überparteiliche Haltung und sein entschiedenes Engagement gegen das Hitler-Regime eine Plattform für literarischen Widerstand bot.
Wie entwickelt sich die Exillyrik im Laufe der Zeit?
Die Exillyrik spiegelt die Entwicklung der Hoffnungen und der Resignation der Exilanten wider. Anfänglich geprägt von Hoffnung auf eine baldige Rückkehr, entwickelt sie sich im Laufe der anhaltenden Nazi-Diktatur hin zu einer zunehmenden Resignation.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Exilliteratur, Argentinisches Wochenblatt, antifaschistischer Widerstand, Lyrik, politische Interpretation, Emigration, Hoffnung, Resignation, Nationalsozialismus, politische Waffe.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine politische Interpretationsmethode, die den Kontext der Texte und die Rolle des Argentinischen Wochenblatts als Medium des Widerstands berücksichtigt. Sie analysiert, wie scheinbar unpolitische Gedichte durch ihren Kontext eine politische Bedeutung erhalten.
- Quote paper
- Silvia Asser (Author), 2006, Exilpublizistik 1933-1945, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/72496