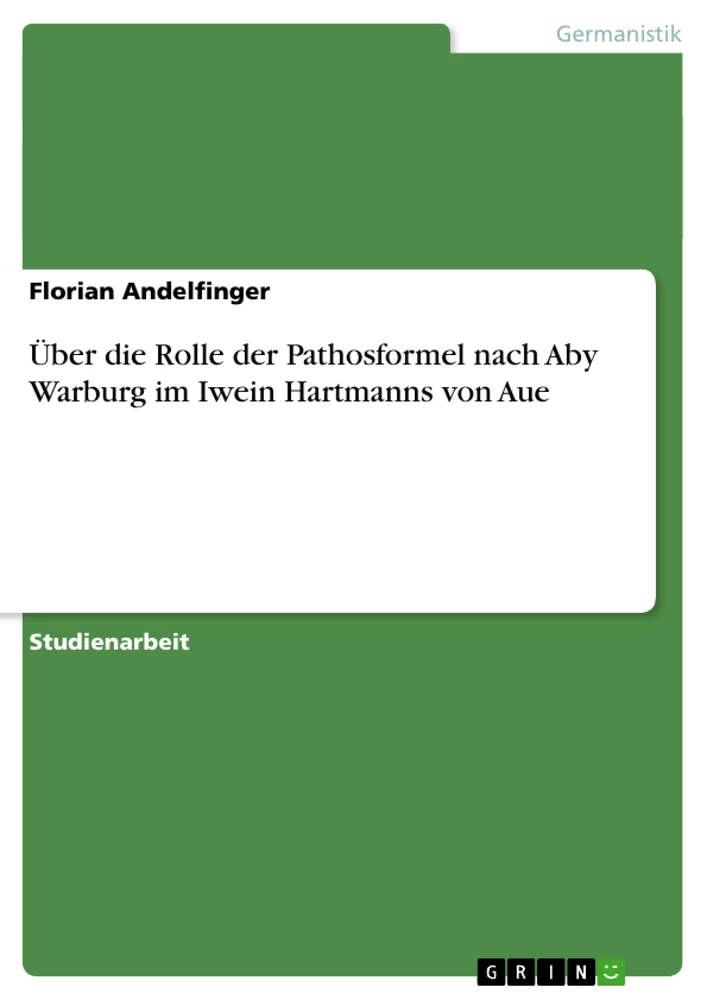Mit dem Mnemosyne-Atlas, einem ehrgeizigen Projekt, das zum unvollendeten Lebenswerk wurde, entwickelte der Kunst- und Kulturhistoriker Aby Warburg eine komplexe und hochinteressante Theorie über die Nachwirkung antiker gebärdensprachlicher Zeichen in der Kunst der Renaissance, die sich in ihren Grundzügen auch anderen Stilen und Epochen anpassen und auf solche anwenden lässt.
Das mit seiner Theorie eng verknüpfte Kompositum Pathosformel, welches Warburg synonym für „Ausdrucksgebärden der bildenden Kunst“ verwendet, ist dabei von besonderem Interesse, legt es doch eine Standardisierung von Gestik und Mimik bei der körperlichen Ausformung innerer Befindlichkeiten nahe. Eine bemerkenswerte Annahme, die durch die Forschung auch bestätigt zu werden scheint, wie Ingrid Kasten in ihrer Einleitung zu Codierungen von Emotionen im Mittelalter erklärt: „Ethnologische Studien zeigen, dass die Modellierung von Gefühlen und die Formen des verbalen wie nonverbalen Ausdrucks von Emotionen kulturell bedingt sind und einen hohen Grad von Ritualisierung aufweisen können“. Die historische Emotionalitätsforschung scheint zudem zu belegen, „dass die Variabilität von Emotionen auch geschichtlich bedingt ist“: Während Trauer beispielsweise „in mittelalterlichen Quellen im Allgemeinen körperlich und öffentlich manifestiert wird, scheint sie in der Moderne dagegen stärker verinnerlicht und zugleich in anderer Weise konventionalisiert und von körperlichen Ausdrucksformen abgelöst zu sein“.
Auch wenn sich Warburgs Forschung vorwiegend auf grafische und plastische Darstellungen der Antike und Renaissance konzentriert, scheinen sich seine Gedanken in der Beschäftigung mit mittelalterlicher Literatur, die über eine besondere theatralische Qualität verfügt, ebenfalls nutzbar machen zu lassen.
Der vorliegende Aufsatz will deshalb den Versuch unternehmen, Warburgs Theorie, von seiner Einleitung zum Mnemosyne-Atlas ausgehend, zunächst vorzustellen und zu diskutieren, um sie im Anschluss auf ausgewählte Textstellen aus Hartmanns von Aue Artusroman Iwein anzuwenden.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Mnemosyne-Atlas
- Einleitung zum Mnemosyne-Atlas
- Pathosformel
- Laudines Klage
- Iweins Begnadigung und die Versöhnung des Ehepaares
- Iweins Wahnsinn
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der vorliegende Aufsatz untersucht die Theorie von Aby Warburg, insbesondere den Begriff der „Pathosformel“, und ihre Anwendung auf Hartmanns von Aue Artusroman Iwein.
- Die Rolle der Pathosformel in der Kunst der Renaissance
- Die Bedeutung der „Eindruckserbmasse“ für den Künstler
- Die Analyse von Gesten und Mimik als Ausdrucksformen des inneren Ergriffenseins
- Die Funktion von Pathosformeln als ritualisierter Ausdruck von Emotionen
- Die Verbindung von körperlicher und geistiger Entwicklung in der Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
- Vorwort: Der Aufsatz stellt Aby Warburgs Theorie der „Pathosformel“ und deren Relevanz für die Untersuchung mittelalterlicher Literatur vor.
- Mnemosyne-Atlas: Dieses Kapitel erläutert Warburgs „Mnemosyne-Atlas“ und seine Einleitung, in der er seine Theorie der „Pathosformel“ darlegt. Warburg argumentiert, dass Künstler auf eine „Eindruckserbmasse“ kulturell memorierter Ausdrucksformen zurückgreifen, um neue Werke zu schaffen.
- Laudines Klage: Dieses Kapitel analysiert Laudines Klage nach dem Tod ihres Ehegatten. Laudines Trauer äußert sich in einer standardisierten Geste, die gesellschaftlich akzeptiert ist und ihren Kummer als soziales Ereignis manifestiert.
- Iweins Begnadigung und die Versöhnung des Ehepaares: Dieses Kapitel untersucht den ritualisierten Prozess der Begnadigung und Versöhnung zwischen Iwein und Laudine. Die Gesten der Unterwerfung und Reue folgen etablierten gesellschaftlichen Normen.
- Iweins Wahnsinn: Dieses Kapitel beschreibt Iweins geistigen Verfall und seine Rückkehr zur Vernunft. Die Analyse zeigt, wie Körper und Geist in Iweins Fall eng miteinander verknüpft sind und wie der Verlust von Kleidung und höfischen Sitten eine Distanz zum bisherigen Leben ermöglicht.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen des Aufsatzes sind Aby Warburgs „Pathosformel“, die „Eindruckserbmasse“, die Analyse von Gesten und Mimik als Ausdrucksformen des inneren Ergriffenseins, die Funktion von Pathosformeln als ritualisierter Ausdruck von Emotionen, und die Verbindung von körperlicher und geistiger Entwicklung in der Literatur.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine "Pathosformel" nach Aby Warburg?
Eine Pathosformel ist eine bildlich tradierte Ausdrucksgebärde, mit der Künstler intensive emotionale Zustände durch standardisierte Gestik und Mimik darstellen.
Was versteht Warburg unter der "Eindruckserbmasse"?
Es handelt sich um einen kulturellen Pool an memorierter Ausdrucksformen aus der Antike, auf den Künstler späterer Epochen (z.B. Renaissance) unbewusst zurückgreifen.
Wie lässt sich die Pathosformel auf Hartmanns "Iwein" anwenden?
Emotionen wie Laudines Klage oder Iweins Wahnsinn werden im Roman durch hochgradig ritualisierte körperliche Zeichen ausgedrückt, die gesellschaftlich codiert sind.
Warum ist die Emotionalitätsforschung im Mittelalter relevant?
Sie zeigt, dass Gefühle im Mittelalter oft körperlich und öffentlich manifestiert wurden, während sie in der Moderne eher verinnerlicht und konventionalisiert sind.
Welche Rolle spielt der "Mnemosyne-Atlas"?
Der Atlas war Warburgs unvollendetes Hauptwerk, in dem er die Wanderung und Nachwirkung antiker Pathosformeln in der europäischen Kultur visuell dokumentierte.
- Quote paper
- Florian Andelfinger (Author), 2006, Über die Rolle der Pathosformel nach Aby Warburg im Iwein Hartmanns von Aue, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/72591